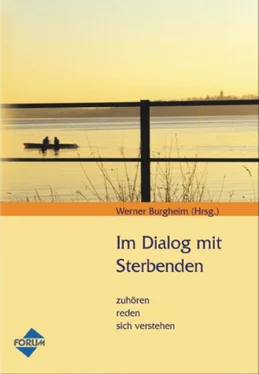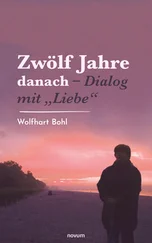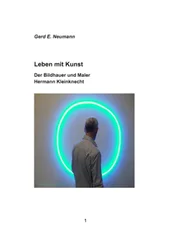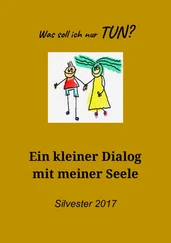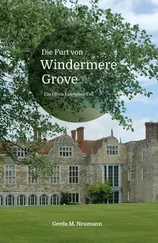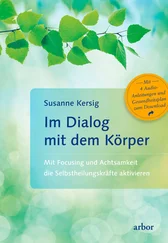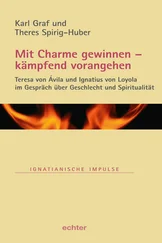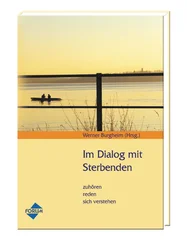Kriterien
Mithilfe einiger Kriterien versuchen wir uns der Wirklichkeit zu versichern (s. a. Balgo 1998: 143):
Strukturell (u. a. Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Dreidimensionalität, Lokalisierbarkeit, Art und Tempo der Bewegung): War es nicht etwas zu dunkel für einen echten Raben? Er hat sich ja eigentlich gar nicht bewegt;
Inhaltlich (u. a. Bedeutungsinhalt, Kontextstimmigkeit, Aufforderungscharakter): Was sollte denn auch ein Rabe auf meinem Bettholm?
Praktisch (u. a.: „Kann man es begreifen, ist es wirklich, steht es in Bezug zu dem Wahrnehmenden?“): Was sollte denn auch ein Rabe in meinem Zimmer?
1. Begegnungen mit der Symbolsprache
Mit Hilfe der Symbolsprache versuchen wir das Extrakt des Erlebten in einem Bild wiederzugeben. Dieses Bild mag die Wirklichkeit oder auch eine Illusion widerspiegeln. Wichtig scheint, dass der Mensch einen Ausdruck findet, welcher über die rationale Sprachebene einen Ausdruck v. a. für seine erlebten Emotionen findet. „Der Mensch in der Krise versucht, sich auszusprechen, und da seine Krise in seiner Befindlichkeit zum Ausdruck kommt, wird er über seinen Zustand kaum sachlich objektiv argumentierend reden. Diese auf die Sachebene reduzierte Sprache reicht nicht aus für das, was ihn bewegt.“ (Piper 1993: 61).
Klassifizierung
Begegnen wir einem Menschen, der sich uns gegenüber in einer Symbolsprache mitteilen will, reagieren wir mitunter irritiert. Schnell wird dieser Mensch als verwirrt eingestuft. Diese Klassifizierung dient in erster Linie der Beantwortung unserer Irritation: Was wir nicht verstehen, wehren wir ab, und dies gelingt uns am besten, wenn wir den anderen als verwirrt darstellen. Aber eigentlich sind es ja wir, die in diesem Moment verwirrt über das Verhalten des anderen sind. „Nachträglich erklären Angehörige oft, der Sterbende habe sein Sterben geahnt . Aber meist hat niemand diese Ahnung aufgenommen. Auch in dieser Hinsicht sind sterbende Menschen oft isoliert. Die Sprache, die um sie her gesprochen wird, ist die Sprache der Befunde, der medizinischen Technik, der Behandlungsabläufe – die Sprache der Vermeidung. Das Ziel mechanischer Lebensverlängerung verdeckt oft das Gespür für die emotionalen Lebensbedürfnisse. Auf die Signale der Todesahnung reagiert die Umwelt meist beschwichtigend oder verwehrend.“ (Lückel 1994: 83). Es gilt die Sprache in ihrer Mehr- und Tiefendimensionalität zu lernen, damit wir Sterbende besser verstehen und die Betroffenen nicht sprachlos, ohne begleitenden Dialogpartner, einsam sterben müssen (vgl. Piper, 1993: 66).
Mehr- und Tiefendimensionalität
Nicht die Eindeutigkeit des Wortes,
sondern seine Mehrdeutigkeit begründet eine lebendige Sprache. 2
Dialog
In der Kranken- und Sterbebegleitung gilt es sowohl mit den Träumen als auch mit den Halluzinationen, die uns Betroffene berichten, sehr einfühlsam und äußerst behutsam im Dialog umzugehen. 3Holen Sie den Betroffenen nicht notwendigerweise aus seiner Phantasiewelt und vermeiden Sie Illusionen zu korrigieren oder auch zu bestätigen. Sie können dem Betroffenen besser helfen, indem Sie in Ruhe herausfinden, welche möglichen Gefühle, verborgene Bedürfnisse u. a. seinen Wahrnehmungen als Basis dienen könnten. Wenn Sie diese einfühlsam in einem gemeinsamen Dialog mit dem Betroffenen zum Ausdruck bringen können, kann sich dieser angenommen fühlen und seine Wahrnehmungen werden sich auflösen, da ihnen die Basis fehlt.
2. Wahrnehmen und Erkennen vom Symbolcharakter einer Rede
Traumsymbole
In der Symbolsprache ändert sich der Sprachausdruck und ähnelt in seiner Bildhaftigkeit der Poesie oder auch biblischen Gleichnissen. Oft enthalten diese Bilder uns bereits bekannte Symbole. Diese Vertrautheit mit der aus unserer kulturellen Erfahrung stammenden Symbolik kann uns helfen unsere Gefühle zu akzeptieren. 4„In den Traumsymbolen sind Erfahrungen von Generationen kondensiert. Nicht von ungefähr ist die Sprache der Träume mit der Sprache von Mythen und Märchen verwandt, in deren Symbolsprache die Lebenserfahrungen von Generationen eingefangen sind“ (Lückel 1994: 86). Die Inhalte der Bilder sind beispielsweise Themen wie Furcht, Einsamkeit, Ohnmacht, Hoffnung, Zweifel, Glaube, Ahnung und Ungewissheit.
Definition Träume
Träume sind verdichtete Emotionen und Erfahrungen, die in einer bildreichen Sprache sich uns mitteilen. Mithilfe von Träumen finden wir einen Weg, unsere Kreativität auszudrücken, und mit ihrer Hilfe versuchen wir z. B. Erlebtes und Konflikte zu gestalten, Wünsche und Nicht-Erlebbares zu leben. Träume geben uns die Möglichkeit, schöpferisch zu handeln, Lösungen in Konflikten und Problemen zu finden. Gerade in Situationen des Lebens, wo der Mensch an der Schwelle von einer Lebensphase in eine andere steht (bzw. vom Leben in den Tod), nimmt er in seinen Träumen oft einen anderen Akteur wahr, der für ihn die Problemlösung erlebt. Mit viel schöpferischer Kraft erlaubt uns dieses traumhafte Rollenspiel Lösungsentwürfe durchzuspielen, bevor wir die passenden für unser eigenes Leben annehmen können. Dies kann v. a. dann besonders hilfreich sein, wenn der Mensch, wie in der Sterbephase häufig, so genannte unerledigte Lebenssituationen noch einmal durchlebt.
Wahrnehmungen
Die Wahrnehmungen in Träumen oder Halluzinationen können für den Betroffenen aus unterschiedlichen Perspektiven erlebt werden, wie z. B. auch der Vogelperspektive, im veränderten Tempo (z. B. Zeitraffer, Slow-Motion), oder der Betroffene spürt beispielsweise, wie er seine alten Kräfte wiedererlangt. So erzählte beispielsweise eine Patientin, die seit vielen Jahren an einer schweren chronischen Erkrankung litt und nur mehr eine eingeschränkte Motorik besaß, dass sie in ihren Träumen nicht nur wieder wie früher Ski fahren könne, sondern auch in ihren Träumen erstmals Sportarten ausüben könne, welche sie in der Realität nie ausprobiert hatte. Ein anderer Patient, der aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr Auto fahren konnte, berichtete, dass er im Traum ab und zu wieder Auto fahren würde, es ihn aber sehr anstrengen würde, da das Auto wie in einem Stummfilm sehr schnell und unharmonisch fahren würde.
Individualität der Symbolsprache
Jeder Mensch hat aufgrund seiner persönlichen Lebenserfahrung immer auch individuelle Träume und eine individuelle Symbolsprache. Und doch erleben wir in der Begleitung von Schwerkranken und v. a. von Sterbenden oft, dass bestimmte Bilder den Betroffenen erscheinen. Dies ist u. a. aus dem gemeinsamen Kulturkreis und seiner Symbolik erklärbar. Im Folgenden finden Sie eine kleine Auswahl von Bildern, denen Sie so oder in einer Variante v. a. in der Begleitung von Sterbenden begegnen können. Wichtig ist jedoch, dass wir daran denken, dass jedes Bild einen individuellen Sinngehalt besitzt, wir also nie sagen können: „Ach, das kenn‘ ich schon, ich weiß schon, worum es geht …“. Bleiben wir doch ruhig offen für das, was der Betroffene uns möglicherweise in einem vertraulichen Gespräch erzählen mag. Denn nur er wird die Symbolkraft des Bildes für sich entdecken können und uns vielleicht mitteilen.
Sorge um die wirtschaftliche Absicherung
Fallbeispiele – Sorge um die finanzielle Absicherung
Ein älterer Patient drückt gegenüber einer Krankenschwester seine große Sorge aus, dass das Geld nicht reichen könnte. Er zählt das Geld nach und ist beruhigt, dass es noch vier Tage reichen wird. Vier Tage später stirbt er.
Eine schwerkranke Patientin bittet entlassen zu werden, da sie Angst hat, dass der Klinikaufenthalt zu teuer wird. Ihre Nichte kann sie beruhigen, dass sie alles Finanzielle regeln wird.
Читать дальше