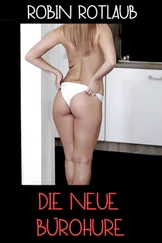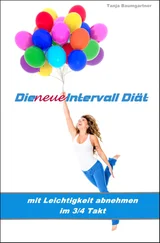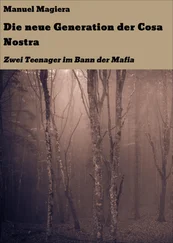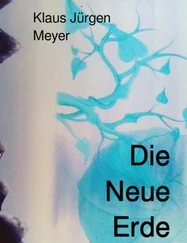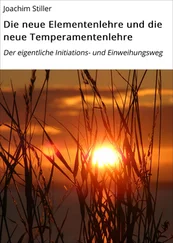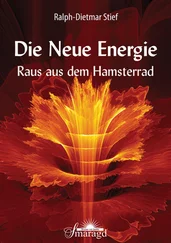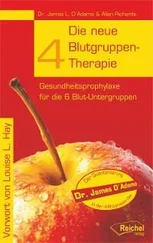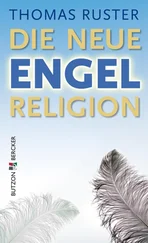Zunächst kennt die AwSV keine grundsätzliche Form einer „Mindermengenregelung“. So nennt die Tabelle in § 39 in ihrer ersten inhaltlichen Zeile ≤ 0,22 m3 oder 0,2 t als untere Mengenabgrenzung. Allerdings gibt es zwei wichtige Ausnahmen:
| • |
oberirdische Anlagen für flüssige wassergefährdende Stoffe mit einem Inhalt von ≤ 0,22 m3 oder/und gasförmige sowie feste Stoffe ≤ 0,2 t |
| • |
Anlagen, bei denen der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen während der gesamten Betriebsdauer als „unerheblich“ eingeschätzt werden kann |
Derartige Anlagen sind von der AwSV ausdrücklich ausgenommen.
Das typische Rollensickenfass (großes Ölfass) enthält knapp unter 220 l. Ein einzelnes Fass davon ist gerade eben noch keine AwSV-Anlage. Stellt man einen 10 l fassenden kleinen Öl-Kanister daneben, muss das Ganze als eine Anlage betrachten werden, und die AwSV findet Anwendung.
Bei der Frage, was als „unerheblich“ gelten kann oder nicht, gibt es keine festen Vorgaben. Hier sind ggf. bereits die aus einem 20 l Reservekanister mit Diesel auslaufenden Mengen durchaus geeignet, eine negative Gewässerbeeinflussung hervorzurufen. Im Zweifel sollte man sich von der zuständigen Behörde bestätigen lassen, dass es sich bei der jeweils infrage stehenden technischen Einheit um eine mit „unerheblichen“ Mengen wassergefährdender Stoffe belastete Einheit handelt. Findet eine Entscheidung ohne entsprechende Befragungsbestätigung statt und kommt die Behörde bei einer späteren Überprüfung zu einem abweichenden Ergebnis, wäre damit das Risiko ordnungsrechtlicher Konsequenzen verbunden.
Bei allen Mengen-/Volumenbetrachtungen wird immer das tatsächlich mögliche technische Füllvolumen von Anlagen, nicht das „zzt. maximal betrieblich genutzte“ Volumen betrachtet. Erst wenn z. B. ein 15 m³ aufweisender Tank durch fest installierte, nicht einfach verstellbare Füllstandssensoren (elektronisch verstellbare Höhenmessungen reichen nicht!) so begrenzt wird, dass bei einem Füllvolumen von 9,9 m³ die zuführenden Pumpen und Leitungen mit Schaltventilen geschlossen werden und somit eine Füllung auf mehr als 10 m³ ausgeschlossen werden kann, lässt sich dieser Tank in die Volumenklasse „kleiner 10 m³“ einordnen.
 1.2.5 Anlagenbegriff
1.2.5 Anlagenbegriff
{Anlagenbegriff}
Die AwSV gilt für „Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“. Um den Begriff „Anlage“ zu erfüllen, muss es sich um technische Einheiten handeln, die
| • |
selbständig benutzt, |
| • |
ortsfest benutzt, |
| • |
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft oder im Bereich öffentlicher Einrichtung verwendet, |
| • |
zum Zwecke der Lagerung, des Umschlages, der Herstellung und Behandlung wassergefährdende Stoffe – gelagert, – umgeschlagen, – hergestellt, – behandelt, |
werden. Oder es muss sich um
| • |
Rohrleitungsanlagen nach § 62 Abs. 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes |
handeln.
Ein häufiger Fehler in der Anwendung der AwSV besteht in einer falschen und deutlich zu engen Auslegung des Begriffs „Anlage“. Bspw. wird i. d. R. ein Lagerplatz, der nur aus einigen m² Fläche besteht und zum wiederholten Abstellen des betrieblichen Altölsammelfasses dient, bereits „Anlage“ im Sinne der AwSV sein. Dazu bedarf es keiner größeren Apparatetechnik.
 Hinweis Hinweis |
| Achten Sie bei der Zuordnung von Anlagen bzw. Anlagenteilen/der Einteilung Ihres Betriebes auf „versteckte“ AwSV-Anlagen. |
Der über 220 l Gesamtinhalt fassende Chemikalienlagerschrank im Labor oder das oberirdische Lack- und Lösemittellager des kleinen Malerunternehmens sind ebenfalls bereits AwSV-Anlagen, für die besondere Anforderungen gelten können. Auch das über 200 kg beinhaltende Streusalzlager des drei Personen umfassende Hausmeisterdienstleistungsunternehmen ist eine AwSV-Anlage (wenn auch mit niedrigen Anforderungen).
Befindet sich die „Anlage“ im Bereich einer Wasserschutzzone oder dem ausgewiesenen Überschwemmungsbereich eines Gewässers, können sich die technisch/organisatorischen Anforderungen an die „Anlage“ zudem noch weiter erhöhen. Z. B. fallen dann die Freistellungen für oberirdische Anlagen für flüssige und gasförmige wassergefährdende Stoffe unterhalb von 220 l bzw. 200 kg weg.
§ 62 Abs. 1 Satz 2 des WHG beschreibt Rohrleitungsanlagen, die
| 1. |
den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreiten, |
| 2. |
Zubehör einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind oder |
| 3. |
Anlagen verbinden, die in engem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang miteinander stehen. |
Damit sind vor allem „Fernleitungen“ nicht von der AwSV betroffen, aber alle mit ein bis drei beschreibbaren Rohrleitungsanlagen auf dem Betriebsgelände sehr wohl.
Auch über die Anwendung des Begriffs „ortsfest“ oder „ortsfest benutzt“ gibt es immer wieder Diskussionen, obwohl die AwSV diese als
„Einheiten, wenn sie länger als ein halbes Jahr an einem Ort zu einem bestimmten betrieblichen Zweck betrieben werden“,
tituliert.
Beispiele für ortsfest benutzte Einheiten:
| • |
Ein mobiler Hydraulikbagger (das Hydrauliköl ist hierbei der wassergefährdende Stoff) ist an sich nicht ortsfest und somit keine „Anlage im Sinne der AwSV“. Wird der Hydraulikkran aber „ortsfest benutzt“ (z. B. in einer Umschlaganlage auf Schienen hin und her laufend), fällt er als „ortsfest benutzt“ unter den Anwendungsbereich der AwSV. |
| • |
Das mit zwei Rädern und Anhängerkupplung ausgestattete größere Notstromaggregat, ist an sich ortsbeweglich und unterliegt damit nicht den Anforderungen der AwSV. Wird es jedoch ortsfest benutzt, insbesondere dauerhaft mit dem Stromnetz, das es ersetzen soll, verbunden, fällt es ebenfalls in den Geltungsbereich der AwSV. |
| • |
Der Hydraulikzylinder im Gabelstapler, der auf dem Betriebsgelände herumfährt, ist keine Anlage im Sinne der AwSV (nicht ortsfest benutzt). Der sehr ähnlich aufgebaute Hydraulikzylinder, der einen Aufzug für Fässer in die erste Etage antreibt, aber sehr wohl (ortsfeste Anlage). |
Die in der Begriffsbestimmung genannten Grenzen
| • |
halbes Jahr, |
| • |
an einem Ort, |
beziehen sich auf ein Kalenderhalbjahr, nicht auf einen längere Zeit mehrfach unterbrochenen Betrieb, mit einer Gesamtdauer von mehr als sechs Monaten.
Diese Frist ist keine „Die ersten sechs Monate sind frei“-Regelung. Ist von vornherein ein längerer Betrieb geplant, sind alle entsprechenden Forderungen an ortsfeste bzw. ortsfest benutzte Anlagen vom ersten Tag an einzuhalten.
„An einem Ort“ beschreibt i. d. R ein in sich geschlossenes Betriebsgelände. Der andere Teil des Betriebsgeländes auf der gegenüberliegenden Seite der öffentlichen Straße oder vergleichbare Situationen sind hiermit nicht mehr abgedeckt. Die Betriebstankstelle einer größeren Straßen-/Autobahnbaustelle, die im Zuge des schrittweise weiteren Baufortschritts auf der Baustelle mehrfach schrittweise um einige 100 m versetzt wird, ist im Gegenzug jedoch durchaus mit dem Begriff „an einem Ort“ abgedeckt.
Bei der Abgrenzung von Anlagen und derer katastermäßiger Nachverfolgbarkeit ist zu beachten, dass „Anlagen“ aus mehreren Anlagenteilen bestehen können.
Читать дальше
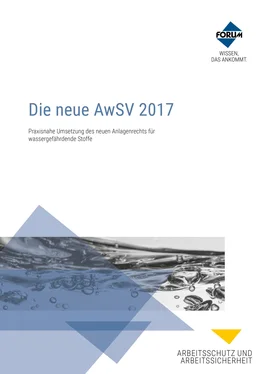
 1.2.5 Anlagenbegriff
1.2.5 Anlagenbegriff Hinweis
Hinweis