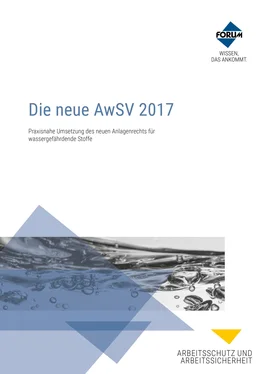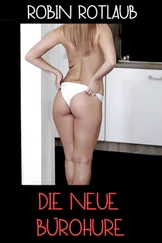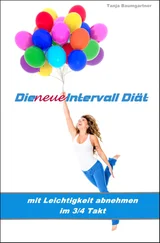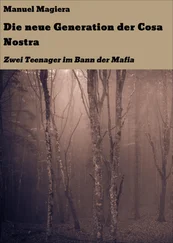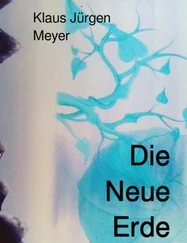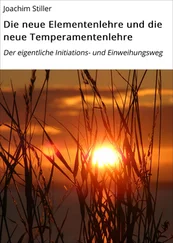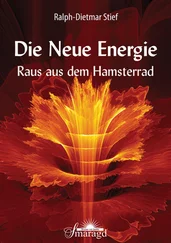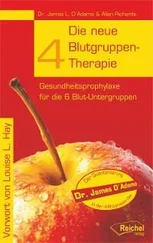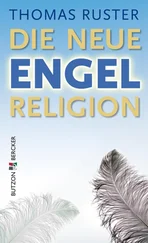Ein einheitliches Schutzniveau für jeglichen Umgang mit wassergefährdenden Stoffen konnte nicht realisiert werden. So besteht nach wie vor die Privilegierung nach § 62 Abs. 1 WHG für Anlagen zum Umschlagen wassergefährdender Stoffe und für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften (sog. JGS-Anlagen). In Bezug auf die JGS-Anlagen ist dies angesichts der Bedeutung der Schadensfälle bedauerlich.
Auch konnte keine Angleichung an das EU-weit und in allen anderen Umweltrechtsbereichen geltende Anforderungsniveau „Stand der Technik“ realisiert werden. Es bleibt bei dem bisherigen Anforderungsniveau „allgemein anerkannte Regeln der Technik“. Damit ist eine Chance zur Rechtsvereinheitlichung vertan worden. Es kommt sogar noch eine formaljuristische Einengung auf „nur“ allgemein anerkannte Regeln der Technik hinzu im Gegensatz zu der alten Regelung „mindestens“ allgemein anerkannte Regeln der Technik, womit das Abstufungskonzept seine Begründung hatte.
Kernpunkte der neuen Regelung sind
| • |
Festlegung des Geltungsbereichs, wo die AwSV und damit das Wasserrecht nicht anzuwenden ist (§§ 1,13 AwSV), |
| • |
Einstufung der wassergefährdenden Stoffe entsprechend ihrer Gefährlichkeit (§§ 3–12 AwSV), |
| • |
Anforderungen an die Rückhaltung von wassergefährdenden Stoffen im Schadensfall (§ 18 AwSV), |
| • |
Präzisierung sowie Erweiterung der Betreiberpflichten (§§ 43, 44, 46 AwSV), |
| • |
erstmalige, rechtsverbindliche Einführung der Technischen Regeln zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (TRwS) (§ 15 AwSV). |
Neu ist auch, dass
| • |
von den Regelungen der AwSV abgewichen werden kann, wenn auf der Grundlage einer Gefährdungsabschätzung auch andere technische oder organisatorische Sicherungsmaßnahmen zu einem gleichwertigen Sicherheitsniveau führen (§§ 21, 24 AwSV), |
| • |
im Schadensfall die ausgetretenen wassergefährdenden Stoffe nicht nur als Abfall schadlos und ordnungsgemäß zu entsorgen sind, sondern auch als Abwasser entsorgt werden können (§ 17 AwSV), |
| • |
Auffangräume, also alle Rückhalteinrichtungen, keine Abläufe haben dürfen (§ 18 AwSV), |
| • |
eindeutige Regelungen getroffen wurden, wo keine Rückhaltungseinrichtungen erforderlich sind (§§ 26–38 AwSV), |
| • |
der Aufstellungsort für Anlagen in Überschwemmungsgebieten denen von Wasserschutzgebieten gleichgestellt wurde (§ 1 AwSV). |
Die AwSV gilt für alle Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen (sog. LAU-Anlagen {LAU-Anlage}), für Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden solcher Stoffe (sog. HBV-Anlagen {HBV-Anlage}) sowie für Rohrleitungsanlagen, die das Werksgelände nicht überschreiten. Die beim anlagenbezogenen Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu treffenden Maßnahmen zum vorbeugenden Umweltschutz beziehen sich dabei grundsätzlich auf die drei Bereiche:
| • |
Klassifizierung der festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe nach ihrer Gefährlichkeit, |
| • |
technische Anforderungen für die Beschaffenheit und den Betrieb der Anlagen, |
| • |
organisatorische Anforderungen wie z. B. behördliche Vorkontrollen, Betreiberpflichten und qualitätsgesicherte Fachbetriebe. |
Die Grundsatzanforderungen gem. § 17 AwSV, die von allen Anlagen unabhängig von ihrer Größe und der Wassergefährdung der eingesetzten Stoffe einzuhalten sind, stellen das zentrale Element dar. Sie entsprechen weitgehend denen, die die Bundesländer seit Jahren umgesetzt hatten. Danach müssen alle Anlagen so geplant und errichtet, beschaffen sein und betrieben werden, dass wassergefährdende Stoffe während ihrer Betriebsdauer nicht austreten können, auftretende Undichtigkeiten schnell und zuverlässig erkannt werden sowie im Schadensfall anfallende Stoffe zurückgehalten und schadlos entsorgt werden.
Neu ist, dass auch an die Planung einer Anlage diese Anforderungen gestellt werden. Diese Betonung der qualifizierten Planung einer Anlage ist erforderlich, da sich herausgestellt hat, dass den Planern oft die einzuhaltenden Technischen Regeln nicht ausreichend bekannt sind, sodass es sowohl in Anzeige- als auch in Eignungsfeststellungsverfahren zu unnötigen Umplanungen oder Verzögerungen kommen kann.
Auch die Stilllegung einer Anlage wird neu geregelt. So sind die in der Anlage enthaltenen wassergefährdenden Stoffe zu entfernen, damit von der stillgelegten und i. d. R. nicht weiter überwachten Anlage keine Gewässergefährdung ausgehen kann. Zu entfernen sind möglicherweise enthaltene Leckanzeigeflüssigkeiten, soweit dies technisch möglich ist. Zusätzlich dazu sind Armaturen zu entfernen oder zu sichern, damit eine missbräuchliche Benutzung der Anlage auszuschließen ist. Ein Entfernen der Anlage ist jedoch nicht erforderlich. Nach einer ordnungsgemäßen Stilllegung stellen die ggf. verbleibenden Einrichtungen keine Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen mehr dar.
Die bereits vorhandene Regelung für unterirdische Behälter für flüssige wassergefährdende Stoffe bleibt erhalten. Sie dürfen nicht einwandig sein. Die Anlage muss danach dicht, standsicher und so ausgelegt sein, dass insbesondere diese Eigenschaften unter den zu erwartenden Betriebsbedingungen und während der Beanspruchungsdauer bei den dabei herrschenden physikalischen, thermischen und chemischen Einflüssen erhalten bleiben. Dies beinhaltet auch einen Schutz gegen mechanische Beschädigungen einschließlich derjenigen, die durch den Verkehr oder in Erdbebengebieten entstehen können.
Ein weiteres zentrales Element stellen die Rückhalteeinrichtungen {Rückhalteeinrichtungen} (2. Barriere) dar. Hier wird davon ausgegangen, dass die direkte, sichere Umschließung der wassergefährdenden Stoffe in seiner Anlage (1. Barriere) ein ureigenes Interesse des Betreibers ist und er dafür sorgt, dass die Anlage stets betriebsbereit ist. Die Anforderungen an die Rückhalteeinrichtungen sind dabei eindeutig definiert worden. Sie müssen flüssigkeitsundurchlässig sein und dürfen keine Abläufe haben (§ 18 Abs. 2 AwSV).
Auf zwei neue Aspekte der AwSV,die Gleichwertigkeit und die Beseitigung ausgetretener wassergefährdender Stoffe als Abwasser muss noch verwiesen werden.
Die Gleichwertigkeit {Gleichwertigkeit} richtet sich nach den Vorgaben des WHG zum Schutzniveau. Mit der Einführung des Prinzips der Gleichwertigkeit ergeben sich größere Gestaltungsspielräume für Betreiber und Planer. Der Nachweis der Gleichwertigkeit beruht auf einer Gefährdungsabschätzung und sollte auf einem belastbaren Gutachten eines AwSV-Sachverständigen aufbauen. Dieses ist insbesondere für bestehende Anlagen von Bedeutung (§ 68).
Während früher bei einer Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs, bei der wassergefährdende Stoffe ausgetreten waren, nur die Möglichkeit bestand, diese ordnungsgemäß als Abfall zu entsorgen, ist mit der AwSV die Alternative entstanden, die wassergefährdenden Stoffe als Abwasser zu beseitigen (§§ 17 und 19 AwSV).
In der neuen AwSV rücken die Betreiberpflichten verstärkt in den Fokus. So wurde u. a. neu in die AwSV die Verpflichtung für den Betreiber einer Anlage aufgenommen, dass er gem. § 14 AwSV „Bestimmung und Abgrenzung der Anlagen“ festzulegen und zu dokumentieren hat, welche Anlagenteile zu einer Anlage gehören und wo die Schnittstellen zu anderen Anlagen sind. Dies ist in der Verantwortung des Betreibers, da er das umfassendste Wissen über seine Anlagen hat. Hierzu gab es in der Vergangenheit bereits Anregungen sowie Definitionen in ein paar VAwS der Bundesländer (z. B. Sachsen) [5].
Читать дальше