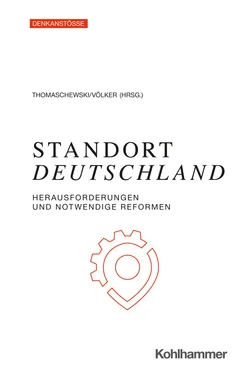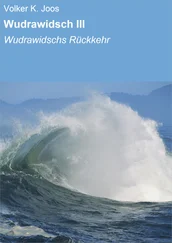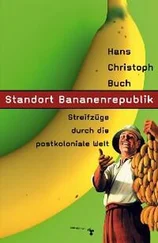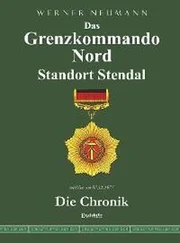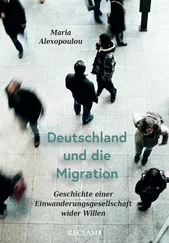Zusätzlich zum Regelungsrahmen für eine digitale Kapitalgesellschaft muss sichergestellt sein, dass die Zukunfts-GmbH auch in steuerlicher Hinsicht zukunftsfähig ist. Insbesondere »trockenes« Einkommen sollte vermieden werden – zu versteuerndes Einkommen, das noch gar nicht realisiert wurde, darf auch zu keiner Steuerschuld führen.
Darüber hinaus halten Gesellschafter ihre Anteile grundsätzlich in Holding-Gesellschaften. Der Vorteil ist, dass ein Erlös aus dem Verkauf von Anteilen dann nahezu steuerfrei ist – es greift weder die Körperschafts- noch die Einkommenssteuer. Erst wenn es zu einer Auszahlung an den Gesellschafter kommt, sind die Entnahmen steuerlich relevant, Erlöse können fast vollständig weiter investiert werden. Fehlt es dagegen an einer Holding, sind Erlöse mit bis zu 45 Prozent Einkommenssteuer belastet, sodass für andere Investitionen nur gut die Hälfte der Erlöse zur Verfügung steht.
Die Erfahrung zeigt ohnehin, dass größere Erträge durch Beteiligungen oft im Start-up-Ökosystem bleiben. Die Mitarbeiter von heute sind nicht selten die Gründer von morgen. Das nochmalige oder erstmalige Gründen sollte daher nach einem Exit auch steuerlich begünstigt werden. Der Betrag, der in eine neue operative Gesellschaft fließt, sollte steuerlich absetzbar sein. Damit würden Mitarbeiter gegenüber der allgegenwärtigen Holding-Konstruktion sogar begünstigt, während gleichzeitig frisches Kapital in Start-ups fließt.
1.8 Mitarbeiterbeteiligung gezielt fördern – auch über das eigene Unternehmen hinaus
Wenn die Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen erleichtert wird, entsteht allerdings ein ganz eigenes Risiko: Es wird alles auf die Karte eines einzigen Unternehmens gesetzt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die allermeisten Start-ups scheitern, bevor Mitarbeiterbeteiligungen werthaltig werden. Allein dieser Aspekt kann viele Menschen davon abhalten, im Start-up-Sektor zu arbeiten. Könnte man das Risiko des Totalverlusts minimieren und stattdessen die überproportionale Verdienstaussicht erhalten, würde das Start-up-Ökosystem in Deutschland insgesamt einen enormen Schub bei der Einstellung von exzellentem Personal verzeichnen. Deshalb plädieren wir für die Einrichtung eines Mitarbeiterbeteiligungsfonds.
Dieser von der öffentlichen Hand geförderte Fonds kann Anteile an allen Unternehmen erwerben, die ihre Mitarbeiter am Unternehmenskapital beteiligen. Das soll folgendermaßen funktionieren: Wenn Start-ups normale Mitarbeiterbeteiligungen in Höhe von 5 Prozent ausgeben und dann weitere 5 Prozent in den Fonds einzahlen, sichern sie sich zwei Gegenleistungen: Erstens erhalten sie aus dem Fonds einen entsprechenden Beitrag als Kapitalerhöhung, und zweitens werden entsprechende Fondsanteile auf die Mitarbeiter übertragen. Kommt es bei einem der Unternehmen, an denen der Fonds beteiligt ist, zu einem Exit, können die Mitarbeiter einerseits direkt am Erfolg partizipieren – über die Anteile, die sie persönlich halten. Andererseits partizipieren sie auch indirekt – über die Beteiligung des Fonds, genau wie auch dessen andere Teilhaber. Eine solche indirekte Erfolgsbeteiligung erhalten sie aber auch, wenn es bei einem anderen Unternehmen, an dem der Fonds Anteile hält, zu einem Exit kommt. Dadurch wird eine effektive Diversifizierung des Risikos erreicht, das mit der Kapitalbeteiligung einhergeht; die Attraktivität von Start-ups als Arbeitgeber erhöht sich.
Die Attraktivität des Fonds kann zudem dadurch gefördert werden, dass die Start-ups, die eine bestimmte Anzahl von Anteilen in den Fonds einbringen, einen dem Wert der Anteile entsprechenden Betrag erhalten. Die Bewertung der Anteile sollte sich dabei am Nominalwert bzw. am Wert der letzten Finanzierungsrunde bemessen. Beispiel: Werden 5 Prozent des Stammkapitals an Mitarbeiter zu einer Bewertung von 10 Mio. Euro ausgegeben, dann erwirbt auch der Fonds für 500.000 Euro im Wege der Kapitalerhöhung 5 Prozent Anteile an dem Start-up. Gleichzeitig erhalten die Mitarbeiter des Start-ups kostenlos Anteile an dem Fonds und dadurch eine Beteiligung an allen Unternehmen, in die der Fonds eingestiegen ist.
Jede Gründerzeit basiert auf neuen Geschäftsideen. Davon gibt es heute mehr denn je, aber nicht so sehr bei uns. Wo sie wachsen können, hängt sehr vom Klima ab – von Mitarbeitern, Kapital und Rechtssicherheit. Für das unmittelbare Ökosystem der jungen Unternehmen haben wir unsere Vorschläge gemacht. Sie allein genügen allerdings noch nicht, wir müssen größer denken: in der Regulierung, bei den Talenten und in der Finanzierung. Wenn Sie mehr erfahren wollen, lesen Sie in Neustaat nach.
Nadine Schön ist seit 2009 direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis 298 im Saarland. Seit 2014 gehört sie dem geschäftsführenden Vorstand der CDU/ CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag an. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist sie für die Themenfelder Digitale Agenda sowie Familie, Senioren, Frauen und Jugend verantwortlich.
Acatech, 2019: Innovationskraft in Deutschland verbessern: Ökosystem für Wachstumsfinanzierung stärken, abrufbar unter: https://www.acatech.de/publikation/innovationskraft-in-deutschland-verbessern/(Abruf am 27.12.20)
Bitkom, 2019: Schwierige Finanzierung: Jedes vierte Startup denkt über Umzug ins Ausland nach, abrufbar unter: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Schwierige-Finanzierung-Jedes-vierte-Startup-denkt-ueber-Umzug-ins-Ausland-nach(Abruf am 27.12.20)
Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2020: Bildung und Forschung in Zahlen 2019, abrufbar unter: https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Bildung_und_Forschung_in_Zahlen_2019.pdf(Abruf am 27.12.20)
BVK, Roland Berger, Internet Economy Foundation, 2018: Treibstoff Venture Capital – Wie wir Innovation und Wachstum befeuern. Abrufbar unter: https://www.bvkap.de/sites/default/files/news/vc_studie_von_ief_bvk_roland_berger_treibstoff_venture_capital.pdf(Abruf am 27.12.20)
Ernest & Young, 2020: EY French Venture Capital Barometer, abrufbar unter: https://www.ey.com/fr/fr/services/strategic-growth-markets/ey-french-venture-capital-barometer-annual-results-2019(Abruf am 27.12.20)
Heilmann, Thomas / Schön, Nadine: Neustaat. Politik und Staat müssen sich ändern, Münchener Verlagsgruppe, 2020.
Netzökonom, 2018: Wert der Plattform-Ökonomie steigt im ersten Halbjahr um 1 Billion Dollar, abrufbar unter: https://www.netzoekonom.de/2018/06/24/wert-der-plattform-oekonomie-steigt-im-ersten-halbjahr-um-1-billion-dollar/(Abruf am 27.12.20)
OECD, 2019: Pension Marcets in Focus, abrufbar unter: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2019.pdf(Abruf am 27.12.20)
Tagesspiegel, 2019: Rekordinvestitionen in deutsche Start-ups, abrufbar unter: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/start-up-barometer-2018-rekordinvestitionen-in-deutsche-start-ups/23849192.html(Abruf am 27.12.20)
2 Die Corona-Krise und ihre Folgen: Herausforderungen für deutsche Unternehmen
Dago Diedrich

Zuallererst ist Covid-19 (»Corona«) eine humanitäre Herausforderung. Es gilt, unter größtem Zeitdruck Menschenleben zu retten, weltweit medizinisches Wissen in der Impfstoffforschung zu generieren und zu teilen. Darüber hinaus beschleunigt dieser globale Virus in nie gekannter Geschwindigkeit Innovationen und die Weiterentwicklung von Unternehmen. Fundamentale Restrukturierungen werden um Jahre vorgezogen. Nicht nur bei Themen wie Mitarbeitersicherheit oder Lieferketten. Corona beschleunigt auch vorhandene Trends wie Elektromobilität, Nachhaltigkeit, Homeoffice oder lebenslanges Lernen. Branchen wie Telemedizin, Home Delivery und alles rund um Digitalisierung boomen.
Читать дальше