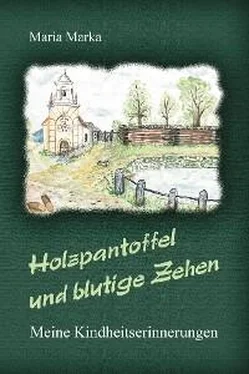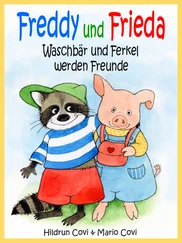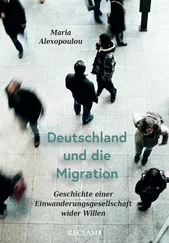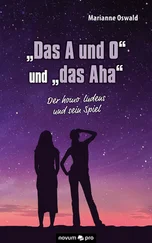Der „alte Deitsch“, mein Urgroßvater, hatte zwei Söhne und eine Tochter. Der älteste bekam den Hof, mein Großvater Anton Gebert wurde ausgezahlt und baute die „Schmiede“ aus. Die Tochter heiratete einen Eisenbahner und zog in die Stadt. Sie war meine Firmpatin und schenkte mir ein vergoldetes Halskettchen mit Kreuz, das ich leider verlor. Ich hatte auf eine Armbanduhr gehofft, aber so viel Geld hatte sie wahrscheinlich nicht. Armbanduhren waren 1934 noch recht teuer. Ich habe diese Großtante selten gesehen. Meine Erinnerung beschränkt sich darauf, dass sie kinderlos blieb und ständig an Kopfweh litt. Deswegen trug sie oft zwei Kopftücher übereinander. Wind vertrug sie gar nicht. Ich vermute, diese Empfindlichkeit gegen Wind und Kälte habe ich von ihr geerbt. Einige Zeit ungeschützt dem kalten Wind ausgesetzt und das ganz Gesicht tut mir weh. Die Großtante wurde als einzige unserer Familie 1945 nicht ausgesiedelt, weil sie als Eisenbahnerwitwe vom Staat eine Rente bekam. Eisenbahner konnte nach 1918 (Gründung der Tschechei) nur werden, wer für die Tschechen optierte. Das hatte ihr Mann wohl getan. Sie starb in der Altenpflegeanstalt in Wiesengrund (Dobrzan) als wir schon längst in Bayern lebten.

Die Schmied heute, Aufnahme: Karl Marka

Swina – Dorfplatz mit Kapelle 1937- Václav Baxa et. Al. 2004

Kirche in Swina heute, Aufnahme: Karl Marka
Der zweite Sohn vom „alten Deitsch“ mit Namen Anton Gebert, das ist mein Großvater. Der wohnte also mit meiner Großmutter und den sechs Kindern in der „Schmiede“ mitten am Dorfplatz, nur durch eine Straße vom Dorfteich getrennt. Genau gegenüber stand der „Deitschnhof“ am runden Dorfplatz. Über den Dorfteich hinweg hatten sich also immer alle im Auge, die ganze Verwandtschaft.
Das mit der Schmiede muss erklärt werden. Großvater Anton war ja Zimmermann, nicht Schmied. Als die Schmiede abgebrannt war und der alte Schmied wegging, kaufte mein Großvater mit dem eingebrachten Heiratsgut meiner Großmutter die Brandstätte und baute sie zu Wohnhaus, Stall und Scheune um. Es gab nur eine große Wohnküche und eine noch etwas größere „gute Stube“, die auch als Schlafstube diente. Auch auf dem Boden darüber standen Betten, neben den Getreideschütten, dem Mehlkasten und – über den Stall hin gelagert, ein Teil des Winterheus. Für einen regelrechten Bauernhof war nicht genügend Platz. So wurde ein leer stehendes, strohgedecktes Häuschen mit Höfchen hinter der Dorfkapelle dazu gekauft. Um in dieses „Watzka“-Häusl, Watzka war der frühere Besitzer des Hauses, zu gelangen, musste man schräg über die Dorfstraße gehen. Dort lagerten Brennholz und Geräte, da waren der Schweinestall und das Holzhäuschen mit Herz in der Tür für die Familie, deren Mitglieder mit ihrem Bedürfnis quer über die Dorfstraße und an der Kapelle vorbeilaufen mussten.
Zumindest bei Tage. Für die Nacht stand ein zugedeckter Kübel im Vorhaus, denn die Nachtwanderungen wären, vor allem zur Winterszeit, gesundheitsgefährdend gewesen. Das halbe Dorf bekam also mit, wenn es einem der „Schmieds“ pressierte. Und er lief umso schneller, je dringender es war. Es lief ständig jemand; immerhin bewohnten die Schmiede acht Leute, mit mir neun. Der Name Schmied hielt sich zäh, obwohl wir alle Gebert hießen. Und so war mein Vater, der Älteste der Kinder, der Schmied-Franz und ich, seine Tochter, das Schmied-Marerl. Als Onkel und Tanten gab’s den Schmied-Beb, den Schmied-Ernst, die Schmied-Mare (meine Taufpatin), die Schmied-Anna und die Schmied-Emmi (nur sieben Jahre älter als ich).
In der Enge der Schmiede hatte die junge Gebert-Familie nicht Platz. Das Wohnhaus am Deitschnhof war größer. Wir bezogen eine Stube und eine Kammer im 1. Stock. Ich glaube, wir wohnten dort etwa drei Jahre. Ich nannte meinen Großonkel Deitschn-Vetter, das taten alle im Dorf und seine Frau war die Deitschn-Teta. Vier Söhne waren da. Der Jüngste hieß Wenzel und mit dem wuchs ich auf. Er war der Cousin meines Vaters, aber im selben Jahr 1924 geboren wie ich. Nur kam er schon im Januar und ich erst im Dezember zur Welt. So war er mir körperlich ein Jahr voraus. Ich war noch Kleinkind und habe fast gar keine Erinnerung an diese drei Jahre.
Als ich zweieinhalb Jahre war, wurde mir ein Bruder geboren. Man erzählte mir, dass ich verstört unter dem Tisch saß als die Hebamme kam. Irgendwie sehe ich noch heute im Unterbewusstsein bei ihrem Eintritt die Stubentüre aufgehen. Der kleine Franz lebte nur zwölf Stunden. Woran er starb, konnte auch die Hebamme nicht sagen. Dass mein Vater, damals gerade vierundzwanzig Jahre alt, den kleinen Sarg über den Kauerberg und durch das Miesatal auf seinen Armen bis zum Petruskirchlein trug, das sind gute 8 km, wurde mir von Mama später erzählt. Ich war immer dabei, wenn sie an Allerseelen das kleine Grab schmückte. Meistens hatte sie Girlanden aus Preiselbeerkraut geflochten und diese mit selbstgefertigten Papierblumen verziert. Dabei lernte ich Papierrosen aus Krepppapier zu machen. Das kann ich noch immer. Auch das Wissen, dass man aus Binsenmark weiße Schleifchen dazu herstellen kann, stammt noch aus dieser Zeit.
Mama half meistens auf dem Deitschn- oder Schmiedhof in der Landwirtschaft und wurde mit Milch und Brot entlohnt. Wir aßen je nach Umstand einmal bei der Großmutter (meistens) und einmal bei der Deitschn-Teta.
Vater arbeitete als Zimmermann ständig irgendwo auswärts – in Eger, Asch oder gar drüben „im Reich“, zum Beispiel in Plauen oder Suhl. Im Sommer kam er gar nur alle vier Wochen für einen Sonntag heim. Dann kroch ich am Samstagabend zu ihm ins Bett – er roch so schön nach Vater. Aber wenn er die Zudecke über den Kopf zog und von da drinnen her brummte wie ein Bär: „Kumm mit in ma Höhl“, bekam ich Angst und rief nach der Mama. Das weiß ich noch aus eigener Erinnerung. Auch, dass ich in der Vorweihnachtszeit in der Stube vor dem Wandkreuz betete und plötzlich eine Walnuss heruntergefallen kam.
An den dunklen Winterabenden wurden im Dorf reihum auf allen Höfen Federn geschlissen. Schöne, weiße, saubere Federn, erste Qualität. Denn den Gänsen stand der Dorfteich zum täglichen Bad zur Verfügung und sie nutzten ihn weidlich. Jeweils eine Woche lang kamen befreundete Frauen im gleichen Haus am Abend zusammen um die Federn dieses Hofes zu schleißen – von den Kielen zu befreien, die sich sonst durch’s Inlett bohren würden. War die letzte Feder geschlissen, gab es für alle Helferinnen einen Gugelhupf und Kaffee. Man nannte diesen Abend „Federball“ (ohne Tanz!). Mama half überall wo gerade Federzeit war und ich durfte mit. Sie konnte mich ja schwerlich allein zu Hause lassen. Entweder unterhielt ich die Frauen mit meiner Plauderei oder ich schlief auf einer Bank in der Ecke. Die Frauen saßen bei Petroleumlicht um einen großen Tisch in der warmen Stube. Jede fasste sich Federn aus einem Häufchen vor sich auf dem Tisch. Die vom Kiel geschlissenen Federn wurden zu leichtestem Flaum und die so entstandenen Daunen steckte man in der Tischmitte unter einen beschwerenden Teller. Im Laufe des Abends wurde der Berg unterm Teller immer größer. Da hinein niesen durfte keine, auch nicht hemmungslos lachen, denn dann wäre der Flaum in alle Richtungen davon geflogen.
Читать дальше