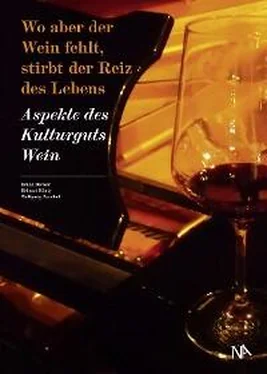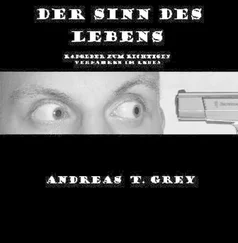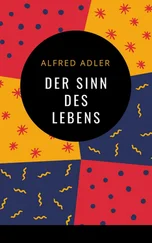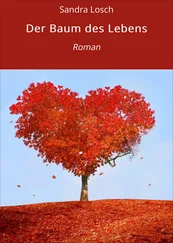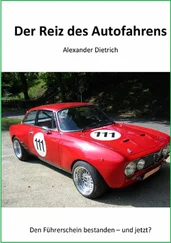Auch der Wissenschaftshistoriker und Altorientalist Peter Damerow (2012) leistet der »Bier-vor-Brot«-Hypothese in seinen posthum veröffentlichten Untersuchungen zu frühen Brautechniken des sumerischen Biers Vorschub. Diese stehen für ihn in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Errungenschaften der Neolithischen Revolution, d. h. den Ursprüngen von Landwirtschaft, urbaner Wirtschaft, Verwaltungs- und Handelsstrukturen, religiösem Leben sowie überhaupt aller zivilisatorischer Errungenschaften wie früher Formen der Schrift. In den sumerischen Quellen finden sich Hinweise, dass außer Gerste für die Initialisierung des Fermentationsprozesses Honig und Wein eingesetzt wurden. Eine ähnliche Zusammensetzung von »Wein-Bier-Cocktails« aus Weintrauben, Gerste und Honig mit Zusätzen von Baumharz und Kräutern fand sich im gleichen Zeitalter nicht nur in den ägyptischen, anatolischen, minoischen und mykenischen Kulturen (später ebenfalls im homerischen Trank kykeon ), sondern auch in China, nämlich in Liangchengzhen in der Ostprovinz Shandong, einem wichtigen Ausgrabungsort der neolithischen Longshan-Kultur aus dem 3. Jt. v. Chr. Die Analysen von Spuren in dort entdeckten Keramikgefäßen weisen auf eine Mischung von Reis, Gerste, Honig, wilden Weintrauben, Baumharz und Kräuterzusätzen hin. Dass auch hier nachweislich die Hefegärung von Weintrauben genutzt wurde, lässt zweierlei Schlüsse zu: Einerseits wurde dieses Verfahren in den dazwischen liegenden vier Jahrtausenden seit dem »Jiahu-Cocktail« kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert. Andererseits spielte die Rezeptur des »Liangchengzhen-Cocktails« auch ab dem 2. Jt. v. Chr. mit dem Beginn der dynastischen Epochen seit der Xia- und Shang-Periode (21. – 11. Jh. v. Chr.) und eventuell noch bis in die Zhou-Dynastie (11. – 3. Jh. v. Chr.) eine, wenn auch zugunsten einer differenzierteren und ausgereifteren Fermentationstechnologie auf der Basis einer aufblühenden Getreidewirtschaft, abnehmende Rolle. Mit dem Blick auf diese ähnlichen Rezepturen von »Bier-Wein-Cocktails« in Mesopotamien, Ägypten, Anatolien, Griechenland und China und entlang der damals schon funktionierenden eurasischen Handelswege spricht also vieles dafür, dass die Weintraubengärung kulturübergreifend als die »Initialzündung« für spätere komplexere und sich regional zunehmend diversifizierende Fermentationsverfahren gelten kann.

Unter diesen und den zuvor erwähnten Aspekten der weiten Verbreitung der eurasischen Weinrebe über nahezu alle frühen Kulturräume zwischen Europa und Ostasien sowie aus der Paläolithischen Hypothese erschließt sich folgerichtig die »Wein-vor-Bier«-Hypothese, womit eingeräumt wird, dass der Traubenwein am Anfang aller Braukunst steht und das älteste Kulturgetränk der Menschheit per se darstellt.
Aus den bislang vorliegenden Argumenten und Indizien ergibt sich die Inspirationshypothese, die besagt, dass die Nutzbarmachung der Fermentation die anderen zivilisatorischen Errungenschaften direkt oder indirekt förderte, wozu die sich verbessernden materiellen Lebensbedingungen gehören, v.a. auch die Manufaktur von Keramik, Haushalts-, Jagd- und Ackergeräten, Waffen, Kleidung und Schmuck. Hinzu kommt, dass die allmählich verfeinerte Herstellung und der nach und nach ritualisierte wie gesellschaftlich konventionalisierte Genuss von geistigen Getränken, wie wir ihn bis heute v.a. in der georgischen ebenso wie in der chinesischen Kultur, also an beiden Enden der Seidenstraße, immer noch beobachten können, maßgebliche Wirkung auf schöpferische Leistungen in allen Bereichen des kulturellen Aufblühens zeigte. Diese Hypothese erklärt, wie sich unter dem Impetus des Weins und alkoholischer Getränke von magischen Riten bis hin zur Wissenschaft alle Faktoren des Entstehens von Kultur entwickelt haben.
Alkohol als Kulturträger
McGovern et al. (2000; 2003; 2009) und Reichholf/Josef (2008) führen in stichhaltiger Weise aus, dass wahrscheinlich keine Kultur ohne die Nutzung von Drogen entstanden ist und dass darunter wiederum Alkohol nicht nur die älteste, sondern auch die am weitesten verbreitete Droge der Menschheit ist. Wie kein anderes Rauschmittel ist Ethanol überall in der Natur vorhanden und leicht verfügbar, in geringen Mengen sogar permanent im Blut enthalten und damit kein körperfremder Stoff. Für die Versorgung gewährt es die oben genannten evolutionären Vorteile und hat zudem sozial-kommunikative, bewusstseinserweiternde und kreativitätsfördernde Funktionen. Aus den bisherigen Erkenntnissen ergibt sich also in letzter Konsequenz, dass die Droge Alkohol – vorwiegend in der ästhetischen und symbolträchtigen Manifestation des vergorenen Rebensaftes – untrennbar mit der Entstehung von Kultur verknüpft ist. Nicht zufällig spielt der Wein in der ältesten monotheistischen Weltreligion, dem indo-iranischen Zoroastrismus, sowie im Judentum und Christentum mit den beiden ältesten christlichen Staaten der Welt, Georgien und Armenien – kontinuierlich bis heute die traditionsreichsten und bedeutendsten Weinregionen –, eine dominante Rolle. Bei genauerer Betrachtung war und ist der Genuss von Wein und Alkoholischem auch im Buddhismus und Islam verwurzelt (vgl. dazu den Beitrag in diesem Band S. 99-100). Die chinesische Mythologie und Literatur, Konfuzianismus und Daoismus sind ohnehin von der komplexesten und höchstentwickelten Alkoholkultur der Menschheit geprägt und in allen Lebensbereichen vom inspirativen Elixier geradezu durchtränkt. Die enge Korrelation von Zivilisation und Weinkultur thematisiert und begründet Patrick McGovern ausführlich und in eindrucksvoller Weise in seinen beiden Büchern zur Wein- und Alkoholgeschichte.
Welch dominante Rolle Alkoholisches in Chinas Gesellschaft seit den Anfängen spielte, spiegelt v.a. auch die Literatur in allen Epochen wider. Bereits die ersten Überlieferungen und schriftlichen Zeugnisse machen deutlich, dass die Kunst der Fermentation und ihre hochkomplexe, weltweit einzigartige Technologie sowie der rituelle Alkoholgenuss eine dominante Rolle in Chinas religiösem, höfischem, literarisch-künstlerischem und alltäglichem Leben einnahmen.
Im chinesischen Schriftsystem selbst verraten Hunderte zusammengesetzte Schriftzeichen mit der graphemischen Komponente für »Alkohol«, einem ursprünglichen Piktogramm einer Tonamphore, dass Alkohol bereits bei der Entstehung der Schrift und ihrer anfänglichen Verwendung für Orakelzwecke eine zentrale Bedeutung hatte. Dieses chinesische Graphem ist übrigens dem sumerischen Symbol verblüffend ähnlich.
Bis in die Gegenwart ist in China keines der zahlreichen Feste, keine Tempel- oder Gedenkzeremonie, kein Staatsbankett, kein offizieller oder privater Gästeempfang vorstellbar ohne den Ausschank alkoholischer Getränke, meist beim üppigen Mahl und mit den uralten Trinkritualen. Aus den Anfängen der konfuzianischen Welt- und Gesellschaftsordnung stammen die heute noch gern zitierten Sprichwörter »Keine Feierlichkeit ohne Alkohol«. ( wu jiu bu cheng li ) und »Feste sind erst vollkommen mit Alkohol«. ( li yi jiu cheng ).
Literatur
P. Damerow, Sumerian Beer: The Origins of Brewing Technology in Ancient Mesopotamia, in: Cuneiform Digital Library Journal, 2012, S. 2, www.cdlj.ucla.edu/pubs/cdlj/2012/cdlj2012_002.html.
B. G. Fragner / R. Kauz / F. Schwarz (Hrsg.), Wine Culture in Iran and Beyond, Wien 2014 (= Veröffentlichungen zur Iranistik 75).
S. H. Katz / M. M. Voigt, Bread and Beer: The Early Use of Cereals in the Human Diet, in: Expedition 28, No. 2, Summer 1986, S. 23–34.
P. Kupfer (Hrsg.), Wine in Chinese Culture – Historical, Literary, Social and Global Perspectives, Berlin 2010 (= Wissenschaftsforum Kulinaristik 2).
Читать дальше