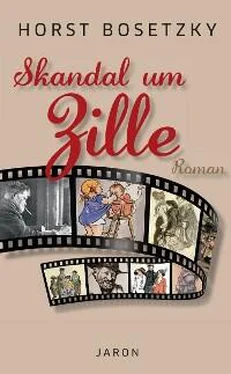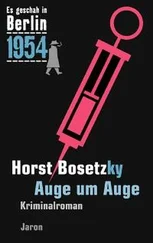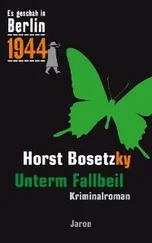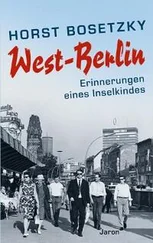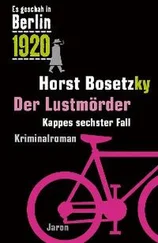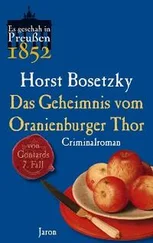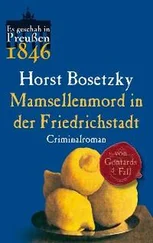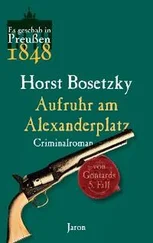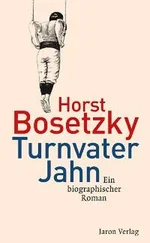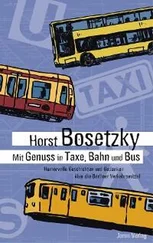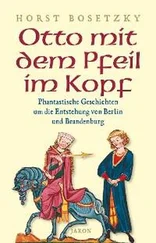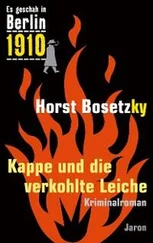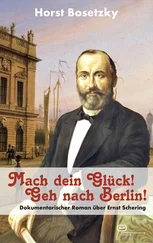Kurz vor der Wittstocker Straße stutzte er. Der ältere Herr, der da stand, das war doch … Heinrich Zille! Er hielt einen großen Skizzenblock in der Hand und zeichnete das Eckhaus. Eine Meute von Kindern aller Altersklassen umringte ihn. In der zweiten und dritten Reihe hatten sich etliche Erwachsene eingefunden.
»Pinselheinrich is hier und malt dit Haus, in dem ick wohne!«, rief eine Zehnjährige.
Banofsky, von Natur aus neugierig, kam näher heran. »Was führt Sie denn hierher, Herr Professor?«
»Jetzt, da ich siebzig jewor’n bin, kehre ick noch mal an die Stätten zurück, wo ick wat alebt habe. Hier ham se mir beim Kohlenarbeitastreik fast jetötet. 1910 war det, da hab ich um een Haar ’n Blumentopp uff’n Kopp jekricht.«
Banofsky nickte und ging weiter. Als er sich noch einmal umdrehte, sah er, dass Zille bei den Erwachsenen eine Sammelbüchse herumgehen ließ. »Für die Armen, die ick untastütze!«
Banofsky kam das seltsam vor. Noch nie hatte er gehört, dass Zille selber sammelte. Johannes Banofsky war Schauspieler und Schriftsteller, weshalb er sich gut in andere Menschen hineinversetzen konnte – und in diesem Moment sagte ihm sein Instinkt, dass hier nicht der echte Pinselheinrich am Werk war. Der Mann trat offensichtlich als Zille auf, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Aber Banofsky war ein viel zu gutmütiger Mensch, um die Polizei zu rufen. Außerdem wartete Tucholsky auf ihn.
Der begrüßte ihn freundschaftlich und erzählte ihm sogleich von seinem Reisebericht Ein Pyrenäenbuch und dem geplanten Sammelband Mit 5 PS . Auch hatte er eine neue Frau kennengelernt, Lisa Matthias, und wollte sich von Mary trennen.
»Irgendwann gehe ich sowieso nach Schweden«, erklärte Tucholsky.
»Sie wollen Deutschland sich selbst überlassen?«, rief Banofsky.
»Richtig zu resignieren ist eine hohe Kunst. Ach … Die Bürokratie in Deutschland ermüdet mich. Es sitzen noch immer diejenigen an den Schalthebeln, die dem Kaiserreich nachtrauern und der Weimarer Republik den Garaus machen möchten. Für mich gibt es nur eine Lösung: Umwälzung, Generalreinigung, Aufräumung, Lüftung! Die deutsche Revolution steht noch aus. Was habe ich vor kurzem den Obdachlosen zugerufen? Wohltaten, Mensch, sind nichts als Dampf. / Hol dir dein Recht im Klassenkampf!”
Sie diskutierten eine Weile darüber, ob die K PD, der sich Tucholsky immer mehr annäherte, in Deutschland jemals an die Macht kommen konnte und ob Tucholsky, wenn er wirklich nach Schweden emigrierte, so etwas wie Fahnenflucht beging. Dann kamen sie auf Banofskys Probleme zu sprechen.
»Ich bin der Prototyp der freischwebenden Intelligenz, ich irrlichtere nur so umher, und vor kurzem ist mir der Gedanke gekommen, ein Drehbuch zu schreiben. Der Tonfilm scheint gerade den Stummfilm abzulösen, wie man an The Jazz Singer von Warner Brothers sehen kann. Thea von Harbou, die ich flüchtig kenne, hat mir den Rat gegeben, nach einem Roman zu suchen, der sich zu einem Drehbuch umschreiben lässt. Ich dachte mir, am besten befrage ich Sie dazu. Das Thema sollte etwas mit Berlin zu tun haben, weil ich mich nur hier richtig gut auskenne.«
Tucholsky überlegte. »Was haben wir an Berlin-Romanen … Zuerst fallen mir Lemkes sel. Witwe von Erdmann Graeser und Die Familie Buchholz von Julius Stinde ein.«
Banofsky winkte ab. »Das ist mir alles zu idyllisch.«
»Und wie wäre es mit Georg Hermanns Jettchen Gebert ?«
»Vom Judentum verstehe ich zu wenig.«
»Man erzählt sich, dass Erich Kästner, Gabriele Tergit und Alfred Döblin an großen Berlin-Romanen sitzen, aber wer weiß, wann die fertig sind …« Tucholsky dachte weiter nach. »Muss die Vorlage für ihr Drehbuch unbedingt ein Roman sein? Warum denken Sie sich nicht selber etwas aus?«
»Mir fehlt die nötige Phantasie dazu«, musste sich Banofsky eingestehen »vielleicht auch nur die Geduld. Am liebsten wäre mir eine Biographie, die Geschichte einer großen Frau oder eines großen Mannes.«
»Ich scheide da aus!«, rief Tucholsky mit der nötigen Portion Selbstironie. »Aber nehmen Sie doch einen Freund von mir, dem ich gerade zu seinem siebzigsten Geburtstag geschrieben habe, er sei Berlins Bester: Heinrich Zille.«
Hinter ihm wurden die eisernen Tore zugeknallt. Es klang wie der Schuss aus einem Mörser. Unwillkürlich duckte sich Gustav Budenstieg. Aber warum sollten sie ihn erschießen? Diesmal hatten sie ihn wegen guter Führung sogar zwei Wochen früher entlassen. Budenstieg blieb noch einmal stehen. Sein Blick ging zurück. Der Backsteinklotz des Strafgefängnisses Tegel ragte in den grauen Winterhimmel. Er war ihm zur eigentlichen Heimat geworden. Im Haus III hatte er schon achtmal seine mehr oder minder lange Strafe abgesessen. Eigentlich hätte man für ihn an der Pforte eine Drehtür statt der eisernen Tore anbringen müssen. Eine Weile hatte er die Zelle mit Wilhelm Voigt geteilt, dem sogenannten Hauptmann von Köpenick. Der war am 16. August 1908 vorzeitig entlassen worden, Kaiser Wilhelm II. hatte ihn begnadigt. Des Öfteren träumte Budenstieg von einem solchen Coup wie der »Köpenickiade«, die ein großes Echo hervorgerufen hatte. Er dachte nach. Weswegen hatte er bisher eingesessen? Wegen Leistungserschleichung, Sachbeschädigung, Raub und Diebstahl, Landfriedensbruch sowie schwerer Körperverletzung. Nicht viele hatten eine solch lange Liste von Vorstrafen aufzuweisen. Seine Freunde wurden langsam neidisch. Aber etwas richtig Großes fehlte ihm noch. Nun, der Richter hatte ihm zuletzt Hoffnungen gemacht: »Wenn Sie sich weiter so entwickeln, Budenstieg, dann können wir Sie hier bald als Mörder oder wenigstens als Totschläger begrüßen.«
Budenstieg drehte sich noch einmal um. »Auf Wiedersehen!« Mit ein paar Schritten war er an der Seidelstraße angekommen. Aus Richtung Tegel näherte sich ein Straßenbahnzug. Er überlegte. Mit der Linie 25 kam er schnell in die Innenstadt. Aber die Fahrt war teuer! Ein paar Mark hatten sie ihm mit auf den Weg gegeben, aber die brauchte er nicht gleich der Verkehrsgesellschaft in den Rachen zu werfen. Was änderte das an deren Verlusten, wenn er für seine Fahrt keinen Pfennig bezahlte? Nichts! Er konnte also mit ruhigem Gewissen schwarzfahren. Die Bahn hielt. Budenstieg musterte die Schaffner. Wer sah dümmer aus, wer gutmütiger? Der im Trieb oder der im Beiwagen? Budenstieg entschied sich für den Anhänger. Da der Schaffner auf dessen vorderem Perron abklingelte, enterte er den hinteren. Der Wagen war ziemlich voll, und er konnte hoffen, bis zur Afrikanischen Straße nicht kontrolliert zu werden.
Es war ein merkwürdiges Gefühl, wieder einmal in einer Straßenbahn durch Berlin zu gondeln. An jeder Haltestelle stand es ihm frei, einfach auszusteigen – ohne einen Vormelder an die Anstaltsleitung zu schicken. Andererseits hatte er keinen festen Schlafplatz mehr, und niemand schob ihm morgens, mittags und abends einen Napf mit etwas Essbarem durch die Luke. Auch wenn die Mahlzeiten meistens nur als Fraß zu bezeichnen waren.
»Noch jemand ohne Fahrschein?«
Der Schaffner war in seinem Abteil angekommen. Budenstieg schwang sich hinunter aufs Trittbrett, um während der Fahrt abzuspringen. Das war riskant. Man konnte unter einen Lastwagen geraten. Aber die Straße war frei.
»Heh, Sie da!«, schrie der Schaffner. »Hierjeblieben, sonst …« Budenstieg hatte Glück. Am Ende der Scharnweberstraße hatte der Mann vorn an der Kurbel ein wenig Fahrt wegnehmen müssen. Er sprang. Es kam darauf an, beim Laufen in etwa so schnell zu sein wie die Straßenbahn. Budenstieg schaffte es und geriet nicht ins Straucheln. Und das, obwohl er anderthalb Jahre nicht richtig gerannt war und sich immer nur mit den Spaziergängen auf dem Gefängnishof hatte begnügen müssen. Budenstieg war stolz auf sich. Autos hupten hinter ihm. Er drehte sich um und drohte mit der Faust. »Willste was auf die Schnauze, du Arschloch?«
Читать дальше