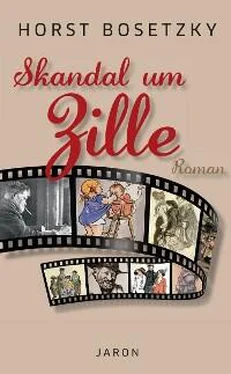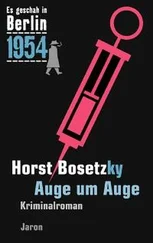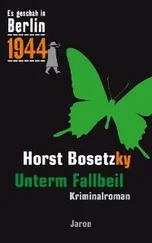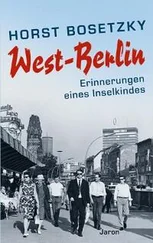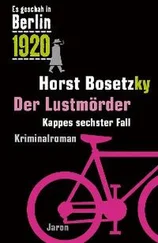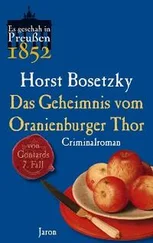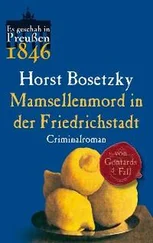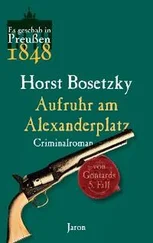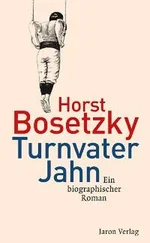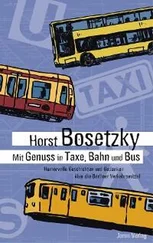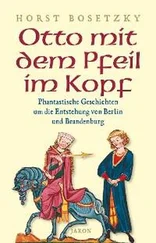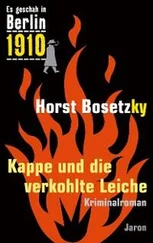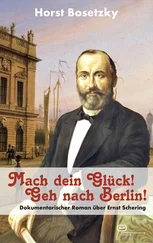»Ja, aba nich raus bis nach Stahnsdorf uff’n neuen Friedhof, det is zu weit.«
»Dann übaleje ick mir det mit dem Sterben doch noch mal«, erklärte Zille. »Wat jibt et sonst Neuet?«
»Nüscht Jutet.« Max Liebermann berichtete von der schweren Gasexplosion im Mietshaus Landsberger Allee Nr. 115 / 116, bei der 17 Menschen verletzt und 90 obdachlos geworden waren.
»Und ’n paar Familien haben ihre janze Habe valor’n.«
»Bei Jas is mir nie janz wohl.« Zille schüttelte sich. »Eena will sich umbringen und dreht ’n Jashahn uff, der andere is zu tütelich und macht’n nicht zu, wenn a jekocht hat, der Dritte lässt de Kartoffeln übakochen, so det die Flamme ausjeht.«
»Zurück zum Lagerfeuer!«, forderte Max Liebermann. »Auf allen zentralen Plätzen in Berlin unterhält der Magistrat offne Feuer, und jeder kommt mit seim Fleisch hin, um et da am Spieß braten zu lassen.«
»Feuer frei!«, rief Zille.
»Nich Feuer frei, sondern Hermann Frey! Ich muss doch sehr bitten.«
Max Liebermann tat so, als sei er entsetzt. »Meine Herren, wo bleibt das Niveau?«
Hermann Frey begann darauf, freiheraus zu singen: »Die Menschen sind glücklich, die Menschen sind froh, / denn wieder einmal reden und lachen sie weit unter ihrem Niveau!«
Frau Riethmüller erschien in der Tür und fragte, ob sie noch eine Flasche Wein bringen solle.
Hermann Frey hob die rechte Hand und winkte ihr freudig zu. »Bringen Sie nur! Wir müssen uns gebührend auf den nahenden Geburtstag unseres Meisters einstimmen.«
Heinrich Zille verzog das Gesicht. »Hört bloß uff damit! Wenn ick am 9. Januar in’t Bett jehe, dann wünsche ick mir, det ick erst am 11. wieda uffwache. So könnt ick den Jeburtstach einfach übaspringen.«
»Mensch, Heinrich«, mahnte ihn Hermann Frey, »janz Berlin will dir jratulieren und dir ’n Ständchen und ’n paar Blumen bringen, jede Zeitung will ’n Photo von dir im Blatt haben.«
»Und ick will nüscht weita als meine Ruhe ham!«
Max Liebermann meldete sich zu Wort. »Ich erinnere an Fontane, der Melusine im Stechlin sagen lässt: Sich abschließen heißt sich einmauern, und sich einmauern ist Tod .«
Hermann Frey nickt. »Det is dit Stichwort: dein Bejräbnis, Heinrich. Wenn de dir vor Oojen führst, det janz Berlin da uff de Beene is, denn muss dich dit doch wieda uffrichten.«
»Na, wer weeß, wat noch allet kommt. Prost!«
Johannes Banofsky war 1895 in Friedrichshagen bei Berlin als Sohn eines Lehrers zur Welt gekommen und Opfer einer frühkindlichen Prägung ganz besonderer Art geworden. Sein Vater hatte des Öfteren führende Mitglieder des Friedrichshagener Dichterkreises zu Gast gehabt, etwa Max Dauthendey, Richard Dehmel, Max Halbe, Knut Hamsun, Maximilian Harden, Gerhart Hauptmann, Peter Hille und Erich Mühsam. Letzterer hatte ihn ganz besonders beeindruckt, und so suchte Banofsky diesem in seiner äußeren Erscheinung zeitlebens zu gleichen.
Bei diesem Hintergrund nahm es nicht wunder, dass er schon als Zehnjähriger erklärt hatte, einmal Dichter werden zu wollen. Angesichts seiner mangelnden schulischen Leistungen, auch im Fach Deutsch, erschien dieser Wunsch seinen Eltern jedoch geradezu lächerlich, und so gaben sie ihn nach Abschluss der Volksschule 1909 zu einem Zimmermann in die Lehre. Dort glänzte Banofsky, schaffte die Gesellenprüfung ohne jede Mühe und zog dann, wie es Brauch war, durch halb Europa und erlebte manches Abenteuer. Wieder zurück in Berlin, brachte er seine Eindrücke zu Papier. Sein Roman Auf Schusters Rappen erschien 1920, wurde aber kein großer Erfolg, weil die Menschen nach Kriegsende anderes im Kopf hatten, als sich mit schöngeistiger Lektüre zu befassen.
Auch Johannes Banofsky war Soldat gewesen, hatte an vielen Fronten im Osten wie im Westen gekämpft, jedoch nur kleinere Verwundungen davongetragen. Nach dem Krieg hatte er sich bei einer Cousine in Rüdersdorf eingemietet und bei der May-Film GmbH Arbeit als Kulissenbauer gefunden.
In Joe Mays Filmstadt Woltersdorf, einem Vorläufer Hollywoods, wurden Abenteuerfilme wie Die Herrin der Welt (1919) und Das indische Grabmal (1921) gedreht. Banofsky ließ sich von der Begeisterung für den Film anstecken und versuchte alsbald sein Glück als Schauspieler. Nach ein paar Wochen Unterricht in einer erstklassigen Schauspielschule bekam er bei verschiedenen Produktionsfirmen kleinere Rollen, sogar der große Jules Greenbaum besetzte ihn einige Male. Zuletzt hatte man ihn in einer Nebenrolle in Zilles Die Verrufenen bewundern können.
Darüber hinaus hatte Banofsky einen Hang zur Malerei und einige Semester Kunstgeschichte an der Hochschule für Bildende Künste studiert.
Fragte man ihn, womit er seinen Lebensunterhalt verdiene, antwortete er stets: »Ich schlage mich so durch.« Derzeit hatte er keinerlei Einkünfte, konnte sich aber von den Zuwendungen seiner Eltern immerhin ein winziges Zimmer in der Köpenicker Straße leisten und musste nicht verhungern. Außerdem verdiente seine Freundin Cilly als Schneiderin auch ein bisschen was.
Als Banofsky Mitte Januar 1928 über das Filmgelände der U FA in Berlin-Tempelhof schlenderte, geschah dies nicht in der Erwartung, womöglich für einen plötzlich erkrankten Statisten einspringen zu können, sondern in der Hoffnung, Thea von Harbou zu treffen, die er in seiner Woltersdorfer Zeit aus der Ferne angehimmelt hatte. Sie hatte ihre Karriere zwar als Schauspielerin begonnen, war aber als Schriftstellerin bekannt geworden. Zu ihrer wahren Berufung sollten Drehbücher werden. Für Joe May hatte sie die erste Fassung von Das indische Grabmal geschrieben und für Erich Pommer das Drehbuch zu Dr. Mabuse, der Spieler . Regie hatte dort ein gewisser Fritz Lang geführt. Mit dem war sie inzwischen verheiratet, wenn es auch hieß, in ihrer Ehe krisele es anhaltend.
Banofsky wusste, dass Thea von Harbou in den Drehpausen gern an den Gleisen der Ringbahn spazieren ging, von wo aus man einen herrlichen Blick auf das Tempelhofer Flugfeld und die Türme der Berliner Innenstadt hatte. Er plante seinen Rundgang so, dass er ihr über den Weg laufen musste. Banofsky hatte ein Exemplar seines Romans bei sich, versehen mit einer anrührenden Widmung. Als Thea von Harbou ihm dann tatsächlich begegnete, stellte er sich vor und überreichte ihr mit einer kleinen Verbeugung das Buch.
»Oh …« Die Schauspielerin wurde zu oft von fremden Männern angesprochen, um wirklich überrascht zu sein.
»Ich bin gelernter Zimmermann«, erklärte Banofsky ihr, »und habe in Woltersdorf als Kulissenbauer gearbeitet, auch kleine Rollen habe ich schon gespielt. Eigentlich bin ich aber Schriftsteller. Sie sind mein Vorbild, denn ich trage mich mit dem Gedanken, auch einmal ein Drehbuch zu schreiben.«
»Machen Sie das! Sie müssen nur ein Thema finden, das die Produzenten vom Hocker reißt.« Thea von Harbou überlegte einen Augenblick, was sie Banofsky raten könnte. »Soll ich Ihnen nun Mut machen oder Ihnen sagen, dass das ein ziemliches Lotteriespiel ist – mit wenig Gewinnen und vielen Nieten? Ich empfehle Ihnen, sich auf einen Roman zu stützen, aus dem man einen guten Film machen kann, oder sich eine Berühmtheit zu suchen, deren Leben danach schreit, endlich verfilmt zu werden.«
Diesen Ratschlag hatte Banofsky befolgt und sich per Telephon mit Kurt Tucholsky verabredet. Sie kannten sich aus der Gruppe Revolutionärer Pazifisten, der Banofsky kurzzeitig angehört hatte. Als Treffpunkt hatten sie ein Café am Kleinen Tiergarten gewählt, das an der Straße Alt-Moabit lag. Tucholsky war ganz in der Nähe, Lübecker Straße Nr. 13, zur Welt gekommen und wollte noch einmal die Stätten seiner Kindheit sehen, bevor er womöglich für immer nach Schweden ging. Banofsky hatte in der Sickingenstraße etwas zu erledigen gehabt und ging nun die Rostocker Straße Richtung Süden entlang, um auf die Turmstraße zu stoßen und dann die Straße Alt-Moabit zu erreichen.
Читать дальше