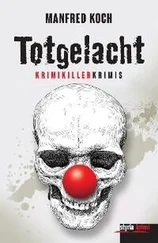Ich hatte übrigens die Wahl: entweder die Psychotante oder einen Pfarrer. Gott kann warten, dachte ich damals, bis dahin habe ich noch jede Menge Zeit. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Trotzdem, Frau Doktor Freud ist jetzt genau richtig für mich. Vielleicht, weil sie vom Alter her meine Tochter sein könnte, das Kind, das ich nie hatte, und dem ich jetzt erzählen kann, woraus das Leben in Wirklichkeit besteht. Nämlich aus viel mehr Fragen, als es Antworten gibt. Shit happens. So einfach, so banal.
Ein paar Antworten möchte ich allerdings schon noch bekommen. Nur Antworten, keine großen Wahrheiten oder Erklärungen, was richtig ist und was falsch, oder gar, was gut und was böse. Einfach Antworten. Also vermutlich das, was ich ohnehin weiß, aber bloß nicht zu denken wage, geschweige denn auszusprechen. Noch nicht.
Ich denke, im Grunde mache ich das Gegenteil dessen, was der Krebs in meinem Körper macht: Ich fange bei den Metastasen an und versuche dorthin zu gelangen, wo sie zu wuchern begonnen haben. Eigentlich völliger Unsinn, denn das, was geschehen ist, ändert sich dadurch auch nicht mehr. Leben lässt sich nicht rückgängig machen, und selbst wenn ich es könnte, würde ich es gar nicht wollen. Aber vielleicht ist es ja genau das, was mich frösteln lässt.

Die Nacht, in der sich ein dünner Eispanzer über die ganze Stadt gelegt hatte, war tagelang das alles beherrschende Gesprächsthema. Die Krankenschwestern, die Pfleger und die Ärzte in der Unfallchirurgie redeten über nichts anderes und nannten sie nur „Eisnacht“ und Patienten wie mich „Eispatienten“. Später erfuhr ich, dass sie es als kälteste Nacht seit Beginn der regionalen Wetteraufzeichnungen sogar auf die Titelseiten der Zeitungen geschafft hatte. Wobei weniger der Kälterekord für Aufregung sorgte, sondern die fast ebenso rekordverdächtige Zahl von Verkehrsunfällen und Verletzten. Die Stadtregierung wurde mit Vorwürfen überhäuft, Bürgerinnen und Bürger, die genau Buch geführt hatten, wann und wo die Streufahrzeuge und Streutrupps des Magistrats im Einsatz waren, empörten sich darüber, dass ausgerechnet ihr Stadtteil, ihr Straßenzug, ihr Gehsteig viel zu spät oder sogar überhaupt nicht an die Reihe gekommen waren, Unfallopfer und Versicherungen drohten mit Schadensersatzklagen, dem zuständigen Stadtrat und dem Bürgermeister wurde völlige Unfähigkeit attestiert, und alles mündete schließlich in eine heftige politische Diskussion über die offenbar katastrophalen Zustände, die sich hinter der schönen Fassade unserer Stadt verbergen würden.
Mag ja sein, dass wir einem Haufen Unfähiger ausgeliefert sind. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, aber im Grunde glaube ich es nicht. Und Leute, die so tun, als hätten sie den großen Durchblick, kann ich einfach nicht ernst nehmen. Leute, die hinter allem und jedem eine Verschwörung von Idioten oder finsteren Mächten wittern. Leute, die davon überzeugt sind, dass die ganze Menschheit nur eines im Sinn hat, nämlich ihnen ganz persönlich Schaden zuzufügen. Leute wie meinen Bruder.
Ich will ja nicht schlecht über ihn reden, aber Thomas gehört zu den Menschen, die meinen, die Welt sei nichts als böse und habe es nur auf sie abgesehen. Von dieser Opferrolle konnte ich ihn nie abbringen. Im Gegenteil, wenn ich ihn davon zu überzeugen versuchte, dass er nicht nur von Ignoranten, miesen Schweinen und kompletten Arschlöchern umzingelt sei, wie er es auszudrücken pflegte, wurde er nur noch verbissener in seiner wütenden Verzweiflung und warf mir vor, sogar ich würde ihn nicht mehr verstehen und mich gegen ihn wenden. „Mein Bruder, mein Feind“, sagte er dann jedes Mal. „Mein Bruder, der mich hasst.“ Doch ich hasste ihn nicht. Er ging mir ganz gewaltig auf die Nerven mit seinem abstrusen Weltbild, aber ich hasste ihn nicht. Und deshalb gab ich zu guter Letzt immer klein bei und spielte mit. Das alte Bruderspiel: Großer Bruder und kleiner Bruder, Verbündete im Kampf gegen den Rest der Welt.
Das funktionierte bestens, solange es nicht um große Sachen ging. Was war dabei, wenn ich Thomas’ Bilder hin und wieder in unserer Galerie ausstellte? Diese riesigen Leinwände, auf denen er mit Acrylfarben seine Frustration abreagiert hatte, Scheußlichkeiten, die er für bedeutende Kunstwerke hielt, für die sich aber kein Mensch interessierte. Und was außer ein paar hundert Euro kostete es mich schon, sein angeschlagenes Selbstbewusstsein immer wieder aufzubauen, indem ich manchmal zwei oder drei seiner Bilder kaufte, im Keller unseres Hauses versteckte und Thomas dann irgendwelche Geschichten über ausländische Kunstsammler erzählte, die überraschend in der Galerie aufgetaucht und von seinen Arbeiten ganz begeistert gewesen seien?
Hätte ich ihm die Wahrheit sagen sollen? Ihm an den Kopf werfen, dass seine Pinselhiebe und Farbspritzer wertloser Mist seien, epigonales Geschmiere, schon tausendmal so oder so ähnlich gesehen und auch nicht besser, wenn er behauptete, es handle sich um transzendentale Seelenräume, kosmische Explosionen oder die Verwandlung von Geist in Materie? Hätte ich ihm erklären sollen, dass die Galeristen, Kritiker und Jurymitglieder, die seine Bilder ignorierten, keineswegs verständnislose Banausen, vertrottelte Beamte oder Drahtzieher einer internationalen Kunstmafia seien? Was hätte es gebracht, ihn mit der Realität zu konfrontieren? Ihn, den Traumtänzer, der mit seinen Hirngespinsten niemandem Schaden zufügen konnte, im Gegensatz zu manch knallhartem Realisten.
Es erstaunte mich immer wieder, wie einfach es war, Thomas aus seinen moralischen Tiefs herauszuholen, ihn zu befreien aus dem Gefängnis seiner finsteren Gedanken. Ich musste ihn nur geschickt täuschen, dann wechselte er mit fliegenden Fahnen von der feindlichen Welt, die ihn betrog, zur freundlichen Welt, die ihn belog. Die Wahrheit empfand er als Angriff, sie erschreckte ihn, also musste ich eben seine Lügen mit meinen Lügen ausstechen, entscheidend war einzig und allein, dass ich im System blieb.
Unglaublich, wie glücklich er jedes Mal war, wenn ich ihn zur Vernissage eines Prominenten einlud und im Laufe des Abends den Gästen als jungen Maler vorstellte, dessen internationaler Durchbruch unmittelbar bevorstehe, als fantastisches Talent und absoluten Geheimtipp. Und wenn sich der Berühmte dann sogar noch freundlich gemeinsam mit dem jungen Kollegen fotografieren ließ, schwamm Thomas regelrecht in einem Meer von Seligkeit und registrierte überhaupt nicht, dass man hinter seinem Rücken über ihn lächelte und ihn für vieles hielt, für ein schräges Original, für einen kompletten Spinner, für das sympathisch überdrehte Galerie-Faktotum, für alles, nur nicht für einen Künstler. Und obwohl er nie lange anhielt, manchmal nur bis zum nächsten Morgen, vergönnte ich ihm diesen Rausch. Denn, verflucht noch einmal, Thomas war mein kleiner Bruder, und das wird er immer bleiben, auch dann, wenn ich vor ihm sterbe.
Claudia fand es immer falsch, dass ich mich so für Thomas einsetzte. Sie meinte, er würde bloß meine Gutmütigkeit ausnutzen, weil das für ihn klarerweise viel bequemer sei, als zu lernen, endlich auf eigenen Beinen zu stehen und erwachsen zu werden. Aber vor allem würde er dem Ansehen der Galerie schaden.
Natürlich hatte sie Recht. Natürlich wusste ich, dass Thomas ein Versager war, der sich hinter einer Mauer aus absonderlichen Gedanken verschanzt hatte und im Leben nur mit meiner Hilfe halbwegs zurechtkam. Aber ich wusste, oder besser, ich ahnte eben auch, warum er so geworden war. Doch jeder Erklärungsversuch prallte an Claudia ab. Ich versuchte es immer und immer wieder. Keine Chance. Für Claudia blieb Thomas nichts als ein kleiner Schmarotzer. Und vor allem ein Freak, ein verrückter Freak.
Читать дальше