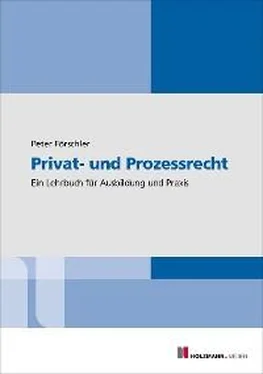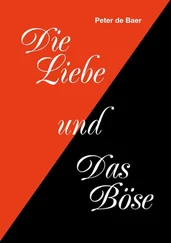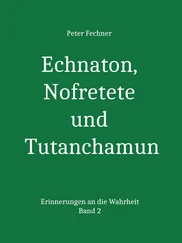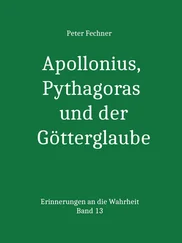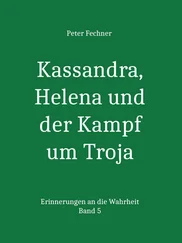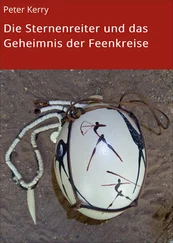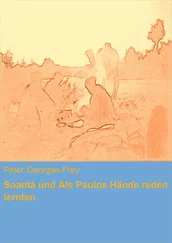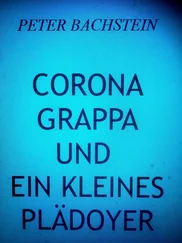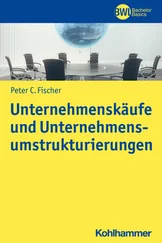14.3.3 Verstoß gegen ein Schutzgesetz (§ 823 Abs. 2 BGB)
14.3.4 Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung (§ 826 BGB)
14.4 Deliktshaftung aus unerlaubter Handlung bei vermutetem Verschulden
14.4.1 Haftung des Geschäftsherrn für Verrichtungsgehilfen, § 831 BGB
14.4.2 Haftung des Aufsichtspflichtigen für aufsichtsbedürftige Personen, § 832 BGB
14.5 Deliktshaftung ohne Verschulden (Gefährdungshaftung)
14.5.1 Tierhalterhaftung, § 833 BGB
14.5.2 Haftung für Betriebsgefahr eines Kraftfahrzeugs, § 7 StVG
14.5.3 Produkthaftung
14.6 Der zu ersetzende Schaden
14.6.1 Maß der Ersatzleistung
14.6.2 Art der Ersatzleistung
14.6.3 Die einzelnen Schadensposten am Beispiel des Straßenverkehrsunfalls
14.6.4 Ersatz von Personenschäden
15. Immobilienrecht, beschränkt dingliche Rechte und Wohnungseigentum
15.1 Der Grundstückskauf
15.1.1 Das Grundstück
15.1.2 Zustandekommen des Grundstückserwerbsvertrags
15.2 Übertragung des Grundeigentums
15.2.1 Sachenrechtliches Verfügungsgeschäft
15.2.2 Die Einigung nach § 873 Abs. 1 BGB
15.2.3 Die Grundbucheintragung
15.3 Das Grundbuch
15.3.1 Materielles und formelles Grundbuchrecht
15.3.2 Arten und Aufbau von Grundbüchern
15.3.3 Grundbuchämter
15.3.4 Eintragungsgrundsätze nach GBO
15.3.5 Die Publizität des Grundbuchs
15.4 Dingliche Rechte
15.4.1 Übersicht
15.4.2 Beschränkte dingliche Nutzungsrechte
15.4.3 Beschränkt dingliche Verwertungsrechte
15.4.4 Beschränkt dingliche Erwerbsrechte
15.5 Das Wohnungseigentum
15.5.1 Rechtlicher und historischer Hintergrund
15.5.2 Begriff des Wohnungseigentums
15.5.3 Begründung und Erwerb von Wohnungseigentum
15.5.4 Rechte der Wohnungseigentümer
15.5.5 Verwaltung des Wohnungseigentums
15.5.6 Gerichtliches Verfahren in Wohnungseigentumssachen
16. Forderungsmanagement im Unternehmen
16.1 Begriff
16.1.1 Definition
16.1.2 Überblick
16.2 Vorbeugendes Forderungsmanagement
16.2.1 Kreditrisiken
16.2.2 Rechtsrisiken
16.2.3 Liquiditätsrisiken
16.3 Das kaufmännische Mahnverfahren
16.3.1 Überwachung der Zahlungseingänge
16.3.2 Straffes Mahnwesen
16.3.3 Internes oder externes Mahnwesen?
16.4 Außergerichtliches Konfliktmanagement
16.4.1 Vorrang gütlicher Einigung
16.4.2 Kooperative Konfliktlösungsverfahren
16.4.3 Die Schiedsgerichtsbarkeit
17. Gerichtliche Verfahren
17.1 Vorbereitung eines gerichtlichen Verfahrens
17.1.1 Arten gerichtlicher Verfahren
17.1.2 Verfahrenschancen?
17.1.3 Notwendigkeit und Nutzen der Bestellung eines Prozessbevollmächtigten
17.1.4 Die Kosten eines Gerichtsverfahrens
17.2 Das gerichtliche Mahnverfahren
17.2.1 Charakter und Zulässigkeit des Verfahrens
17.2.2 Verfahrensverlauf
17.3 Der Rechtsstreit vor Gericht (Zivilprozess)
17.3.1 Risiken und Nebenwirkungen eines Zivilprozesses
17.3.2 Ablauf des Klageverfahrens
17.3.3 Die Beweiserhebung
17.3.4 Die Entscheidung des Rechtsstreits durch Urteil
17.3.5 Rechtsmittel gegen Urteile
17.4 Einstweiliger Rechtsschutz und selbstständiges Beweisverfahren
17.4.1 Einstweiliger Rechtsschutz
17.4.2 Selbstständiges Beweisverfahren
18. Die Zwangsvollstreckung
18.1 Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung
18.1.1 Der Vollstreckungstitel
18.1.2 Die Vollstreckungsklausel
18.1.3 Zustellung des Vollstreckungstitels
18.2 Durchführung der Zwangsvollstreckung wegen einer Geldforderung
18.2.1 Zwangsvollstreckung in bewegliche Sachen
18.2.2 Pfändung von Forderungen
18.2.3 Zwangsvollstreckung in Grundstücke
19. Hinweise für die Bearbeitung rechtlicher Fragen und Fälle
19.1 Aufgabenstellung in Praxis und Prüfung
19.1.1 Ausgangspunkt: Der Sachverhalt
19.1.2 Erfassen des Sachverhalts
19.2 Rechtliche Falllösung
19.2.1 Arbeitsauftrag: Die Fragestellung
19.2.2 Aufsuchen geeigneter Anspruchsgrundlagen
19.2.3 Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen (Subsumtion)
19.2.4 Prüfung anspruchsabwehrender Gegenrechte
19.3 Ergebnisformulierung im Gutachtenstil
Der Autor
Das Stichwortverzeichnis
1.Grundlagen der Rechtsordnung
1.1 Regeln für das Zusammenleben der Menschen
Der Mensch als Teil der Gesellschaft hat zwangsläufig Kontakte mit anderen. Das Zusammenleben in vielfältigen Gemeinschaften (Familie, Hausgemeinschaft, Unternehmen, Verein, Gemeinde, Staat) kann nur funktionieren, wenn bestimmte Regelndes Miteinanders, der Toleranz und der Rücksichtnahme beachtet werden. Diese Regeln haben unterschiedliche Quellen: Sie sind von der Naturvorgegeben, wie etwa die Sorge für nahe Familienangehörige, durch Traditionund Brauchtumentstanden oder auch von allgemeinen Moralvorstellungengeprägt.
Ein Teil dieser Sozialordnungist aber auch das geltende Recht. Es unterscheidet sich von den anderen Regeln, die für das Zusammenleben der Menschen bestimmend sind, durch seine Erzwingbarkeit. Während die Missachtung von allgemeinen Anstandsregeln lediglich die Missbilligung der Mitmenschen auslöst und das Unterlassen einer moralisch gebotenen Handlung allenfalls ein „schlechtes Gewissen“ verursacht, wird der Rechtsbrecher (strafrechtlich) nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs bestraft, der säumige Schuldner einer Forderung (zivilrechtlich) zur Zahlung durch ein Gericht verurteilt.
Die Rechtsordnung ist bestimmend für die rechtlichen Beziehungen der Bürger untereinander. Sie besteht aus den in Gesetzen und Verordnungen niedergelegten Verboten und Gebotenfür das äußere menschliche Zusammenleben.
Diese betreffen die Achtung fremder Rechtsgüter (Eigentum, körperliche Unversehrtheit, Ehre) ebenso wie den Zwang zur Erfüllung eingegangener Schuldverpflichtungen oder die Verpflichtung zum Ersatz angerichteten Schadens.
Recht und Moralhaben oftmals gleichen Ursprung und Hintergrund. Was unmoralisch ist, ist meist auch rechtswidrig. Gleichwohl sind Moral und Recht nicht dasselbe.
Unmoralischhandelt der wohlhabende Bürger, wenn er seinen unverschuldet in große Not geratenen Bruder nicht unterstützt. Eine rechtliche Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen besteht aber nur unter Verwandten in gerader Linie (Großeltern – Eltern – Kinder).
Rechtswidrigist es, bei roter Fußgängerampel die Straße zu überqueren, auch wenn weit und breit kein anderer Verkehrsteilnehmer zu sehen ist. Ein moralischer Vorwurf ist jedoch in solchem Fall wohl nicht begründet.
1.1.2 Bedeutung des Rechts für den Bürger
Das Recht wird in besonderen Situationenaugenscheinlich sichtbar:
> bei der Eheschließung vor dem Standesbeamten,
> bei der Kreditaufnahme am Bankschalter,
> bei der notariellen Beurkundung eines Grundstückskaufvertrages,
> bei einer Gerichtsverhandlung.
Die Bedeutung des Rechts erschöpft sich jedoch nicht in solchen „Feiertagsangelegenheiten“. Vielmehr findet „Recht“ im Leben der Bürgertäglich und zu jeder Stunde statt:
> Täglicher Einkauf von Lebensmitteln, Benzin, Kleidung.
> Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel.
> Wer mit seinem Pkw auf der rechten Straßenseite fährt, tut das, weil § 2 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) vorschreibt: „Fahrzeuge müssen die Fahrbahn benützen, von zwei Fahrbahnen die rechte.“
Читать дальше