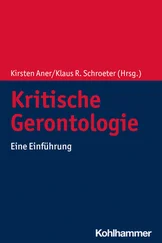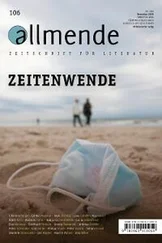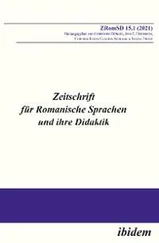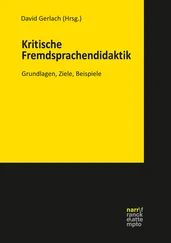Hans-Ernst Schiller untersucht Freuds Konzept des Individuums. Er zeigt, wie dessen Individuationstheorie an jenem Punkt überindividuelle Muster aktualisiert, an dem auf individueller und stammesgeschichtlicher Ebene unbewusste Prozesse ins Spiel kommen. Schiller diskutiert, in welchem Maße die Thematisierung der kollektiven Dimensionen Freud in die Diskursmuster seiner Zeit verstrickt. Er deckt aus philosophischer Sicht die Problemstellen des Gedankengangs insbesondere unter ethischen und sozial-normativen Aspekten auf. Seiner Argumentation liegt der begründete Hinweis auf Freuds Vernachlässigung des moralphilosophischen Wahrheitsanspruchs zugrunde. Von dort aus formuliert Schiller eine Kritik an Freuds Biologismus. Er zeigt in Detailanalysen, wo dieser sich in Widersprüche verwickelt oder hinter den Stand der philosophischen und historischen Reflexion zurückfällt – so insbesondere anhand der These von der erblichen Weitergabe kulturell erworbener Faktoren, die insbesondere Freuds Diskussion des Judentums problematisch macht.
Patricia Lavelle nimmt eine Engführung von Kant und Benjamin vor. Vor dem Hintergrund des Erfahrungsbegriffs aus Kants Kritik der Urteilskraft liest sie Benjamins Texte über Erfahrung – insbesondere den Entwurf eines philosophischen Systems »Über die kommende Philosophie« – konsequent aus kantischer Perspektive. Sie zeigt, dass Benjamin – aus heutiger Sicht – eine Mittelstellung zwischen der analytischen Philosophie, die den historischen Charakter der sprachlichen Darstellung vernachlässigt, und der Heidegger-Derrida-Schule, die ihn ontologisch verabsolutiert, einnimmt.
Hans Marius Hansteen liest Adorno unter rhetorischen Gesichtspunkten. Ausgehend von Adornos »Der Essay als Form« zeigt er im Rekurs auf Demirovic, Schmid Noerr und Früchtl, wie Adorno in seinen Texten gezielt tropische Figuren und ein antithetisches Konstruktionsprinzip anwendet, um den verhandelten Phänomenen in seiner Denkform gerecht zu werden. Hansteen demonstriert, dass Adorno damit die spätere Kritik eines performativen Selbstwiderspruchs bereits in der Konstruktionsphase seiner Texte unterlaufen hat. Der Autor gibt zudem einen exemplarischen Einblick in die aktuelle Rezeption der Kritischen Theorie in Norwegen.
Eine philologisch motivierte, philosophisch-darstellungstheoretische Auseinandersetzung mit den Werken Antonin Artauds unternimmt Timo Ogrzal . Dabei zeigt er, dass Artauds Sprachtheorie eng an verwandte Fragestellungen bei Benjamin und Adorno anschließt, vor allem aber, dass es eine transmediale Dynamik im Denken aller drei Sprachtheoretiker gibt, in der gerade durch die medialen Differenzen hindurch eine Verbindung etabliert und ausgetragen wird. Diese Verbindung, auf die alle drei Sprachkonzepte rekurrieren, gehört wesentlich dem Bereich der Musik an.
Der Aufsatz von Frank Jablonka gibt, ausgehend von Goethe und Marx, einen Überblick über zahlreiche Facetten einer Ideengeschichte der Magie. Kabbala, Alchemie und Paracelsus werden ebenso beleuchtet wie C.G. Jung und die Ethnopsychologie; weitere Stationen sind die poststrukturalistische Theorie des Simulakrums, Bourdieus Reflexionen über Herrschaft und Magie, Negts Faust-Interpretation und Habermas’ Diskussion des magisch-vorrationalen Weltbilds sowie Haugs Lesart der Magiekritik im Kapital . Der Autor rekonstruiert den magie- und mythenkritischen Zugriff der marxschen Theorie im Sinne einer Dialektik der Naturbeherrschung. Er vertritt die These, dass es eine Wahlverwandtschaft zwischen Magie und dialektischer Kritik der Rationalität gibt und versucht eine Perspektive aufzuzeigen, in der Impulse einer – nicht abstrakt negierten – Magietradition dem Projekt menschlicher Emanzipation zugute kommen könnten.
Ein Gespräch über die aktuelle Positionierung der Kritischen Theorie führte Dennis Johannßen mit Martin Jay , der seit seinem Standardwerk über die frühe Geschichte des Instituts für Sozialforschung – The Dialectical Imagination aus dem Jahre 1973 – zu den führenden Kennern der Kritischen Theorie in den USA gehört. Jay registriert ein wachsendes Interesse an der Kritischen Theorie in den USA, vor allem aber ist er davon überzeugt, dass die Kritische Theorie für die Reflexion auf die derzeitige gesellschaftliche Situation unabdingbar sei.
Claus-Steffen Mahnkopf greift in seinem Beitrag den Begriff des falschen Bewusstseins auf, rückt ihn zurecht und wendet ihn engagiert auf Gegenwartsphänomene aus dem politischen und ästhetischen Bereich an. Dabei verteidigt er den Begriff, sofern er recht verstanden werde, als eine Kategorie aktueller Kulturkritik.
Beigegeben ist dieser Ausgabe eine Übersicht über einschlägige Neuerscheinungen des Jahres 2009 sowie ein aktuelles Gesamtinhaltsverzeichnis der Beiträge dieser Zeitschrift, das auch auf der Internetseite der Zk T eingesehen werden kann. Dort ist u. a. auch das Interview mit Martin Jay in der englischen Originalfassung abgelegt. Die Adresse lautet: www.zkt.zuklampen.de
Shierry Weber Nicholsen
The Mutilated Subject Extinguished in the Arena of Aesthetic Experience
Adorno and Aesthetic Violence1
Introduction
Where does subjective aesthetic experience take place? This apparently paradoxical question leads us to a crucial aspect of Theodor Adorno’s understanding of aesthetic experience. On the face of it, one might think that subjective experience takes place within the subject. No, says Adorno; »the viewer’s« – or reader’s, or listener’s; Adorno is not concerned here with the specific medium of the artwork – »relation to art is not one of incorporating the work. On the contrary, the viewer [seems] to vanish in the work of art.«2 In order to understand Adorno’s statement that the viewer vanishes into the work of art, we must understand his conception of the dialectic of aesthetic experience. I will begin by noting three crucial elements in this dialectic. First, aesthetic experience is an active process between subject and object, between the experiencing subject and the work of art. Second, this process takes place in a place or space that Adorno calls the »arena« of aesthetic experience. Third, there is an element of violence in the encounter within that arena.
To elaborate: Aesthetic experience is an active process, but the subject and the object are active in different ways. The experiencing subject acts by using what Adorno calls his (I use the masculine pronoun generically) »exact imagination« to recapitulate the internal logic of the work, recomposing the work with his ear, repainting it with his eye. The artwork itself is active: »Artworks have the immanent character of being an act,« he says, »even if they are carved in stone.«3 An arena is a space that is empty except for the activity that takes place there. The word arena evokes associations with gladiatorial combat – a combat to the death. In fact, we must imagine a deadly combat taking place in this arena between the subject and the work of art. For as far as the experiencing subject is concerned, the work of art acts by inflicting what I will call »aesthetic violence« on the subject.
My focus in this paper will be on this element of violence in subjective aesthetic experience. Violence may seem an alarming word to use in connection with the aesthetic. Those of us who are lovers of art may be reluctant to identify violence as a key element in our aesthetic experience. Perhaps we think instead of pleasure or delight, of being deeply moved, of awe and gratitude. But there is a dimension of forceful impact, shock and sudden change in the experience of powerful works of art that can be called violent. This dimension of aesthetic experience is easily ignored or minimized in an idealized representation of aesthetic experience. But it is central to Adorno’s understanding of aesthetic experience and intimately linked for Adorno with the truth content of art. It deserves our full attention. My aim in this paper is to explore some of the phenomenology of this dimension of aesthetic experience. Adorno claimed that in psychoanalysis only the exaggerations are true. In a similar vein, I will speak of aesthetic violence and attempt to draw out the most disturbing aspects of this dimension of aesthetic experience.
Читать дальше