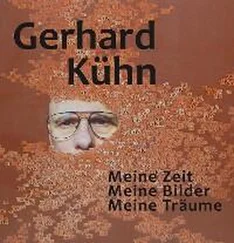Was tun? Mein Vater nahm den Käfig mit runter in den Garten und hängte ihn an den untersten Ast des Kirschbaumes, teilte ihn mit einer Pappe in zwei Abteile, sodass das Weibchen nicht herausfliegen konnte, und öffnete die Käfigtüre. Das Weibchen wurde ganz wild und piepte wie verrückt, als sich das Männchen vom Baum herab meldete. Es dauerte keine zehn Minuten, dann saß der Ausreißer von ganz allein wieder im Nest. Sollte man nicht glauben, aber es war tatsächlich so. Nun konnten beide wieder zusammen lärmen.
Im Sommer hängten wir den Käfig öfters im Garten auf. Das tat den Vögeln anscheinend gut in der frischen Luft.
Das Weibchen ist mir ebenso bei so einem Frischluftaufenthalt mal durch die Öffnung des Futternapfes entwischt. Es hatte aber nicht so eine Power wie das Männchen und flog nur ein wenig im Hof zwischen unserem und dem Nachbarhaus hin und her, dann war es erschöpft und mein Vater fing es mit den Händen wieder ein.
Am heftigsten ging es immer dann zur Sache, wenn es Streit ums Futter gab. Also entschied ich mich, etwas dagegen zu tun. Ich stellte einen zweiten Futternapf rein, besser gesagt, ich verwandelte den Wassernapf in einen Futternapf. Dass Vögel auch ab und zu trinken müssen – die Einsicht kam leider zu spät.
Meine Eltern verboten mir daraufhin bis auf Weiteres meine „Züchtungen“. Ich solle lieber etwas Sinnvolleres tun.
Wie alle meine Vorfahren so war auch ich katholisch getauft und mehr oder weniger streng in diesem Glauben erzogen worden. Mehr streng mütterlicherseits, weniger väterlicherseits. So war es meistens in den Familien. Mein Vater war nicht der permanente Kirchgänger, ihm „reichte“ es Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Meiner Mutter war jeder Sonntag heilig. Also hieß es auch für uns Kinder, jeden Sonntag Punkt zehn Uhr in der Kirche zu sein.
Unser Gotteshaus war eine hölzerne, barackenartige Konstruktion im Nachbarort, eine Art Kapelle mit einem Glockenturm, dessen Geläut weniger einem Dom, dafür eher dem Gebimmel, das man in den Schweizer Alpen gelegentlich hört, glich. Im Winter sorgte ein gusseiserner Kanonenofen dafür, dass man darin nicht erfror. Es gab sogar eine Art Orgel, ein Harmonium.
Unser Pfarrer freute sich natürlich über meinen eifrigen Kirchgang, sodass er mich bald als Ministrant eintrug. Ab jetzt war ich in etwa jede zweite Woche dran, zu ministrieren.
Anfangs wurden die Messen zum Teil oder auch noch ganz in lateinischer Sprache gehalten. Die älteren unter den Messdienern haben das dafür notwendige an Latein noch im Religions- oder im Ministrantenunterricht lernen müssen. Ich nicht mehr, also murmelte ich irgendwelchen Kauderwelsch vor mich hin, sodass keiner der Kirchgänger etwas davon mitbekam.
Fasziniert hatte mich immer die Hostie. Bevor ich meine heilige Erstkommunion erhielt, wollte ich aber schon genau wissen, was das kleine Ding denn ist, wie es schmeckt und vor allem, wie es wirkt. Was tat ich also: Ich entnahm … okay, ich möchte es nicht schönreden, klaute mir also eine aus dem Körbchen!
Gott! Ich war ein Dieb! Und noch dazu in der Kirche! Entsetzlich. Schlimmer geht’s wohl kaum! Danach kam ich mir elend und armselig vor und schämte mich vor mir selbst. Bin mir auch ganz sicher, dass ich das niemals meinem Pfarrer während der Beichte berichtete.
Es schmeckte übrigens genau nach Hostie, wie eine Oblate ohne Eigengeschmack. Da ich sie ja vor Beginn der Messe entwendete, war sie auch noch nicht geweiht, also ohne „Effekt“. Von daher wohl eher auch eine kleinere Sünde …
Hatte ich später manchmal eine Pechsträhne: War das etwa die zugehörige Strafe von ganz oben? Vielleicht? Man weiß es nicht.
Die Holzkirche war schon sehr in die Jahre gekommen, irgendwann in meiner Jugendzeit hat man – wohl auch mit Geldern aus dem Westen – ein paar hundert Meter weiter eine moderne, massive Kirche gebaut. Die alte Baracke wurde anschließend vom Bischof entweiht, der Glockenturm abgebaut. Der Rest diente schließlich noch eine Zeit lang als Scheune für Heu und Stroh. Später wurde alles ganz abgerissen. Das änderte aber nichts am sonntäglichen Rhythmus, den Gottesdienst zu besuchen. Solange ich im Haus meiner Eltern wohnte, war das ein Muss.
Nun, welcher Junge hat es denn nicht probiert? Das Rauchen! Zu unserer Zeit eine Selbstverständlichkeit. Einerseits war es für Kinder überhaupt kein Problem, an Zigaretten oder Tabak zu kommen, denn ich konnte – vorausgesetzt, ich hatte das nötige Geld – jederzeit Tabakwaren, jegliches Raucherzubehör, einschließlich Benzinfeuerzeuge, Feuerzeugbenzin oder Streichhölzer kaufen. Andererseits musste die Neugierde ja auch befriedigt werden. Von den Älteren rauchte seinerzeit fast jeder, da konnte es wohl kaum schlecht sein. Also probierten wir es aus.
Bei Frau Hiltscher (ein Begriff im Ort für einen kleinen Tabakladen an der Ecke unserer Straße) holte ich öfters im Auftrag meiner beiden Opas Tabakreste beziehungsweise des einen Lieblingsmarken Salem oder Stambul. Letzterer Name rührte bestimmt von Istanbul her, jedenfalls ein filterloses Kraut. Und auf dem Bildchen der Schachtel waren – glaube ich, mich zu erinnern – Türken abgebildet.
Das rauchte einer meiner Großväter (mein Opa, der bei uns im Haus wohnte) vorzugsweise, obwohl in seinem Wohnzimmer ein Schiebeschrank stand, der bis zum Platzen mit westdeutschen und amerikanischen Nobelzigaretten vom Feinsten vollgestopft war. Selbst brasilianische Zigarren gab es da in Hülle und Fülle.
Wer sich erinnert: zum Beispiel More, eine dunkle, dünne hundertzwanziger Zigarette aus den USA, die „rauchten“ wir besonders gern, auch später noch, zu Discozeiten. Natürlich pafften wir nur, sonst hätten wir uns dabei sicher in die Hosen gemacht.
Woher hatte er das Zeug? Sein Sohn, im Jahr 1961 noch rechtzeitig vor der Mauer geflüchtet, schickte regelmäßig Tabak, selbst als sein Vater aufgrund von Atemwegserkrankungen von einem Tag auf den anderen mit dem Quarzen aufhörte. Mein Onkel meinte, das Zeug könne man trotzdem gut gebrauchen, wenn man mal einen Handwerker benötige. Recht hatte er und schickte fleißig weiter.
Gelegentlich drehten wir unsere Zigaretten auch selber, die dazu nötigen Utensilien kauften wir uns wiederum im Tabakladen.
Einmal – zu Beginn unserer Räucherei – hatten wir keinen Tabak und wussten noch nicht, was Tabak eigentlich war, da füllten wir die kleinen Blütenbrösel rein, die im Frühsommer die Birken verloren. Es qualmte und stank entsetzlich. Konnte man wirklich nicht rauchen. Ein einmaliger Versuch.
Also orientierten wir uns lieber in Richtung Markenware. Es gab ja genug davon. Der Schrank wurde nie leerer, selbst dann nicht, wenn ich uns ab und zu eine Schachtel stibitzte. Ich weiß, es war wieder eine Sünde! Ich musste wieder zur Beichte. Aber die Versuchung war zu groß und mein Opa merkte es auch nicht, oder vielleicht doch?
Später, mit achtzehn, neunzehn, hörte ich mit dem gelegentlichen Qualmen auf. Es gab ja weitaus besser Gelegenheiten zu sündigen, die waren zu jener Zeit weder ungesund noch gefährlich und machten zudem bedeutend mehr Spaß …
Der Angelsport hatte es mir und meinem Freund bereits seit Kindertagen angetan. Oder besser gesagt das Angeln an sich, denn der Sport war höchstens beim schnellen Wegrennen gefragt. Dass man dazu einen Angelschein brauchte, interessierte uns eher weniger. Wir angelten dann, wann wir Lust hatten. Wir angelten dort, wo wir Lust hatten.
Die Spree als Angelgewässer schied definitiv aus, da sie zu meiner Zeit mehr als klinisch tot war. Chemisch vergiftet, absolut erledigt. Und das bereits unweit der Quelle! Was bis zu unserer Gemeinde die Farbspiele der Abwässer aus den Textilbuden vielleicht noch überlebte, wurde dann spätestens durch die Reste aus der Feuerverzinkerei erledigt. So war das damals – schlimm. Aber im Spreewald „kahnte“ man bereits wieder in diesem Fluss, Berliner in Ost wie West badeten sogar darin. Muss sich wohl zwischendurch irgendwie selbst geheilt haben, die Spree.
Читать дальше