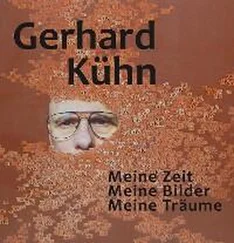Meiner Schwester wollte ich als kleiner Junge frühzeitig das Spielen mit dem Sand schmackhaft machen. Als sie – zwei Jahre jünger als ich – nach dem Mittagsessen im Kinderwagen zum Schlafen in den Hof rausgestellt wurde, hatte ich die Aufgabe, sie neben dem Spielen zu beaufsichtigen. Irgendwann wurde sie munter und unruhig im Kinderwagen. Wollte sie auch mit Sand spielen? Das deutete ich aus ihrem Geplärre. Also schaufelte ich ihr den Sand in den Wagen. Die Äuglein voll, es knirschte heftig zwischen den ersten paar kleinen Zähnchen. Auweia … Ging für mich nicht gut zu Ende dieser Tag. Wieder was dazugelernt.
Selbst richtig scharfe Messer hatten wir. Solche, mit denen die Jäger im Wald unterwegs waren, mit einer etwa fünfzehn Zentimeter langen Klinge und einem dicken Schaft aus Geweihstücken, Hirschfänger genannt. Woher, weiß ich nicht mehr, wir hatten sie eben. Die brauchten wir, um uns Pfeifen oder Flöten (etwa ein zehn Zentimeter langes Stück fingerdickes, grünes Haselnussholz mit einer Kerbe versehen) herzustellen: mit Spucke so lange einweichen und ringsherum mit dem Messergriff dengeln (klopfen), bis sich die zarte Rinde im Ganzen vorsichtig wie eine Hülle abziehen lässt, die bei einer Trillerpfeife üblichen Öffnungen für die Luftwege aus dem Holz schnitzen, die Hülle wieder draufschieben – fertig! Oder um Pfeil und Bogen oder Katapulte zu bauen. Es gab früher die dicken Gummis für die Einmachgläser, die besorgte ich mir von meiner Oma. Schlüpfergummis machten sich auch gut. Für ein extrastarkes Katapult zerschnitten wir Fahrradschläuche, die hatten dann aber richtig Schmackes. Später bauten wir auch Armbrüste damit.
Als Geschosse nutzten wir große Kieselsteinchen oder besorgten uns aus dem am Markt ansässigen Metallwarengeschäft fette Eisenkrampen. Die flogen locker hundert Meter oder weiter. Wohin auch immer. Manchmal knallte es irgendwo. Aber wir waren doch noch Kinder!
Es kam die Zeit, als mein Schwesterchen alleine laufen lernte. Als sie das einigermaßen beherrschte, war sie in der Regel unterwegs: Sie war weg. Ihr Drang nach persönlicher Freiheit war von Beginn an extrem markant. Dagegen half nur eins: Man musste sie anbinden. Niemand konnte ständig hinter ihr her sein, also besorgte sich meine Mutter ein Halfter und befestigte die permanente Ausreißerin mit einer fünf Meter langen Leine an dem Wäschepfahl im Hof oder hinten auf der Wiese. Zehn Meter Durchmesser im Freilauf – zum Spielen.
Band sie einer aus Versehen oder aus Mitleid los, war sie wieder weg. Irgendwann brachten sie Leute vom zweihundertfünfzig Meter entfernt liegenden Marktplatz zurück, dort traf man sie an, nur mit einer Windel und Schlüpfer bekleidet. Sie war wieder mal ausgebüxt. Derweil war sie als Ausreißerin bekannt und man wusste, woher sie kam.
Je älter, umso furchtloser wurden ihre Fluchtaktionen. Selbst hohe Zäune waren für sie kein wirkliches Hindernis. Unser Garten war in südliche Richtung mit einem etwa zwei Meter hohen, schön satt mit altem Motorenöl schwarz getünchten Holzlattenzaun versehen. Jede einzelne Latte war oben angespitzt, sollte ja niemanden dazu einladen, von außen her drüberzuklettern. Die einzelnen Abschnitte wurden durch dicke Granitsäulen gehalten.
Eines Tages hörte mein Opa, der sich auf dem Gemüsebeet seinen Anpflanzungen widmete, ihre Rufe: „Oooopaaaaa – ich häääänge!“
Tatsächlich, er traute seinen Augen kaum, beim Versuch, diesen Zaun zu überwinden, rutschte sie ab und eine Holzlatte durchbohrte – zum Glück nur – ihr dünnes Sommerkleidchen in Brusthöhe und sie hing kopfüber im Zaunfeld! Horror!
Sie war als Kind immer der quirligere Teil der Familie. Damit wenigstens beim Essen Ruhe einkehrte, hatte mein Vater ein ganz profanes Mittel: Um sich anbahnende Unruhen bereits im Keim zu ersticken, legte er wortlos neben seinen Teller mit dem üblichen Besteck einen Holzkochlöffel ab. Dieser hatte tatsächlich beruhigende Wirkung.
DER STAAT – SEINE ORGANE UND ICH – TEIL 1
Bereits mit vier Jahren hatte die Staatsmacht auf mich einen ersten, prägenden – negativen Eindruck hinterlassen.
Ich weiß noch: Eine kurze Zeit lang musste ich den örtlichen Kindergarten besuchen. Kindergarten! Das war für mich wie Gefängnis mit Außenschläfer oder wie man das nennt. Ich und Kindergarten, die härteste Strafe überhaupt! Noch weit vor Stubenarrest. Ich habe absolut keine guten Erinnerungen an diesen Ort, habe fast alles schnell aus meinem Erinnerungsvermögen gestrichen.
Nur ein paar Fragmente blieben hängen: Es gab große Volieren mit Vögeln, Fasanen. Was sonst noch drin flatterte, weiß ich nicht mehr. Die waren mir im wahrsten Sinne des Wortes als dunkle Verschläge im Kopf verblieben, gespenstisch düster und unheimlich.
Und an noch etwas erinnere ich mich. Eines Tages mussten wir in einer Reihe antreten, als der ABV (ABV heißt „Abschnittsbevollmächtigter“ – welch hirnlose Wortprägung für einen „Volks“-Polizisten, der für einen „Abschnitt“ bevollmächtigt war), so nannte man den Ortspolizisten, uns der Nase nach begutachtete. Einer hatte wohl was ausgefressen, kann mich aber nicht mehr erinnern, wer und was. Wie gesagt, es war im Kindergarten, wir Kinder waren etwa vier Jahre alt!
Dieses widerwärtige Schnüffelgesicht des ABV erinnert mich im Nachhinein an ein Hausschwein, welches genüsslich mit der Schnauze im Dreck wühlt und vor sich hin grunzt. Uns machte das Angst.
Dieses Ereignis hat sich mir äußerst negativ eingeprägt. Vielleicht war es ein Ziel dieses Staates, mit der Einschüchterung früh zu beginnen? Ab diesem Moment waren bei mir die „Volks“-Polizisten als „Freunde und Helfer“ unten durch.
Den Kindergarten hasste ich wie die Pest. Und schließlich hatte meine Methode, während des täglichen Anmarsches so herzzerreißend zu heulen – wie, wenn man jemanden zum Abdecker bringen würde – bei meinem Opa so einen durchschlagenden Erfolg, dass er vor lauter Mitgefühl wieder mit mir nach Hause ging. Zum guten Schluss beschlossen meine Eltern, bei mir auf diese Einrichtung zu verzichten. Und so konnte ich mich wieder dem Spielen mit meinem besten Freund – der ebenfalls nicht in diese Einrichtung gehen musste – und den gemeinsamen Erlebnissen unserer Art der Freiheit widmen.
MOHN – KANN MAN DAVON EINEN RAUSCH BEKOMMEN?
Im Grunde genommen waren meine Schwester und ich liebe Geschwister, okay, meistens, na gut – oft. Die meiste Zeit verbrachte ich eh mit meinem Freund. So kamen wir uns selten ins Gehege.
Wir zwei Jungs waren viel unterwegs, falls wir uns nicht gerade gegenseitig mit Hacken drangsalierten und aufgrund dessen zwangsgetrennt wurden. Ob es regnete oder schneite, interessierte uns nicht im Geringsten. Hauptsache draußen.
Die schlimmste Strafe für uns war Stubenarrest. Damit könnte man der heutigen Computergeneration einen Riesengefallen tun. Für mich und ihn war es das blanke Elend, zu Hause eingesperrt zu sein. Wir hatten ja auch traumhafte Bedingungen zum Ausgehen.
Auf unseren Touren wurde permanent nach Essbarem geforscht. So entdeckten wir beispielsweise den Mohn als schmackhaften „Snack“. Der Mohnanbau war im Osten, so weit ich weiß, nicht verboten. Das Produkt Mohn sollte auf dem Kuchen landen und nicht in der Spritze.
Zu jener Zeit hatte ich zwei Arten der Begegnung mit dieser Kapselfrucht. Die eine, die ich fürchterlich fand, wenn meine Mutter auf die Idee kam, Mohnkuchen zu backen oder Pflaumenklöße herzustellen und ich dazu den Mohn mahlen musste. Dazu diente die Mohnmühle, eine hölzerne Handmühle, ähnlich einer alten Kaffeemühle, in die man oben die Mohnsamen reinschüttete und dann die Kurbel drehen und drehen und drehen musste, es ging kaum was durch. Reinste Strafarbeit. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit. Ich erinnere mich, zwölf bis fünfzehn Minuten benötigte ich für ein Döschen zerquetschten Mohns, welchen man dann unten rauszog. Die drei- oder vierfache Menge wurde für die Pflaumenklöße benötigt, für den Kuchen noch mal das Doppelte. Die Resultate aber waren einfach köstlich.
Читать дальше