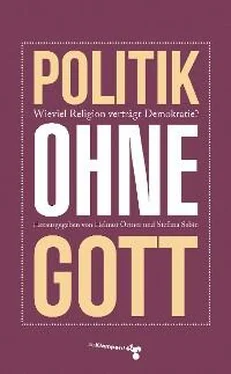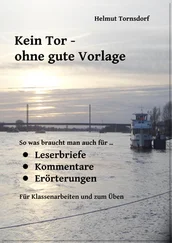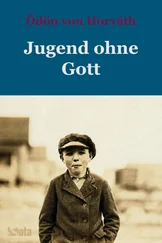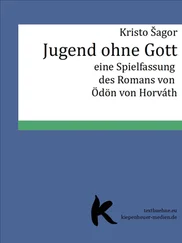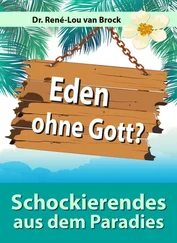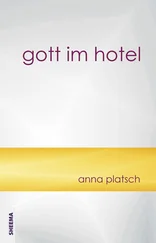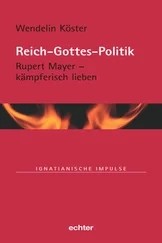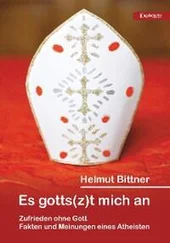Wie es eine Dialektik der Aufklärung gibt, so lässt sich auch eine Dialektik der Säkularisierung erkennen, die Fortschritt von Freiheit und Unterdrückung in gleichem Masse hervorbringt. Das »short century« hat eine Wüste voller Desillusionierungen hinterlassen: An Nationalismus, Rationalismus und Marxismus mag niemand mehr so recht glauben. In dieser Wüste erscheinen immer mehr Prediger, Gurus und Propheten, die mit Charisma Massen orientierungsloser Vereinzelter zu Gefolgschaften formieren. Autodidakten haben unter diesen Neureligösen große Chancen; denn die alten Hierarchien, die auf Macht und Gelehrsamkeit fußten, werden abgelehnt. Erweckungserlebnisse kann jeder haben; deswegen finden demagogische Propheten bei den Erniedrigten und Beleidigten viel Hoffnung. Dem hat das normale Alltagsbewusstsein wenig entgegenzusetzen.
EVELYN FINGER
Über Religion lässt sich in der Demokratie gut streiten
Manchmal passen Religion und Politik perfekt zusammen. Manchmal sind Kirche und Staat ein schönes Paar. Im Herbst 2012 zum Beispiel, als der deutsche Bundespräsident den deutschen Papst in Rom besuchte und die Oberhäupter zweier gegensätzlicher Welten in derselben Sprache miteinander redeten, konnte es den Deutschen vorkommen, als sei nie etwas Trennendes zwischen diesen Welten gewesen. Der Katholik Joseph Ratzinger hatte zuletzt ein Buch über Jesus geschrieben. Der Protestant Joachim Gauck hatte zuletzt ein Buch über die Freiheit geschrieben. Aber in beider Heimat gehört das ja zusammen. Da sind Gott und Freiheit kein Gegensatz. Da haben Pastoren wie Gauck eine Diktatur gestürzt. Man könnte wirklich denken, Glauben und Demokratie – das passt.
Doch weit gefehlt. Der Glaube fügt sich nicht so ohne Weiteres in die moderne Welt. Unter Benedikt XVI. hat der Vatikan eine Doktrin verabschiedet, die besagt: Demokratie muss auf den Zehn Geboten fußen. Das heißt, der demokratische Staat soll sich zum Gott der Christen bekennen. Erst kommt Gott, dann der Staat. Nicht umgekehrt.
Meinte der deutsche Papst das ernst? Dann trennt ihn von dem Pastor und Freiheitsprediger Gauck ein Abgrund. Es ist der Abgrund zwischen einem Glauben, der sich in den Rechtsstaat einfügt, und einem Glauben, der Sonderrechte beansprucht und Staat machen will. Jetzt werden die politischen Ansprüche von Religion wieder lauter – und wir streiten ständig über Gott. Erstaunlich! Da stehen viele Kirchen leer, und viele Kirchenmitglieder glauben auch nicht mehr so recht an Gott. Doch in der Öffentlichkeit ist Gott das große Thema.
Warum regen uns immer noch Glaubensfragen auf: Ist das Ritual der Beschneidung eine Körperverletzung? Müssen wir die religiösen Gefühle unserer sensibleren Mitbürger gegen Karikaturen schützen? Brauchen wir vielleicht ein Gesetz gegen Blasphemie? Wer darf Kopftuch tragen in der Schule? Wohin hängen wir das Kruzifix? Und ist es nun in Ordnung, dass die Kirchensteuer vom Staat eingezogen wird und steuerlich abgesetzt werden darf, was den Staat jährlich drei Milliarden Euro kostet? – Spannende Debatte, aber man kann sie bald nicht mehr hören. Denn es geht ja jedes Mal um die im Grundgesetz längst beantwortete Frage: Wie viel Glauben verträgt die Demokratie?
An der Spitze der Bundesrepublik wissen sie das genau. Dort steht nicht nur als Präsident ein ehemaliger Pastor, sondern auch als Kanzlerin eine Pfarrerstochter, und bei den Grünen spielt die Kirchentagspräsidentin a. D. Katrin Göring-Eckardt eine entscheidende Rolle. Christliche Politiker genießen in unserer zunehmend entkirchlichten Gesellschaft hohes Ansehen. Und das ist kein Wunder, denn sie verkörpern einen aufgeklärten Glauben, der religiöse Gewissheit und staatsbürgerliche Freiheit versöhnt.
Leider ist die Selbstaufklärung der Religion noch am Anfang. Nicht nur die gewalttätigen Islamisten und die verbotswütigen Evangelikalen führen uns das vor. Wenn der Vatikan sich durchsetzen könnte und die Zehn Gebote würden wirklich für alle Bürger gelten, dann wäre die Demokratie nicht mehr weltanschaulich neutral, und Religionsfreiheit gäbe es auch nicht. Dann hätten wir einen Gottesstaat. Wer aber im Gottesstaat Gott leugnet, ist ein Staatsfeind. So war das im christlichen Absolutismus Europas, so ist das heute im Iran.
Hat der Vatikan das übersehen? Natürlich nicht. Er überträgt einfach den Wahrheitsanspruch der Religion auf die Politik. So gerät er aus dem respektvollen Verhältnis zum Rechtsstaat unversehens in das anmaßende Gebaren einer Glaubensdiktatur. Um das zu verhindern, gibt es im Westen heute eine mehr oder minder strikte Trennung zwischen Kirche und Staat. Diese Trennung erlaubt es den deutschen Katholiken, in ihrer Eigenschaft als Bürger religiöse Weisungen aus Rom zu ignorieren. Trotzdem bleibt da ein Konflikt.
Es ist der Konflikt zwischen den religiösen Geboten und den weltlichen Gesetzen, zwischen der einen Wahrheit und den vielen Meinungen, zwischen der Unanfechtbarkeit einer Heiligen Schrift und der Diskutierbarkeit unserer freiheitlichen Prinzipien. Dieser Konflikt betrifft keineswegs nur die Katholiken. Denn alle großen Religionen vertrauen darauf, dass Gott existiert. Das ist eine absolute Setzung. Und daraus folgen absolute Geltungsansprüche. Sie sind nicht die persönliche Marotte eines Papstes, sondern unausweichlich.
Wer wirklich an Gott glaubt, der muss auch wollen, dass seine Wahrheit gilt. Deshalb ruft der Vatikan katholische Apotheker auf, keine empfängnisverhütenden Mittel zu verkaufen, wo Empfängnisverhütung gesetzlich erlaubt ist. Deshalb will die Evangelische Kirche Deutschlands die Präimplantationsdiagnostik verbieten und beruft sich dabei auf das christliche Menschenbild, obwohl die von einem Verbot betroffenen Bürger gar nicht alle Christen wären.
Der demokratische Staat hat sich von Gott distanziert, um verschiedene Geltungsansprüche unter seinem Dach zu vereinen. Er garantiert eine Friedensordnung, in der konkurrierende Wahrheiten nebeneinander existieren können. Er ist überhaupt erst entstanden, weil die Religionen sich einst als friedensunfähig erwiesen haben, als sie noch im Besitz der politischen Macht waren. Weil sie jedoch auch heute Politik machen, entstehen an der Schnittstelle zwischen Glauben und Demokratie zunehmend heftigere Debatten, sodass selbst fromme Bürger rufen möchten: Lasst mich in Ruhe mit eurem Gott!
Ob Beschneidung oder Blasphemie, Kopftuch oder Kruzifix: Es ist immer derselbe Konflikt. Religion zielt auf Letztes und Unbedingtes. Demokratie zielt auf Offenheit und Pluralismus. Da knirscht es im Gebälk der freien, aber religiös geprägten Gesellschaft. Darum streiten wir, ob die Beschneidung gegen das Recht auf Unverletzlichkeit der Person verstoße. Und wenn nicht, ob das Selbstbestimmungsrecht hier missachtet werde. Und wenn ja, ob dann nicht nur die Beschneidung, sondern demnächst auch die Taufe zu verbieten sei.
Die Debatte nervt. Aber sie ist nötig. Sie betrifft weniger das Verhältnis der Bürger zur Religion als das Verhältnis der Religion zur Politik. Letzteres ist auch in Deutschland an vielen Stellen prekär. So steht in der Landesverfassung von Rheinland-Pfalz, alle Kinder seien »zur Gottesfurcht« zu erziehen. So beharren beide großen Kirchen auf einem eigenen eingeschränkten Streikrecht, denn sie finden, wo alle im Namen des Herrn zusammenarbeiten, könne es harsche Interessenkonflikte nicht geben. Obwohl der Staat die Meinungsfreiheit garantiert, gibt es Lehrzuchtverfahren gegen Theologen mit abweichender Meinung. Und in kirchlichen Betrieben herrscht immer noch eine strukturelle Heuchelei, weil die Angestellten bekenntnishafte Arbeitsverträge unterschreiben, die ehrlicherweise kein freier Bürger einhalten kann.
Um das zu kritisieren, muss man kein Religionsfeind sein. Warum tobt der Streit trotzdem so heftig? Warum fühlen Glaubende sich angegriffen? Weil die Kritik manchmal höhnisch und fundamental-atheistisch ist? Das könnte sein. Vor allem aber, weil wir in einer historischen Übergangszeit leben. »Die Gewässer der Religion fließen ab, und zurück bleiben Sümpfe und Weiher«, prophezeite Friedrich Nietzsche. Das sollte bedeuten, die Religionen würden schwächer und zerfielen in ihre Restbestände. Tatsächlich wächst in Deutschland die Zahl der Konfessionslosen, und immer mehr Christen machen sich den amtskirchlichen Standpunkt nicht mehr zu eigen. Trotzdem beharren die Kirchen auf ihrem Anspruch, für die Mehrheit der Gesellschaft zu sprechen. Sie tun, als würden ihre religiösen Prämissen noch immer von fast allen geteilt.
Читать дальше