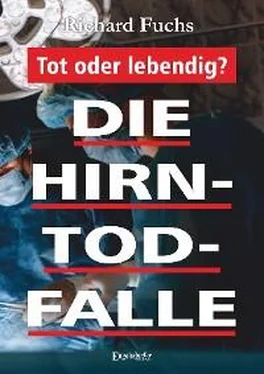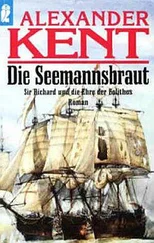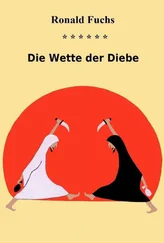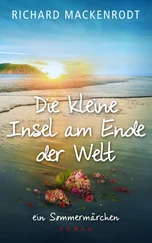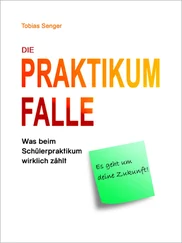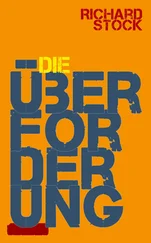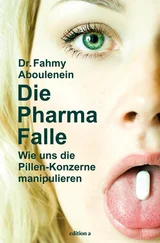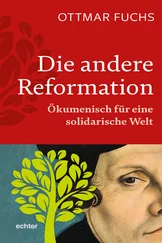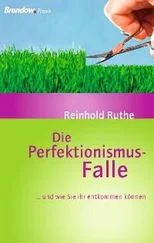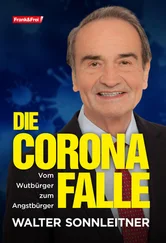Zeitungen machten nach der ersten Operation den Vorschlag, man möge Barnard vor dem Internationalen Gerichtshof des Mordes anklagen, weil er einem Menschen ein lebendes Herz entnommen hatte. Das Konzept des »Gehirntodes« wurde weder nicht verstanden, noch war es akzeptiert und stand im Kreuzfeuer der Kritik. Der Präsident der American Heart Association, Dr. Irvine Page, kritisierte Barnard: »Sie können nicht einfach hergehen und den Leuten die Herzen rausnehmen«, und ein anderer Arzt in Washington: »Ich habe die schreckliche Vision von Leichenfledderern, die mit gezückten Messern um ein Unfallopfer herumschleichen und darauf warten, seine Organe herausschneiden zu können, sobald es für tot erklärt ist.«.43
Der Düsseldorfer Kardiologe und Nobelpreisträger Prof. Dr. Werner Forßmann schrieb: »Die Chancen sind also am allergrößten, wenn das Organ einem gesunden und in voller Lebenskraft stehenden Menschen entnommen wird. Deshalb liegt es im Interesse des Empfängers und des Operateurs, den sterbenden Spender so früh wie möglich für tot zu erklären, um über ihn verfügen zu können.«44 Zu ganz anderen Urteilen kam die FAZ. Die Zukunft dieser neuen Technik sei sehr ermutigend.45 Oder Die Welt: Herztransplantationen seien ein »notwendiges Experiment«, denn die Medizin »verdankt ihren Fortschritt Männern, die sich durch Rückschläge nicht entmutigen ließen. Mit dem Fortschritt ist aber der Mut zum Wagnis und zum Risiko untrennbar verbunden«.46
Bis Barnard, an Arthritis leidend, die Hände kaum noch bewegen konnte, war er an insgesamt 46 Herzübertragungen beteiligt. 1977 griff er erneut zum Skalpell, um einer 25-jährigen Italienerin mit einem zusätzlichen Pavianherzen das Leben zu verlängern. Das Experiment musste scheitern, da sämtliche Xenotransplantationen zuvor auch schon tödlich endeten.
Me too: Rekorde und das vorläufige Ende in den USA
Spätestens aber mit dem Triumph der gelungenen zweiten Transplantation von Philip Blaiberg mit einem Herzen des 35-jährigen farbigen Clive Haupt (1944 – 1968) waren alle Bedenken und Skrupel zerstreut. Die rassistische Regierung Südafrikas machte gute Miene zum bösen Spiel, obwohl bei der zweiten Operation das Herz eines farbigen Afrikaners in die Brust eines Weißen verpflanzt worden war. Barnards Ruhm löste bei amerikanischen Ärzten Neid aus, wie Barnard konsterniert feststellte, und auch einen »Me-too-Effekt«. Bereits drei Tage nach der ersten Herztransplantation – das Ad Hoc Commitee der Harvard Medical School hatte noch nicht seinen »Segen« erteilt – implantierte der New Yorker Adrian Kantrowitz einem zweieinhalbwöchigen weiblichen Baby ein Herz – mit tödlichem Ausgang wenige Stunden später. Das hinderte Kantrowitz vom Maimonides-Krankenhaus in New York nicht daran, sich als erster amerikanischer Transplanteur, gemeinsam mit Barnard, in der USweit ausgestrahlten TV-Show, »Face of the Nation« der CBS feiern zu lassen.
Den überstürzten Eingriff an einem wehrlosen Opfer bezeichnete der Düsseldorfer Kardiologe Forßmann als Mord. In Wirklichkeit aber war es ein Doppelmord, denn das wehrlose Opfer, dem das Herz entnommen wurde, war ein anenzephales neugeborenes Kind. Das sind Kinder, die nur mit Hirnstamm, aber ohne Großhirn geboren werden und spontan atmen können. Sie galten für manche amerikanische Ärzte als tot. Die schlichte und zugleich pragmatische Argumentation, vergleichbar mit der des Harvard Ad-hoc-Berichts, lautete: Angehörige von anenzephalen Kindern werden durch den herbeigeführten Tod entlastet, indem u. a. eine Organspende diesem noch einen Sinn gibt. Da diesen Kindern die »Personalität« von Geburt an fehle, galten sie in den USA als lebende Organbanken. Vorauseilend lieferten hier Ärzte Agumentationen, die später auch den »Hirntod« als Tod des Menschen legitimieren sollten. Dem ersten »Mord« folgten noch viele weitere. Ob vor der Organentnahme von anenzephalen Neugeborenen jeweils der Tod des Stammhirns abgewartet wurde, konnte bei Recherchen einer Arbeitsgruppe nicht immer festgestellt werden. Bei nur 29 von 80 explantierten anenzephalen Kindern war der Hirntod protokolliert worden.47
Einen Monat später zelebrierte Norman E. Shumway aus Palo Alto, der sich schon lange auf Herzimplantationen vorbereitet hatte, seinen ersten Auftritt. Bis Oktober 1968 transplantierte er fünf weitere Herzen. Der Texaner Cooley überbot Shumway mit siebzehn verpflanzten Herzen in acht Monaten. Sein Ziel hatte er damit aber noch nicht erreicht: Am Montagmorgen nach der ersten Operation in Kapstadt hatte er Barnard ein Telegramm geschickt: »Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer ersten Transplantation, Chris. Ich werde bald über meine ersten hundert referieren.«
Insgesamt 66 Herztransplantationen meldeten die Agenturen 1968 aus aller Welt. Vier Fünftel der Patienten starben vor Ablauf eines Jahres. Dann kehrte wieder Ruhe ein. Demotiviert von Misserfolgen, vertagten Herzchirurgen ihre Aktivitäten bis zur Einführung von Cyclosporin A48 der Firma Novartis (damals Sandoz), 1982, das die Abstoßung eines Organs verhindern soll. Als schließlich auch Blaiberg, Barnards zweiter Patient, der bis dahin die längste Überlebenszeit vorzuweisen hatte, im August 1969 einer chronischen Abstoßungsreaktion erlag, wendete sich die Stimmung. Die Transplantationsteams vereinbarten ein weltweites Moratorium, das erst nach 10 Jahren wieder aufgehoben wurde.
Christiaan Barnard 1985: Aktive Sterbehilfe bei eigener Mutter
Während sich Barnard als Vortragsreisender und Preisempfänger einerseits immer noch für die Förderung der Transplantationsmedizin einsetzte, machte er sich andererseits für die Gesundheits-Ökonomie stark. Anlässlich der Preisverleihung an Barnard beim 5. Europäischen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), 1985, sprach er sich für die passive und aktive Sterbehilfe aus. Im Kongressbericht wird er mit den Worten zitiert:
»Ich schäme mich nicht, einzugestehen, dass ich passive Sterbehilfe praktiziert habe. Ich weiß nicht wie oft, ich habe das nicht gezählt; ich schäme mich jedoch nicht, es zu sagen, und bitte niemanden dafür um Vergebung, dass ich zugebe, passive Sterbehilfe praktiziert zu haben. Ich habe sie sogar bei meiner eigenen Mutter angewandt.« Und weiter: »Was ist eigentlich der Unterschied zwischen passiver und aktiver Sterbehilfe? Es ist schwierig, einen echten Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen herauszuarbeiten (…). Ich sehe sehr wenig Unterschied zwischen dem bewussten Akt der Unterlassung, der ausschließlich den Tod bezweckt, oder dem bewussten Akt einer begangenen Handlung, die dem gleichen Ziel dient. (…)
In einigen Ländern kann es für die Familie zu einer enormen finanziellen Belastung werden, wenn man einen Patienten mit allen Mitteln am Leben erhält – eine Belastung, die völlig sinnlos ist. Ich glaube also, dass Sie mir zustimmen werden, dass es für die aktive Sterbehilfe durchaus einen Bedarf gibt. Wir brauchen sie. (…) Ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn die Familie allein die Entscheidung trifft. Ich finde, dass die Familie damit unnötig belastet wird, und ich halte es auch für falsch, mit ihr den Augenblick der aktiven Sterbehilfe zu bestimmen. Das ist etwas, was allein von den Ärzten entschieden werden sollte, und die Injektion sollte gegeben werden, ohne dass die Familie oder der Patient weiß, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo der Arzt eine Spritze gibt, die es dem Patienten erlauben wird, zu sterben.«
1985: Hochkonjunktur für Zyankali in Deutschland
1985 war die Zeit, als in Deutschland Zyankali Hochkonjunktur hatte und Millionengewinne versprach. Im selben Jahr wurde die Frage offiziell gestellt, ob der § 216 des Strafgesetzes (»Tötung auf Verlangen«) novelliert werden sollte. Ausgelöst durch Gerichtsurteile hatte der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages zu diesem Zweck Experten geladen.49 Es lag sogar ein Änderungsentwurf für § 216 StGB vor, der ein Jahr später publiziert wurde. Geladen waren u. a. auch die damaligen Protagonisten der aktiven Sterbehilfe, Hans Henning Atrott, Präsident der DGHS, der später verurteilt wurde, Prof. Dr. Julius Hackethal (1921 – 1997) (ging später auf Distanz zur aktiven Sterbehilfe) und Prof. Dr. Herbert Jäger (1928 – 2014) von der Humanistischen Union. Letzterer verstieg sich ganz im Sinne von Barnard zu dem Vorschlag: »Ernstlich zu überlegen ist, ob in Fällen, in denen eine tödliche Erkrankung einen endgültigen, durch Heilbehandlung nicht mehr zu beeinflussenden Verlauf genommen hat, der Arzt nicht sogar zu Maßnahmen indirekter, auch lebensverkürzender Sterbehilfe verpflichtet sein soll, wenn der Patient sie nicht ausdrücklich abgelehnt hat.«50 Analog zu Jägers heimtückischem Vorschlag ist die gesetzliche Widerspruchslösung bei der Organtransplantation zu sehen. Man könnte sie auch als eine Art Falle betrachten.
Читать дальше