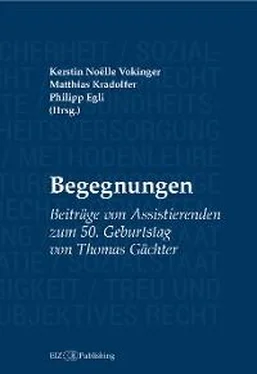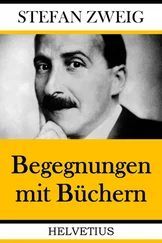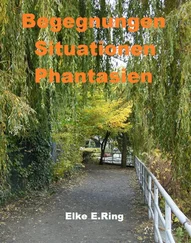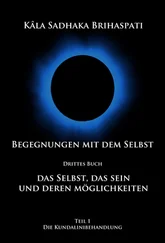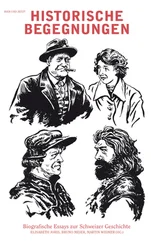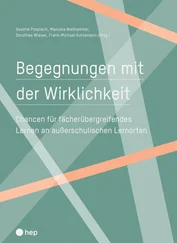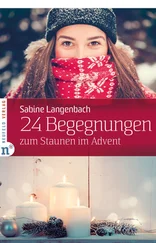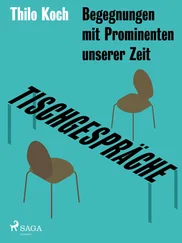Da die Pflege und Betreuung von Menschen mit gesundheitsbedingten Einschränkungen nicht einfach eingestellt oder aufgeschoben werden kann, braucht es ergänzend Entlastungsangebote, so dass informell pflegende und betreuende Personen, egal ob noch im Erwerbs- oder bereits im Pensionsalter, entlastet werden und sich erholen können. Auch wenn Betreuung und Pflege nicht immer eine Bürde sondern auch eine schöne und erfüllende Aufgabe sein kann, benötigt jeder Mensch einmal eine Erholungspause oder muss im eigenen Krankheitsfall die Gewissheit haben, dass die Versorgung ihres Angehörigen sichergestellt ist. Solche Entlastungsangebote müssen sowohl einfach verfügbar als auch erschwinglich sein.
Die Verbesserung der Situation informell pflegender und betreuender Personen muss also auf verschiedenen Ebenen angegangen werden.
In der Juristerei kommt den Definitionen eine wichtige Bedeutung zu. Im Bereich der Angehörigenpflege wird die Problematik der fehlenden Definition von Begriffen besonders deutlich. Was umgangssprachlich als «Angehörige» bezeichnet wird, existiert im Recht nicht. «Angehörige» ist kein juristischer Begriff, weder im Sozialversicherungs- noch im Familienrecht. Sind damit Verwandte gemeint? Verwandte in auf- und absteigender Linie oder in Seitenlinien? Sind damit nur Blutsverwandte gemeint oder auch angeheiratete? Gehört das stabile Konkubinat auch dazu? Auch wenn wir uns vom Angehörigen entfernen würden und stattdessen von der (informell oder unentgeltlich) «pflegenden Person» sprechen, würde das kaum helfen. Dem sogenannten Pflegesubjekt kommt im Sozialversicherungsrecht nur eine untergeordnete praktisch Bedeutung zu: In der obligatorischen Krankenpflegeversicherung werden nur die Kosten entschädigt, welche durch einen anerkannten Leistungserbringer erbracht werden (Art. 35 Abs. 1 KVG). In der Regel sind pflegende Angehörige keine anerkannten Leistungserbringer, da sie die Anforderung von Art. 35 ff. KVG nicht erfüllen, weshalb ihre Leistungen nicht von den Sozialversicherungen vergütet werden. [20]
Die Problematik der fehlenden Definitionen zieht sich weiter: Auch die Pflegehandlung ist nicht klar gesetzlich definiert. Art. 7 KLV umschreibt lediglich den Leistungsbereich der ambulanten Krankenpflege oder der Pflege im Pflegeheim. Je nachdem, ob es sich um Grund- oder Behandlungspflege handelt, wird die Vergütung unterschiedlich gehandhabt. So entschädigt die Unfallversicherung nur Leistungen der Behandlungspflege, nicht aber der Grundpflege an und für sich. Nur die akzessorische Grundpflege, also grundpflegerische Verrichtungen, die mit der Durchführung behandlungspflegerischer Massnahmen nötig sind – wie etwa die grundpflegerische Körperpflege nach behandlungspflegerischer Darmentleerung – werden von der Unfallversicherung vergütet. [21]
Ein weiteres Problem ist die gänzlich fehlende Definition von Hilfe und Betreuung bzw. deren weitgehende Absenz im Sozialversicherungsrecht. Die erfolgreiche Pflege einer pflegebedürftigen Person erschöpft sich nicht in der blossen Durchführung der sozialversicherungsrechtlich abgedeckten Pflegehandlungen. Im Zusammenhang mit der Pflege sind ganz viele weitere Handlungen, je nach Art der gesundheitlichen Einschränkung, Alter, Lebensumstände etc. der pflegebedürftigen Person notwendig, um ihren Gesundheitszustand zu erhalten, zu verbessern oder ihr eine würdevolle Begleitung bis zum Tod zu ermöglichen. Dies fängt bei haushälterischen Leistungen an, erstreckt sich über organisatorische und administrative Aufgaben bis hin zum simplen «für jemanden da zu sein». Dieser Aspekt findet im Sozialversicherungsrecht kaum Beachtung.
Im Synthesebericht wurden die Resultate einer Bevölkerungsbefragung publiziert, mit den Unterstützungsaufgaben, die betreuende Angehörige übernehmen: Dazugehört Da-Sein, Beobachten, Finanzen und Administration, Hilfe im Alltag, Koordinieren und Planen, Aufpassen, medizinische Hilfe, Betreuen und Pflegen. [22]Davon ist wenig bis gar nichts von den Sozialversicherungen abgedeckt. Es gibt gewisse Geldbeträge, wie etwa die Hilflosenentschädigung, der Assistenzbeitrag oder unter Umständen die Ergänzungsleistungen, welche für solche Hilfs- und Betreuungshandlungen verwendet werden können.
Dabei sind genau solche (im Sinne des Sozialversicherungsrecht) nicht-pflegerischen Handlungen sehr wichtig, um Pflegebedürftigkeit zu verhindern, zu mildern und Heimeintritte zu vermeiden. Der Bedarf an Betreuungsleistungen gerade bei älteren Personen ist gross. Auch ältere Personen, die keine körperlichen oder kognitiven Einschränkungen haben, können einen Betreuungsbedarf aufweisen. Eine bedarfsgerechte Betreuung kann sich positiv auf die Gesundheit der betreuten Person auswirken und Heimeintritte präventiv verhindern, was wiederum Kosten spart, denn die Kosten für einen Heimaufenthalt sind i.d.R. höher als für die Pflege und Betreuung zu Hause. [23]
Insbesondere bei an Demenz erkrankten Menschen, fallen zu Beginn der Erkrankung oft vielmehr betreuerische als pflegerische Aufgaben im sozialversicherungsrechtlichen Sinn an, weshalb diese länger zu Hause betreut und gepflegt werden könnten, was meisten günstiger wäre als die Unterbringung in einer Alters- und Pflegeeinrichtung. [24]
Zwar sind solche Angebote der Betreuung vorhanden und einkaufbar, jedoch werden sie von den Sozialversicherungen, wenn überhaupt, nur ungenügend gedeckt. Die betreuungsbedürftige Person muss diese Leistungen selbst einkaufen, was in viele Fällen schlicht und einfach finanziell nicht möglich ist. Mitunter ein Grund, weshalb Betreuungsleistungen informell durch Familienmitglieder, Verwandte und Bekannte erbracht werden. [25]
Ein weiteres grosses Problem ist das schweizerischen Sozialversicherungssystem als solches, welches nicht konzeptuell entworfen wurde, sondern organisch zu einem regelrechten «Versicherungsdschungel» gewachsen ist: Bereits vor dem ersten Weltkrieg wurden die ersten Sozialversicherungen geschaffen und aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, kamen immer mehr Versicherungen, ausgestaltet als Einzelgesetze hinzu. So ist ein unübersichtliches und teilweise auch lückenhaftes Sozialversicherungssystem entstanden, welches selbst für Experten nicht immer leicht zu durchschauen ist. Für jede einzelne Leistung müssen genau die Anspruchsberechtigung und die Voraussetzungen für den Leistungsbezug abgeklärt werden. [26]Es kommt deshalb immer wieder vor, dass Menschen durch die Maschen des sozialen Netzes fallen.
Die Finanzierung der Langzeitpflege ist «verzweigt und für das Verständnis sehr anspruchsvoll». [27]Auch der Bund hat dies als Problem erkannt, gerade in Bezug auf pflegende Angehörige. [28]
Die Politik wurde auf die Thematik der Überalterung, der steigenden Anzahl pflegebedürftiger Personen und der fehlenden sozialversicherungsrechtlichen Absicherung informell pflegender Personen aufmerksam. Der Bundesrat hat mit dem «Aktionsplan für betreuende und pflegende Angehörige» eine Grundlage geschaffen, um die Rahmenbedingungen für betreuende und pflegende Angehörige zu verbessern. [29]Die Umsetzung des Aktionsplans wird vom Förderprogramm «Entlastungsangebote für betreuende Angehörige 2017–2020» ergänzt. Dieses Förderprogramm hat die Situation von betreuenden Angehörigen erforscht und Grundlagen geschaffen, damit die Angebote für betreuende Angehörige bedarfsgerecht weiterentwickelt werden können. Unter anderem weist der Bericht darauf hin, dass je umfangreicher der Betreuungsbedarf ist, desto grössere die Gefahr ist, dass ein Haushalt mit Angehörigenbetreuung in die Armut abrutscht und dass Angehörige, die ihre Erwerbstätigkeit wegen der Übernahme von Betreuungsaufgaben aufgeben, besonders armutsgefährdet sind. [30]Deshalb ist besonders wichtig, die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung zu verbessern.
Читать дальше