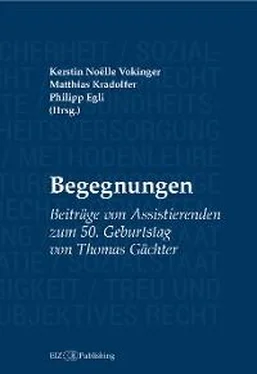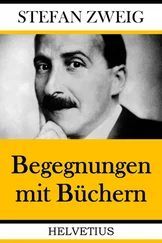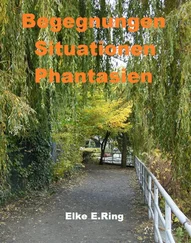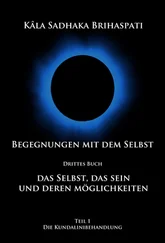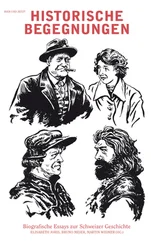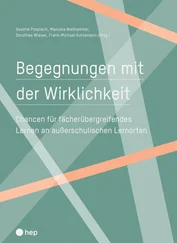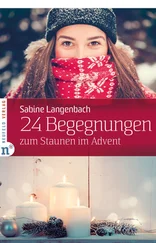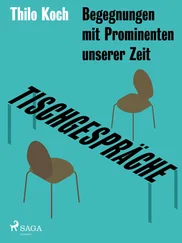Begegnungen
Здесь есть возможность читать онлайн «Begegnungen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Begegnungen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Begegnungen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Begegnungen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Begegnungen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Begegnungen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
29 Ch. Kopf, Wohlfahrtseinrichtungen in der Privatwirtschaft, NZZ vom 21. April 1936 (Nr. 677), Blatt 5. ↵
30 Votum SR Gottfried Keller, AB SR 1931 S. 66. ↵
31 Art. 84 ZGB; August Egger, Zürcher Kommentar, Einleitung und Personenrecht, 2. A., Zürich 1930, Art. 84 N 2. ↵
32 Egger, Rechtsgutachten (Fn. 14), S. 11. ↵
33 Siehe Wirz (Fn. 2). ↵
34 Wirz (Fn. 2), S. 250, bezogen auf die Einführung von Rechtsansprüchen auf Geldleistungen; weiterführend Thomas Koller, Privatrecht und Steuerrecht, Bern 1993. ↵
35 Art. 6 ZGB. ↵
36 Vgl. dazu aus aufsichtsrechtlicher Sicht BGE 75 I 269. ↵
37 Wilhelm Schönenberger, Abänderung von Stiftungssatzungen nach schweizerischem Zivilrecht, ZSR 1947, S. 41 ff.; Egger (Fn. 10), S. 629a. ↵
38 Schönenberger (Fn. 37), passim. ↵
39 KS 1947 (Fn. 22). ↵
40 Vgl. zum Verhältnis von Sozialrecht und Steuerrecht z.B. Hans Zacher, Das Sozialrecht im Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft, Bayerischer Wohlfahrtsdienst 1/1979, S. 1 ff., 3. ↵
41 Vgl. Christopher Howard, The Hidden Welfare State, Tax Expenditures and Social Policy in the United States, Princeton 1997 (als Gegenbegriff zum «visible welfare state»). ↵
42 Max Huber, Zum Geleit, in: Wirz (Fn. 2), S. VII. ↵
43 Die Rechtsgrundlagen für die Spezialgesetzgebung sah Egger mit Bezug auf Stiftungen in Art. 64 aBV und Art. 84 ZGB, siehe Egger, Rechtsgutachten (Fn. 14), S. 11. ↵
44 Entsprechende Regelungen gab es auch für die Kommanditaktiengesellschaft, die GmbH und die Genossenschaft, nicht aber für Personengesellschaften und Einzelunternehmen, vgl. F. Wolfhart Bürgi, Zürcher Kommentar, Die Aktiengesellschaft, Rechte und Pflichten der Aktionäre (Art. 660-697), Zürich 1957, Art. 673 N 8. Nicht eingegangen wird nachfolgend auf die Regelungen in der damaligen Fabrikgesetzgebung, vgl. Art. 78 ff. des Bundesgesetzes betreffend die Arbeit in den Fabriken vom 18. Juni 1914 (BBl 1914 III 567 ff.). ↵
45 Alfred Siegwart, Zürcher Kommentar, Die Aktiengesellschaft, Allgemeine Bestimmungen, Zürich 1945, Einl. N 220; ferner Walter R. Schluep, Mitbestimmung? Bemerkungen zum Verhältnis von Aktiengesellschaft, Unternehmen und öffentlichem Interesse, in: Max Boemle et al. (Hrsg.), Lebendiges Aktienrecht, FS Wolfhart Friedrich Bürgi, Zürich 1971, S. 311 ff. ↵
46 Eugen Huber, Bericht über die Revision der Titel 24 bis 33 des schweizerischen Obligationenrechts, Dem schweizerischen Justiz- und Polizeidepartement erstattet im März 1920, S. 112. ↵
47 Das Gesetz erlaubte, dass das Stiftungsvermögen in einer Forderung an die Gesellschaft bestand (Art. 673 Abs. 3 aOR). ↵
48 Art. 673 Abs. 1-4 aOR in der Fassung vom 18. Dezember 1936 (in Kraft bis 30. Juni 1958); dazu eingehend die Kommentierung von Bürgi (Fn. 44). Die Norm wurde später ins Arbeitsrecht überführt, vgl. Art. 343bis aOR (in der Fassung ab 1. Juli 1958 bis 31. Dezember 1971). ↵
49 Bürgi (Fn. 44), Art. 673 N 7, von dort auch das Zitat im Haupttext (Hervorhebung im Original). ↵
50 BGE 72 II 293 E. 4 S. 303 f. ↵
51 Otto K. Kaufmann, Das Recht auf Dividende, St. Gallen 1947, S. 23 ff.; siehe auch Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996, S. 488 f. ↵
52 BGE 72 II 293 E. 4 S. 306. ↵
53 Wolfhart F. Bürgi, Wandlungen im Wesen der juristischen Person, in: Staat und Wirtschaft, FS Hans Nawiasky, Einsiedeln/Zürich/Köln 1950, S. 245 ff. ↵
54 Schluep (Fn. 45), S. 325 f. ↵
55 Votum SR Tschudi, AB SR 1957 S. 235; in der Rechtstheorie ist mitunter gar von einem «regulatorischen Trilemma » die Rede, da mit Politik, Recht und Wirtschaft (mind.) drei Funktionsbereiche aufeinanderprallen, weiterführend Gunther Teubner, Das regulatorische Trilemma, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 13 (1984), S. 109 ff. ↵
56 Philipp Egli/Martina Filippo, Berufliche Vorsorge: Stösst die Logik an ihre Grenzen?, NZZ vom 11. Juni 2020, S. 7, zu den gesetzlich bedingten Pensionierungsverlusten. ↵
57 Vgl. zum «gesellschaftspolitischen» Subsidiaritätsprinzip Thomas Gächter, Grundstrukturen des schweizerischen Rechts der Sozialen Sicherheit, ZSR 2014 II, S. 5 ff., 60 ff. ↵
58 Das BVG ist «Rahmengesetz», vgl. Art. 6 und 49 BVG; zum «Werk der Sozialpartner» vgl. statt vieler: Jürg Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, S. 600. ↵
59 August Egger, Über die Rechtsethik des schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2. A., Zürich 1950. ↵
60 Eugen Huber, System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechtes, Bd. 4, Basel 1893, S. 300. ↵
61 Walter Haller/Alfred Kölz/Thomas Gächter, Allgemeines Staatsrecht, 6. A., Zürich/Basel/Genf 2020, Rz. 480; allgemein: Richard Bäumlin, Der schweizerische Rechtsstaatsgedanke, ZBJV 1965, S. 81 ff.; Josef Esser, Juristisches Argumentieren im Wandel des Rechtsfindungskonzepts unseres Jahrhunderts, Heidelberg 1979, S. 5. ↵
62 Haller/Kölz/Gächter (Fn. 61), Rz. 87. ↵
63 Wenig tröstlich wird sein, dass Paradoxien in der modernen Gesellschaft unvermeidlich sind, vgl. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1997, S. 1144. ↵
64 Ausschnitte aus: Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sezuan, Epilog, zit. nach Bertolt Brecht, Gesammelte Werke, Bd. 4, Frankfurt a.M. 1967, S. 1607; für einen möglichen Ausweg vgl. Gächter (Fn. 57), S. 63, wonach das Versicherungsprinzip (Sozialversicherung!) eine «geradezu modellhafte Verbindung von Solidarität und Subsidiarität» sei. ↵
Angehörigenpflege –
Jetzt muss etwas getan werden!
Martina Filippo
Inhalt
1 Wie alles begann
2 AusgangslageÜberalterung der Gesellschaft Pflegekräftemangel Zwischenfazit
3 ProblemeAbsicherung der informell pflegenden Person Fehlende Definitionen «Versicherungsdschungel»
4 Neuste Entwicklungen
5 Braucht es eine Pflegeversicherung?
Wie alles begann
Die meisten Studierenden der Rechtswissenschaft zieht es nach Abschluss des Studiums ins Anwaltspraktikum oder sie schreiben eine Doktorarbeit. Ich hatte andere Pläne: Seit meinem fünften Lebensjahr tanzte ich Ballett. Da ich meine Leidenschaft zum Beruf machen und der nächsten Generation diese Leidenschaft für die Bühne weitergeben wollte, absolvierte ich nach dem Studium eine Ausbildung zur Ballett- und Tanzpädagogin an der «Accademia Teatro alla Scala» in Mailand, Italien. Die Ausbildung dauerte zwei Jahre und war eine Mischung aus Präsenzunterricht für die Praxis und Theorie von zu Hause aus. Da sich die Ausbildung an Berufstätige richtete, war ich nicht zu 100% ausgelastet, weshalb ich eine Teilzeitstelle als Juristin suchte. Ich war jung und naiv und glaubte, Teilzeitstellen für Juristen würden auf der Strasse liegen. Aber weit gefehlt! Damals waren Teilzeitstellen generell rar und für Juristinnen und Juristen frisch ab Studium praktisch inexistent. Es hagelte Absage um Absage, z.T. mit dem Hinweis, dass ich für eine Vollzeitstelle zu einem Gespräch eingeladen werden würde, nicht aber für eine Teilzeitstelle. Anfangs scherzte ich, dass ich doktorieren würde, falls ich keine Teilzeitstelle finden sollte. Irgendwann wurde aus Spass Ernst. Eigentlich wollte ich das Anwaltspraktikum absolvieren und die Anwaltsprüfung bestehen, um dann als Anwältin in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten; selbstverständlich in Teilzeit, damit ich auch noch Ballett unterrichten könnte. Aber es kommt nicht immer alles so, wie man es sich vorstellt…
Nach einem Jahre des erfolglosen Bewerbens realisierte ich, dass dies ein hoffnungsloses Unterfangen war. Also informierte ich mich über das Doktorat. Leider war mein Lizenziat II nicht so brillant und ich war ein Fall von §10 Abs. 2 der Promotionsverordnung der Universität Zürich. Ich musste mir ein Fakultätsmitglied suchen, welches sich bereit erklären würde, meine Betreuung zu übernehmen. Strategisches Handeln war also angezeigt. Ich erinnerte mich mit grosser Freude an die Vorlesungen im Sozialversicherungsrecht, welche von Prof. Thomas Gächter gelesen wurden und bei mir auf grosses Interesse stiessen. Sozialversicherungsrecht war damals ein Wahlfach und wir waren dementsprechend wenige Studierende, die diese Vorlesung besuchten. Ich gehörte zu denjenigen Studierenden, die die Prüfungsfächer nach Interesse (und nicht nach möglichst geringem Lernaufwand) aussuchten. Und so hatte ich eine mündliche Prüfung bei Thomas Gächter im Sozialversicherungsrecht. Wir waren damals drei (!) Studierende, die diese Prüfung ablegten und ich war die einzige Frau (!). Ich schnitt ziemlich gut ab, was mir die Hoffnung gab, dass Thomas Gächter sich vielleicht – auch nach zwei Jahren – an mich erinnern könnte und sich bereit erklären würde, mein Doktorvater zu werden. Nervös griff ich zum Telefonhörer, bereit meinen zuvor auswendig gelernten Text vorzutragen und was sagte Thomas Gächter, nachdem ich meinen Namen gesagt habe? «Auf Sie habe ich gewartet.»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Begegnungen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Begegnungen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Begegnungen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.