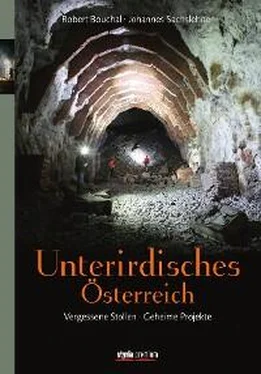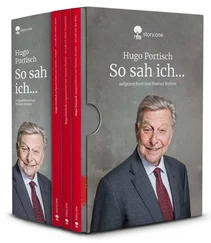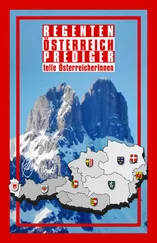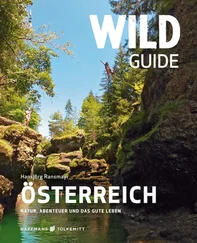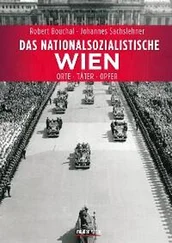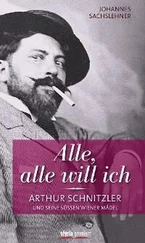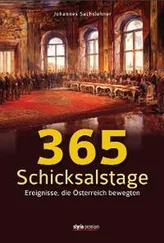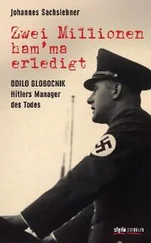„Lost place“ in der Unterwelt von Klagenfurt: der Miklinstollen.
In einem ersten Schritt erarbeitet er daher zunächst ein standardisiertes „Pflichtenheft“ für das anstehende Evaluierungsverfahren, das im Juni 2001 vorliegt. Darin entwickelt er insgesamt vier Kategorien zur „Prioritätenreihung“ des Gefährdungsgrades:
Priorität 1: „Die Stollenröhre ist ungenügend oder nicht gesichert, das Gebirge ist nicht standfest. Sicherungsarbeiten sind notwendig. (…) Auf Grund der individuellen Befundung ist Gefahr in Verzug nicht auszuschließen.“
Priorität 2: Stollenzustand wie bei Priorität 1, aufgrund der „individuellen Befundung des Stollensystems ist Gefahr in Verzug jedoch nicht gegeben“.
Priorität 3: „Das Gebirge ist ausreichend standfest oder durch Ausbau dauerhaft gesichert. Sicherungsarbeiten sind nur in geringem Umfang oder gar nicht notwendig. Regelmäßige (z. B. jährliche) Kontrollbefahrungen sind jedoch notwendig.“
Priorität 4: „Nicht überbaute Stollenobjekte, keine Nutzung der Geländeoberfläche, standfestes Gebirge. Mit Ausnahme der (allfälligen) Anbringung von Absperrgittern oder Gittertüren oder einer anderen geeigneten Mundlochsicherung sind keine weiteren Sicherungsarbeiten notwendig. Ausschluss von Tagbrüchen, keine erkennbaren Gefahren, keine weiteren Kontrollbefahrungen notwendig.“
„Sicherungsbedürftig“ sind, so Webers klares Resümee, „jene Stollen- oder Streckenabschnitte von Stollenobjekten“, die „mit Priorität 1 oder Priorität 2 behaftet sind“.
Aufgrund der Vielzahl der Stollenanlagen kommt man im Juli 2001 mit Leopold Weber überein, insgesamt sechs Sachverständige für diese „systematisierte Erstevaluierung“ zu benennen – zusammengefasst in Bundesländergruppen und ausgestattet mit entsprechenden Vollmachten der BIG, übernehmen diese Aufgabe sechs Zivilingenieure, allesamt Absolventen des Instituts für Markscheidewesen, Bergschadenkunde und Geophysik der Montanuniversität Leoben. Die Erhebungsergebnisse der sechs Fachleute werden, so der Plan, durch abschließende gutachterliche Stellungnahmen von Leopold Weber ergänzt, der darin auch die jeweilige Priorität benennt und eventuelle Sicherungsmaßnahmen empfiehlt. Wichtige erste Schritte zur Risikoverminderung sollen unkompliziert und rasch erfolgen: Die Zivilingenieure sind ermächtigt, Firmen vor Ort mit dem Anbringen von „wirksamen Verschlüssen“ der Mundlöcher zu beauftragen, damit soll verhindert werden, dass neugierige Jugendliche die Stollen weiter als Abenteuerspielplätze nutzen.
Die Arbeit beginnt also an allen Ecken und Enden. Zu bestimmten Objekte versuchen Karl Lehner und seine Gutachter, von Gemeinden und Bezirkshauptmannschaften „Bestandsunterlagen“ wie alte Baupläne und Akten zu bekommen, und lernen daraus vor allem eines: Gemeindeämter sind keine Archive. Ratloses Achselzucken ist eine häufige Antwort; Originalunterlagen aus den letzten Kriegsjahren fehlen in vielen Fällen überhaupt; findet man tatsächlich noch einen Plan, so handelt es sich meist um einen Projektierungsplan, der mit dem tatsächlichen Stand der Ausführung eines Stollens nur mehr wenig gemeinsam hat. Bleibt noch die Hoffnung, von noch lebenden „Zeitzeugen“ handfeste Informationen und Hinweise oder auch nur Anhaltspunkte zu erhalten – das ist manchmal tatsächlich der Fall, manchmal lässt die Präzision der Erinnerung zu wünschen übrig: Erinnertes und Realität vor Ort passen nach knapp sechs Jahrzehnten nicht mehr exakt zusammen.
Unterstützung kommt von Martin Hübner. „Wir gewannen sehr bald den Eindruck“, so erzählt er heute, „dass es in den Ministerien teilweise zu einer Art Überreaktion gekommen war, was sich darin manifestierte, dass so gut wie jedes unterirdische Gebilde, von dem man wusste – oder vielleicht nur annahm –, dass Menschen während des Zweiten Weltkriegs darin Zuflucht gesucht haben, in die Liste aufgenommen wurde. So gelangte einerseits auch eine Vielzahl von Stollen oder stollenähnlichen Gebilden in das Gesetz, die schon lange Zeit vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, ja selbst vor dem, Anschluss‘, existierten. Das betraf z. B. vier ehemalige Bergwerksstollen im Großraum Waidhofen an der Ybbs, einen weiteren in Hallein. Andererseits wurden auch ehemalige Stollen einer Rüstungsproduktion, die auf dem Areal eines dem damaligem Eigentümer im Jahr 1943 entzogenen Zementwerkes in Ebensee gegraben worden waren, mit in das Gesetz aufgenommen, obwohl der entsprechende Betrieb schon im Jahr 1951 im Rahmen eines Rückstellungsvergleiches samt den errichteten Stollen an den früheren Eigentümer zurückgegeben wurde und dieses Zementwerk auch heute noch betrieben wird und im Eigentum derselben Unternehmerfamilie steht.“ Nach ebenso mühsamen wie umfangreichen Recherchen gelingt es der BIG tatsächlich zu beweisen, dass manche Stollen lange vor der Zeit des Dritten Reiches errichtet worden sind und deshalb keinesfalls „Deutsches Eigentum“ darstellen können. Das OGH-Urteil von 1997 könne daher eindeutig nicht darauf angewendet werden.
Besonders bemerkenswerte Fälle dieser Art sind etwa acht im Stadtgebiet von Linz gelegene Keller, deren Anlegung zumeist auf das späte 19. Jahrhundert zurückgeht und in den sogenannten „Linzer Sanden“ besonders einfach war. Diese Keller westlich der Linzer Altstadt, die sich kilometerlang im Untergrund erstrecken, stehen auch heute oftmals noch im Eigentum von Nachfahren der seinerzeitigen Errichter, wie etwa der traditionsreiche Cembrankeller in der Kellergasse im Eigentum der Weinhändlerfamilie Cembran – es gelingt sogar, ein Foto von der Eröffnung des Kellers im Jahre 191 aufzutreiben. Weiters kann die BIG zeigen, dass der Kapuzinerkeller im Eigentum des Kapuzinerstiftes steht und der Aktienkeller im Eigentum der Brau AG. Auch der „Lieblingsbunker“ der Linzer im Zweiten Weltkrieg, der Limonikeller, in dem an die 10.000 Menschen Platz finden konnten, ist älteren Ursprungs.

Luftschutzstollen in Linz: Diverse Funde vermitteln einen authentischen Eindruck von der Realität des Krieges.
Mit der ersten Novelle zum Bundesimmobiliengesetz 2003 werden daher 34 der ursprünglich übertragenen Stollen wieder aus dem Gesetz und damit aus dem Verantwortungsbereich der BIG herausgenommen, darunter auch solche Kaliber wie der Rosenmayrstollen in Hallein. Neben den Stollen, die schon von der Errichtungszeit her nichts mit dem Dritten Reich zu tun haben können, werden auch nachweislich „ersessene“ Stollen aus dem Gesetz entfernt, weiters auch Stollenanlagen, die während des Zweiten Weltkriegs „eigenverantwortlich“ durch Städte und Gemeinden angelegt worden sind und in deren Eigentum stehen.
Auch die erwähnte riesige Stollenanlage A in Ebensee (siehe dazu das Kapitel „Das unterirdische Amphitheater“) wird nach mehrmonatiger Korrespondenz mit dem Firmenanwalt des Zementwerkes, der der BIG historische Unterlagen zum Rückstellungsvergleich sendet und so nachweist, dass die Stollen dem Zementwerk gehören, aus dem Gesetz gestrichen.
Eliminiert werden nicht zuletzt ehemalige Bergwerksstollen und – als Kuriosum – auch einige Stollen, die von Kraftwerksbetreibern errichtet worden sind.
Gleichzeitig geht es bei anderen Stollenanlagen bereits mit den Befundungen los und prompt zeichnen sich erste Schwierigkeiten ab. So auch beim Objekt OÖ 020, dem gewaltigen unterirdischen Labyrinth in St. Georgen an der Gusen, von dem man weiß, dass hier dringend Handlungsbedarf besteht – noch ahnt niemand, dass es zum größten und schwierigsten Fall des BIG-Underground-Teams werden wird.
Читать дальше