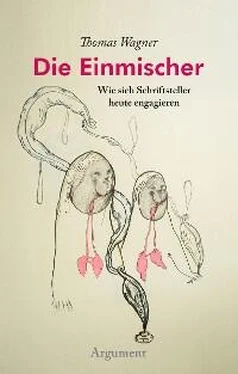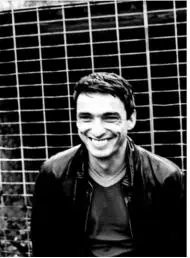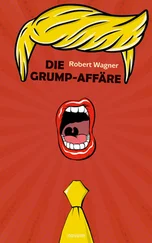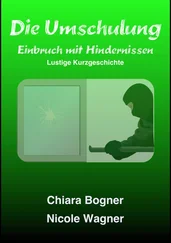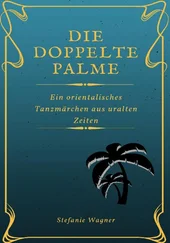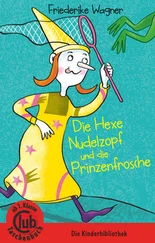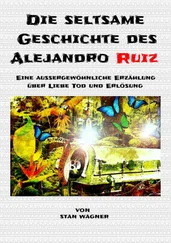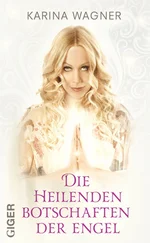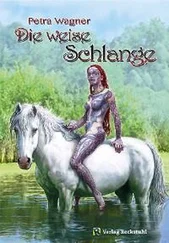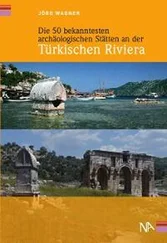Das Hinfahren hat die Sache kompliziert gemacht.
Da erzählt eine Frau, die man sehr mag und die bei ihrem Militärdienst in der israelischen Armee ein Peace-Zeichen um den Hals hatte, was sie da so erlebt hat. Und man sagt sich: Okay, die ganzen Debatten, die in Deutschland so stattfinden, bilden nicht ab, was die da gerade erzählt. Es klingt quietistisch, aber die Schnelligkeit, mit der Antideutsche und andere Deutsche zu einer Position kommen, die sie dann relativ faktendicht halten können, ist mir verdächtig.
Geht es am Ende nicht darum, dass Juden überall auf der Welt so wenig was Besonderes sind wie heute in New York?
Die pragmatische Frage ist damit nicht geklärt. Ich spreche mal in einem Gleichnis: Eine schnelle Kritik an der DDR ist die Kritik an der Stasi. Die teile ich. Warum? Die einzige Rechtfertigung für die Stasi ist: Die brauchen wir, sonst bricht das Ding zusammen. Es ist trotzdem zusammengebrochen, also entfällt leider die Rechtfertigung. Wenn mir jemand dartun kann: Die Leute müssen beschnüffelt werden, sonst bricht der Sozialismus zusammen, leuchtet mir das in gewissen Grenzen ein. Warum sollen immer nur die anderen eine Werkspolizei haben? Ich habe kein Problem mit Repression, die ihren Zweck erfüllt. Wenn sie den nicht erfüllt, müssen wir anders nachdenken. Für Maßnahmen der DDR gilt ähnlich wie für Maßnahmen einer israelischen Regierung: Wenn sie das Land schützen, bin ich dafür; wenn nicht, dagegen. Daraus folgt auch: nicht um jeden Preis. Wenn jemand sagt: Einer geht jetzt im Auftrag von Ulbricht nach Washington und zündet dort eine Atombombe, damit die DDR erst mal eine Atempause hat, bin ich nicht dafür. Es geht eben auch um angemessene Mittel. Ich meine: Stasi-Kritik bitte politisch und nicht moralisch und genauso Israel-Kritik bitte politisch und nicht moralisch. Politisch heißt immer: konkrete Situation, Alternativen. Und nicht: Weltanschauung, Foto und dann Scharping, also Bombardierungen.
Noch einmal zurück zu Ihrem erweiterten Wirkungskreis. Sie sind seit kurzem nicht mehr nur in popkulturellen und politischen Kreisen bekannt, sondern auch beim gewöhnlichen Gymnasiallehrer mit Zeit-Abo . Welche Konsequenzen hat das für Sie?
Ich frage mich natürlich schon ein bisschen, ob es mein Job oder Fluch ist, als ein extrem billiger, extrem trashiger, extrem unzulänglicher Gesamt-West-Hacks ab und zu mal auf Umfragen antworten zu dürfen wie: War die DDR vielleicht doch ganz gut? Solche Umfragen erreichen mich schon. Das Schöne ist: »Du bist ja hier der Trash-Hacks!«, das kommt immer nur vom Trash-Heiner-Müller. Ich bekomme diesen Vorwurf nur aus einer sich selbst als links verstehenden Ecke. Die heute Rechten oder die in der Nähe der Zeitung Die Zeit sagen eher so Sachen wie: Ich hab mal kurz auch Marx gelesen … und dann hab ich die Bände alle verkauft, und das war, glaub ich, ein Fehler, die verkauft zu haben und so weiter.
Ich besetze momentan die Stelle von dem Menschen, den man zu den und den Themen anruft. Wenn meine liebe FAZ eine Serie zum Krisenkram macht, werde ich angerufen, wenn das Wort Verstaatlichung vorkommt. So wie ich angerufen werde, weil ein englischer Science-Fiction-Autor gestorben ist. Diese ganze Pressescheiße funktioniert über Zuständigkeiten, die in irgendwelchen Köpfen imaginiert werden. Da bleibt hängen: Der redet in dem Alexander-Kluge-Film Nachrichten aus der ideologischen Antike eine Stunde lang über Marx. Wenn dann eine Glosse zu einem neu aufgetauchten Marx-Foto gebraucht wird, rufen die eher mich an als einen anderen.
Die interessante Frage wäre: Wird man zuständig für das skurrile Wissen des Sozialismus oder darüber hinaus zu so etwas wie Sachfragen vernommen? Der kritische Intellektuelle hat keinen Wert mehr, der über den Exotenwert des scientologischen Schauspielers oder vegetarischen Handballstars hinausgeht. Aber die Rolle des Experten der Rote-Mützen-Sekte im ökumenischen Konzert der komischen Sekten ist okay. Denn selbst da könnte einmal jemand sagen: Dieser Zeuge Jehovas da ist eigentlich ganz vernünftig – das hätte ich gar nicht gedacht von den Zeugen Jehovas.
Haben Sie den Eindruck, dass Ihre politische Resonanz mit dem Bekanntheitsgrad gestiegen ist?
Auf ein Spiegel -Interview hin haben sich Leute bei mir gemeldet, die reale politische Arbeit machen. Das war eine Sternstunde für mich. Wir standen erst einmal relativ hilflos voreinander, weil ich nur sagen konnte: Wenn euch was einfällt, gerne. Sie sagten Sachen wie: Wir haben die Intellektuellen und die Kulturleute nicht auf unserer Seite. Da habe ich geantwortet: Fragt halt.
Es war unglaublich schön, mit diesen Leuten aus politischen Organisationen, die tatsächlich existieren, eine Stunde aneinander vorbeireden zu können und plötzlich zu merken: Die interessiert das. Ich könnte es absolut verstehen, wenn es nicht so wäre. Wenn du zwanzig Jahre lang in der Gewerkschaft bist, bei Lafontaine, irgendwelchen Trotzkisten, der DKP oder in irgendeinem Wahlbündnis gegen eine lokale Schweinerei, dann hast du gewisse Erfahrungen mit den Intellektuellen: Wenn die Fernsehkamera da ist, steht der Intellektuelle dabei, rufst du ihn zwei Wochen später an und die Kamera ist weg, wird es schwierig.
Umgekehrt machen wir Intellektuellen auch so unsere Erfahrungen. Du kommst mit guten Ideen, die zum Teil naiv sein mögen, zu einer Organisation und hörst: Moment, auf unserer Rednerliste stehst du auf Platz 17, aber vorher müssen wir klären, ob hier geraucht werden darf – dann rennst du schreiend davon, weil du denkst: Mein Gott, sind das phantasielose Figuren.
Momentan ist alles sehr zersprengt. Gewerkschaftliche Arbeit, politische Publizistik – das müssen wir alles neu lernen, unter nicht mehr sozialpartnerschaftlichen Bedingungen, sondern wieder antagonistischen. Lange gab es für alles Kanäle, Dialog mit der Jugend und so. Jetzt ist nicht mehr Dialog mit der Jugend, sondern Banlieue. Das muss man alles erst wieder lernen. Ich glaube, der Weg ist relativ weit.
Bücher von Dietmar Dath
Deutschland macht dicht. Roman, 2010
Rosa Luxemburg. Biographie, 2010 (BasisBiographie)
Sämmtliche Gedichte. Roman, 2009
Die Abschaffung der Arten. Roman, 2008
Maschinenwinter. Wissen, Technik, Sozialismus. Eine Streitschrift, 2008
Das versteckte Sternbild. Roman, 2007 (unter dem Pseudonym David Dalek)
Waffenwetter. Roman, 2007
Heute keine Konferenz. Texte für die Zeitung, 2007
Dirac. Roman, 2006
Die salzweißen Augen. Vierzehn Briefe über Drastik und Deutlichkeit. Essays, 2005
Für immer in Honig. Roman, 2005 (Neuauflage 2008)
Höhenrausch. Die Mathematik des XX. Jahrhunderts in zwanzig Gehirnen. Sachbuch, 2003
Nichts legitimiert, dass der Staat zu terroristischen Mitteln greift
Raul Zelik1
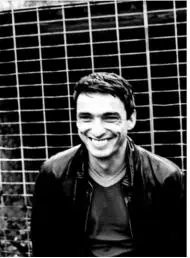
Raul Zelik (geb. 1968) lebt nach mehreren Lateinamerika-Aufenthalten seit 1989 als Autor von Romanen, Essays und Reportagen in Berlin. Als Politologe erfüllte er Lehraufträge zur politischen Entwicklung in Bolivien und Venezuela an der FU Berlin und als Gastprofessor an der Nationaluniversität Bogotá in Kolumbien. Zelik verfasste eine Reihe von Beiträgen zur politischen Theorie. Im Baskenland und in Lateinamerika liegen seine publizistischen Arbeitsschwerpunkte. Das Venezuela-Tagebuch »Made in Venezuela« (2004) und der Roman »Berliner Verhältnisse« (2005) sind seine bisher größten Erfolge. Sein Roman »Der bewaffnete Freund« spielt vor dem Hintergrund des baskischen Konflikts auf der Iberischen Halbinsel.
Ein Gespräch über den baskischen Konflikt, politische Gewalt, die Linkspartei in Deutschland und die Entwicklung der Demokratie in Venezuela.
Читать дальше