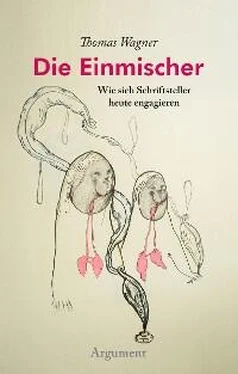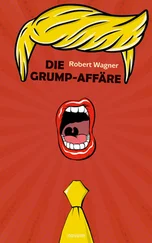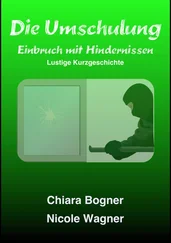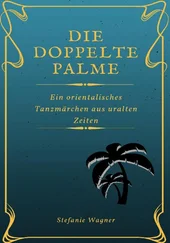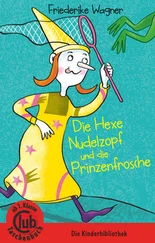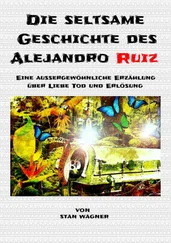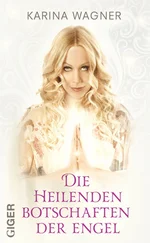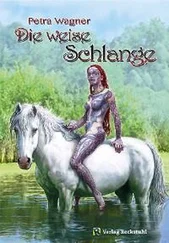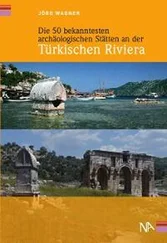In Ihrem neuen Roman Der bewaffnete Freund ist eine Figur abwesend und zugleich immer präsent: der baskische Autor Joseba Sarrionandia. Was fasziniert Sie an diesem Mann?
Sarrionandia ist ein Schriftsteller, der als Person eine große Ausstrahlung besitzt. Er hatte immer den Drang, politischer Aktivist zu sein. Vor 27 Jahren ist er als ETA-Mitglied ins Gefängnis gekommen, dann geflohen und war eine ganze Weile verschollen. Heute ist er sicher kein aktives Mitglied mehr, er hat sich aber auch nie distanziert, seine politische Haltung nicht aufgegeben. Mit all den Kosten, die das für ihn bedeutet: Er kann deshalb bis heute nicht zurückkehren. Auf der anderen Seite wollte er auch als Aktivist immer schreiben. Das ist eine doppelte Sehnsucht. Petra Elser und ich haben seinen in diesen Tagen im Verlag Blumenbar erscheinenden Roman Der gefrorene Mann übersetzt und dabei gemerkt, auf welch unprätentiöse Weise der Autor ganze Assoziationsuniversen eröffnet. Mich begeistert darüber hinaus, wie er das Baskische als Literatursprache in den sechziger und siebziger Jahren praktisch miterfunden hat. Das literarische Experiment ging einher mit dem politischen. Im Baskenland ist er so etwas wie eine Legende. Er hat als nicht mal Zwanzigjähriger und ETA-Mitglied eine wichtige Literaturzeitung mitbegründet, aus der viele große zeitgenössische Autoren baskischer Sprache hervorgegangen sind.
Was interessiert Sie am baskischen Konflikt?
Man kann im Baskenland sehen, wie in Europa Ausnahmezustände etabliert sind. Man spricht dort davon, dass in den dreißig Jahren seit dem Beginn der Demokratisierung etwa 7000 Menschen gefoltert worden sind. Bei drei Millionen Einwohnern ist das eine wahnsinnig hohe Zahl. Das kann in Europa passieren, ohne dass darüber gesprochen wird. Es darf regelrecht nicht darüber gesprochen werden. Es gibt zwar keine offizielle Zensur, dafür aber andere Ausschlussverfahren. Wenn man versucht, auf diese Dinge hinzuweisen, fällt man aus dem medialen Mainstream raus und hat Veröffentlichungsschwierigkeiten. Diese »Unsagbarkeit« ist auch der Grund, warum das Baskenland im Roman nicht ein einziges Mal beim Namen genannt wird.
Wo nehmen Sie die erschreckenden Zahlen her?
Die Zahlen stammen von Menschenrechtsorganisationen wie der »Torturaren Aurkako Taldea«, der Anti-Folter-Gruppe, aus dem Baskenland. Man kann schon davon ausgehen, dass das realistische Zahlen sind. Auch aus meinem Freundeskreis ist eine ganze Reihe von Leuten gefoltert worden. Die spanischen Kontaktsperregesetze sehen vor, dass man fünf Tage kommunikationslos ist. In dieser Zeit können verschiedene Arten von Misshandlungen systematisch vorgenommen werden.
Sie sagen, dass stabile Staatlichkeit nicht selten selbst der Grund dafür ist, dass Gewalt freigegeben wird. Können Sie das erläutern?
Man kann in den letzten Jahren eine Wiederkehr von Carl Schmitts Thesen zum Ausnahmezustand beobachten. Der autoritäre Staatstheoretiker und NS-Kronjurist gehörte in der BRD zu den wenigen Akademikern, die nach 1945 Lehrverbot hatten. Schmitt behauptete – im Übrigen ähnlich wie Walter Benjamin –, dass staatliche Souveränität, Machtausübung und Rechtsordnung eng mit der Figur des Ausnahmezustands verknüpft sind. Der italienische Philosoph Giorgio Agamben hat diese Debatte vor einigen Jahren wieder aufgegriffen und untersucht, wie die »Enthegung der Staatsgewalt«, also der Ausnahmezustand, vor allem nach dem 11. September 2001 zum Paradigma des modernen Regierens wurde. Wenn bei uns die Ermittlungsbehörden immer stärker autonom entscheiden können, wenn der Innenminister einfach so fordern kann, dass die Todesstrafe bei Terrorverdacht und dann noch von Ermittlungsbehörden angewandt werden darf, dann verweist das schon auf eine extreme »Enthegung von Gewalt«. Das Baskenland hat so etwas in den letzten dreißig Jahren schon erlebt.
Erschreckend ist, dass es dort gekoppelt war an den Demokratisierungsprozess, der Spanien in die Europäische Union führte. Es ist permanent und straflos gefoltert worden, und es wurden sogar Todesschwadronen aufgebaut wie in Lateinamerika – unter der Führung der sozialistischen Regierung Felipe González. Offensichtlich mit Wissen und Zustimmung der obersten Staatsorgane legten Terrorkommandos in den 1980er Jahren in Frankreich Bomben und brachten ziemlich wahllos Leute um. Das verweist darauf: Es gibt eine staatliche Seite des Terrorismus. Dadurch werden die ETA-Anschläge nicht besser. Ich finde, an Autobomben gibt es nichts zu verteidigen; selbst wenn nachvollziehbare Gründe vorgebracht werden, um diese Gewalt zu legitimieren. Aber andersherum gilt auch: Nichts legitimiert, dass der Staat zu terroristischen Mitteln greift.
Sie sagen, die Ablehnung von Gewalt ist nicht das Gleiche wie die Befürwortung eines Gewaltmonopols. Wie meinen Sie das?
Walter Benjamins »Kritik der Gewalt« definiert Recht als erfolgreich etablierte, in letzter Instanz aber willkürliche Gewalt. Dem staatlichen Gewaltmonopol muss daher mit großer Skepsis begegnet werden. Es gibt ja viele Leute, die das staatliche Gewaltmonopol für eine zivilisatorische Errungenschaft halten. Ich finde, das ist in dieser Schlichtheit eine falsche These. Damit will ich nicht sagen, dass ein Zustand anstrebenswert wäre, in dem sich diverse Gewalten selber regulieren. Man kennt ja solche Situationen in Slums, zum Beispiel in Lateinamerika. Da gibt es verschiedene bewaffnete Gruppen. Wer sich durchsetzt, hat dann vorübergehend, für ein paar Wochen, ein paar Monate, so etwas wie ein begrenztes Gewaltmonopol.
Das ist natürlich kein erstrebenswerter Zustand. Aber andererseits gibt es genug Hinweise, dass das auch für das staatliche Gewaltmonopol selbst gilt. In lateinamerikanischen Ländern, wo autoritäre Regierungen in den letzten dreißig Jahren versucht haben, sich durchzusetzen – egal ob das nun erfolgreich war oder nicht –, hat das auch zu brutaler, widerlicher Gewalt geführt. Und zum Teil ist diese Gewalt für die Menschen noch unerträglicher als die Herrschaft von Drogen-Gangs. Ich finde, man müsste eine andere Sache diskutieren. Man müsste fragen, wie Gewalt insgesamt gehegt werden kann. Das ist für die Linke eine wichtige Frage, denn es geht ja letztlich darum, wie Gewaltverhältnisse verschwinden. Das ist eines unserer wesentlichen Anliegen. Deswegen ist die Hegung der Gewalt das Ziel. Da gibt es unterschiedliche Dinge, die diskutiert werden müssten. Die Stärkung des Gewaltmonopols ist in der Regel nicht das adäquate Mittel dazu. Heute gibt es ja sogar wieder Leute, die sich von der Befriedungskraft imperialer Gewalt viel versprechen. In Deutschland steht der Politikwissenschaftler Herfried Münkler dafür. Münkler ist insofern eine bemerkenswerte Figur im deutschen Wissenschaftsbetrieb, als er immer noch von vielen Leuten Mitte-Links verortet wird. Dabei ist er jemand, der sich dafür ausspricht, dass Deutschland neoimperiale Politik macht, und sich dazu bekennt, weil jemand ja Ordnungspolitik machen muss. Münkler steht für eine anbiedernde akademische Haltung, die hofft, durch ihre Einflüsterungen bei den Mächtigen Einfluss zu erlangen. Es geht darum, globale Verteilungsordnungen und Machtordnungen zu begründen, die einen großen Teil der Menschheit von der Mitgestaltung, von der Mitbestimmung über die Ressourcen fernhält. Münkler versucht das in seinem Buch Imperien ausführlich damit zu kaschieren, dass er sagt: »Na ja, in den Imperien hat ja auch die Peripherie profitiert. Das Imperium hat versucht, die Peripherie mit hereinzuholen.« Im Grunde macht Münkler so etwas Ähnliches wie Samuel Huntington, nur unbedeutender: Er dient sich den Eliten als Theoretiker der Herrschaft an.
Der bürgerliche Staat birgt eine extreme Form organisierter Gewalt. Was bedeutet das für eine linke, eine emanzipatorische Politik, die sich für die Abschaffung von Herrschaft einsetzt, wenn sie im Rahmen von Staatlichkeit agiert?
Читать дальше