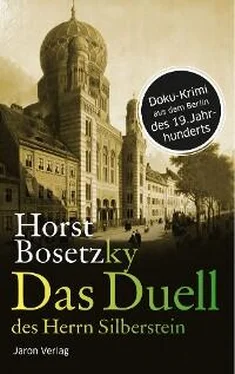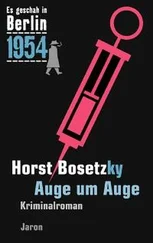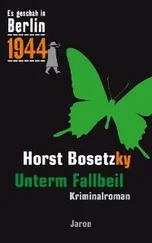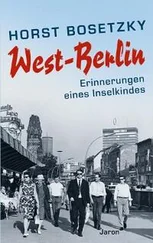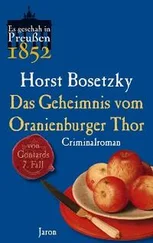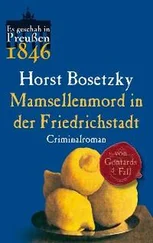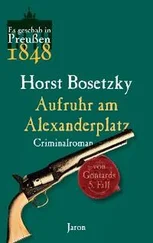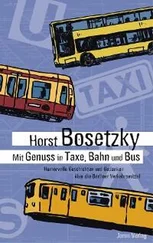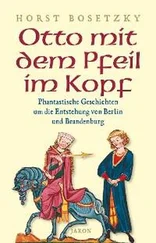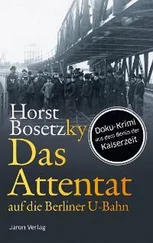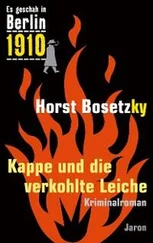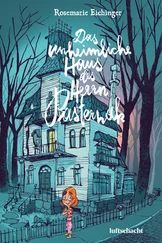»Aber dich gefordert hat er nicht?«
»Zum Duell? Nein, leider nicht. Dazu war die Dosis diesmal noch zu niedrig. Aber wir werden sie zu steigern wissen. Denn eines steht fest: Dieser Hinckeldey muss eliminiert werden!«
KARL LUDWIG FRIEDRICH V. HINCKELDEY entstammte dem niederen Beamtenadel und war am 1. September 1805 in Sachsen-Meiningen als Sohn eines Geheimen Regierungsrats geboren worden. Er hatte von 1823 bis 1826 Rechtswissenschaften an den Universitäten Berlin und Göttingen studiert und war dann in den preußischen Staatsdienst eingetreten, wo er, erzkonservativ wie er war, schnell Karriere machte. 1834 wurde er zum Regierungsrat ernannt, 1842 kam er als Oberregierungsrat nach Merseburg, und am 14. November 1848 holte man ihn nach Berlin, um ihn zum Polizeipräsidenten zu berufen. Für Ruhe und Ordnung sollte er sorgen und das liquidieren, was von der Revolution noch geblieben war.
Diese Aufgabe erfüllte er überaus einfallsreich. Rücksichtslos und ohne jeden Skrupel ließ er alle jagen, die im Geruch standen, demokratisch zu sein. Im April 1851 gründete er den Deutschen Polizeiverein, dessen Aufgabe es wurde, die Kräfte der Geheimpolizei in den Staaten des Deutschen Bundes zu koordinieren. Ziel war »die Ausspähung, Prävention und Bekämpfung jeglicher oppositionell erachteter Bestrebungen«. Durch verschiedene Machenschaften gelang es ihm zudem, 1853 zusätzlich Generalpolizeidirektor zu werden, das heißt Leiter der Polizei im Ministerium des Innern. Er sorgte dafür, dass die Theater- und Pressezensur verschärft wurde, ließ Zeitungen beschlagnahmen und schuf eine gigantische Überwachungsmaschinerie. So wurden alle Reisenden und die Menschen, die sich in Berlin niederlassen wollten, überwacht, selbst wenn sie von Adel waren. Haussuchungen und Razzien in Wirts- und Vereinshäusern waren an der Tagesordnung, und es wimmelte überall von Spitzeln. Und vermochte er »subversive Elemente«, auch in den eigenen Reihen, auf diese Art und Weise nicht unschädlich zu machen, so wurden falsche Zeugen ins Spiel gebracht. Joseph Fouché hätte seine helle Freude an diesem Mann gehabt.
Karl-Hermann Rana war ein durch und durch dionysischer Mensch, und er liebte nichts mehr als das Spektakel, ja den Skandal. Und da sollte er im März 1856 voll auf seine Kosten kommen. Beim sogenannten Karussellreiten der Hof- und Gardeoffiziere hatten sich auch acht Polizeibeamte Zugang verschafft. Als sie von den erzürnten Adeligen des Platzes verwiesen wurden, ließen sie den Polizeipräsidenten herbeirufen. Hinckeldey erschien auch prompt, wurde aber am Eingang von mehreren Offizieren zurückgewiesen. Rochow, der mit dem preußischen Innenminister Ferdinand von Westphalen in der Nähe stand, beleidigte Hinckeldey derart rüde, dass der nicht mehr an sich halten konnte und Rochow zum Duell forderte.
»Der ist dem lieben Rochow also voll ins Messer gelaufen«, sagte Rana später zu seinem Freund Benno Frühbeis.
»Hinckeldey hat sich darauf verlassen, dass der König das Duell verbieten würde.« Benno Frühbeis war Schauspieler am Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater und hatte Freunde, die am Hofe ein und aus gingen und stets auf dem Laufenden waren.
»Hat er aber nicht?«
»Nein.«
Rana schüttelte den Kopf. »Aber Hinckeldey hat doch bekanntermaßen ›ein schwaches Gesicht‹, wie die Berliner sagen.«
Frühbeis lachte. »Ja, kurzsichtig wie ein Maulwurf ist er, und meine Zugehfrau hat gesagt: ›Der sieht doch uff zwölf Schritte keen Möbelwagen.‹ Darum soll er sich ja auch mit dem König so gut verstehen: Der läuft ja auch öfter gegen die dicksten Bäume.«
Rana zog an seiner Zigarre. Den Rauch trinken, nannte er das. »Ja nun, wer weiß, wozu es gut ist … Wo und wann wollen sie sich denn duellieren?«
»Nächsten Montag um zehn Uhr morgens in der Jungfernheide, gleich am Forsthaus Königsdamm. Willst du hingehen?«
»Natürlich. Rein zufällig werde ich zur Stelle sein.« Seine Neugierde war größer als seine Angst, vielleicht in irgendwelche polizeilichen Ermittlungen verwickelt zu werden und dadurch womöglich den einen oder anderen Auftrag zu verlieren. »Ein Duell, wunderbar! Ein Leben ist ja so kurz, und wann hat man schon einmal Gelegenheit, ein solches Schauspiel zu verfolgen.«
»Apropos Schauspiel.« Frühbeis griff zur Rotweinflasche, um sich nachzuschenken. »Ich komme mit, denn wer weiß, vielleicht kriege ich bald einmal eine Rolle, in der ich mich duellieren muss, und dann ist es sicher von Vorteil, so etwas schon einmal mit eigenen Augen gesehen zu haben.«
So saßen sie denn am 10. März schon frühmorgens in einer Droschke, um sich durch den Thiergarten nach Lietzow fahren zu lassen. Rechts hinter dem Charlottenburger Schloss ging es über die Spree hinweg. Auf der Holzablage hinter der Brücke entdeckten sie Louis Krimnitz, der gerade beim Löschen einer für ihn bestimmten Ladung Hand anlegte. Sie winkten ihm zu, sahen aber keinen Anlass, anzuhalten und mit ihm zu plaudern. Die Gefahr, zu spät zu kommen, war zu groß, und Krimnitz musste ja auch nicht unbedingt wissen, was sie zu dieser frühen Stunde in die Jungfernheide trieb.
»Ein komischer Kerl«, sagte Benno Frühbeis. »Ich traue ihm nicht so recht über den Weg.«
»Er hängt an mir wie eine Klette.«
»Eher wie ein Parasit«, korrigierte ihn Frühbeis.
»Wie auch immer – ohne mich kann er sich aufhängen, und ich möchte nicht schuld daran sein. Außerdem brauche ich ihn bei meinen Festen. Keiner singt so schön wie er die schauerlichsten Balladen, und keiner schleppt so schöne Frauen herbei.«
Knapp hinter dem Belvedere, wo die Spree einen scharfen Bogen nach Westen machte, ließen sie den Kutscher halten. Sie entlohnten ihn und wanderten dann einen staubigen Feldweg entlang, der zum Nonnendamm führte. Über die Nonnenwiesen, deren östlichen Zipfel sie gerade berührten, zogen feuchte Nebelschwaden.
»Welch eine Kulisse!« Benno Frühbeis geriet ins Schwärmen.
»Doch diese Morgenstunde hat nicht Gold, sie hat den Tod im Munde«, sagte Rana.
»Ist das nicht dasselbe? Nur der Tod nimmt uns die Angst vor ihm. Also ist er golden.«
»Verschon mich mit deiner verqueren Philosophie!«, rief Rana. »Das Einzige, was mir am Tod gefällt, sind die Todsünden, zwei vor allem: die Wollust und die Völlerei.«
So ging es noch eine Weile hin und her, bis sie auf ein breites Waldstück stießen, an dessen südlichem Rand sich der Königsdamm von Spandau Richtung Wedding zog. Bald entdeckten sie die beiden kleinen Gruppen um v. Rochow und um v. Hinckeldey und suchten Deckung hinter einem Wall aus aufgehäuften Feldsteinen, umgestürzten Bäumen und verfilzten Brombeerbüschen.
Die Lichtung wurde zur Bühne, und sie bekamen ein Drama zu sehen, wie es nicht mal das Königliche Schauspielhaus zu bieten hatte.
»Ein bisschen absurd ist es schon«, flüsterte Benno Frühbeis. »Da lässt der Junkerclub auf einen schießen, der selber von Adel ist und, indem er die Opposition niederhält, doch nur dessen ureigenste Interessen vertritt.«
»Egal, ich bin für Rochow, denn Hinckeldey hat mich um ein Haar in den Ruin getrieben.« Worauf Rana da anspielte, war die Affäre um die »Einmann-Pissoirs«. Hinckeldey hatte sich schon lange über das wilde Plakatieren in der Stadt geärgert und den Unternehmer Ernst Litfaß über 150 Reklamesäulen aufstellen lassen. Die waren innen hohl und boten Platz für ein kleines Urinal. Zwang man die Männer dort hinein, war viel für die öffentliche Schicklichkeit wie die Hygiene getan. Die Berliner nannten ihren Polizeipräsidenten daraufhin »Pinkel-Bey« und reimten: »Ach, lieber Vater Hinckeldey, / mach uns für unsre Pinkelei / doch bitte einen Winkel frei.« Aber die Sache scheiterte schließlich, weil sie den einen zu albern und den anderen wegen des schwer zu installierenden Abflusses zu teuer erschien. Rana aber hatte schon einige Vorleistungen erbracht und war nun um einiges ärmer geworden.
Читать дальше