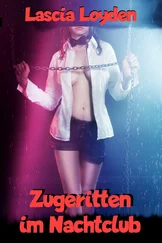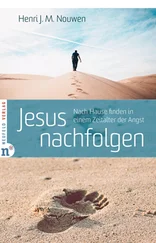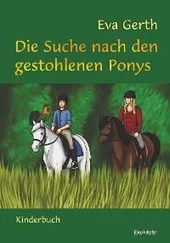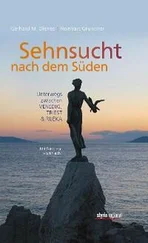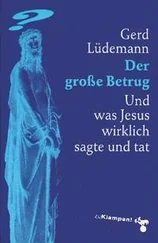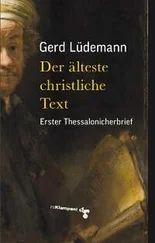Eine Vorstufe für diese veränderte Zukunftserwartung finden wir im ältesten Brief des Paulus, dem an die Thessalonicher (1Thess 4,15-17), wo das dem Propheten Paulus zuteil gewordene Wort des »Herrn« wie folgt lautet:
»(15) Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, daß wir, die wir leben und übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. (16) Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. (17) Danach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen; und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit.«
Zum Zeitpunkt der Abfassung des ersten Thessalonicherbriefs setzt Paulus offenbar voraus, daß die Mehrheit der Christen, seine Person eingeschlossen, mit einem Überleben bis zur Ankunft Jesu vom Himmel rechnen könne, während eine Minderheit versterbe.
Aus dieser Rekonstruktion folgt, daß Paulus vor der Abfassung des ersten Thessalonicherbriefs davon ausgegangen war, alle Christen würden bis zum Kommen Jesu vom Himmel überleben; und in dieser Erwartung dürfte er die christliche Durchschnittsmeinung der ersten Jahre nach Tod und »Auferstehung« Jesu vertreten haben.
V. 2-8: Die Tradition ist relativ einheitlich. Man beachte aber, daß am Anfang Jesus Subjekt ist, am Ende die Jünger. Die Tradition wurzelt im jüdischen Milieu. Sie hat mancherlei Parallelen mit Ex 24: Mose steigt auf den Berg, begleitet von drei namentlich genannten Männern (V. 9). Eine Wolke bedeckt den Berg (V. 15), und zwar 6 Tage lang, und Gott redet schließlich mit Mose aus ihr (V. 16). Die Tradition begründet, allgemein gesagt, Jesu Legitimität durch seine Entrückung in die himmlische Sphäre selbst.
Die Mk als literarische Einheit vorgegebene Tradition läßt sich in drei Teile gliedern:
1. Verklärung Jesu auf dem Berg und das Erscheinen von Elia und Mose;
2. Vorschlag des Petrus, drei Hütten zu bauen;
3. Wolke und Wolkenstimme (»Inthronisationsformel«) als Pointe.
Man kann die Tradition mit guten Gründen als Ostergeschichte identifizieren, und zwar wegen des Licht- und des Bergmotivs. So sieht Paulus den himmlischen Christus in einem verklärten Lichtleib (1Kor 15,42-49), und der Auferstandene erscheint seinen Jüngern auf dem Berg: Mt 28,16-20. Die Aufnahme der Verklärungsgeschichte in 2Petr 1,16-18 verankert sie offenbar in einem österlichen Kontext.
Die vorliegende Überlieferung mag die aus Gal 2,9 bekannte Trias »Petrus, Jakobus, Johannes« in ihrem Säulenamt legitimiert haben.
Historisches
V. 1: Die Rekonstruktion der Entstehung des Wortes beweist seine Unechtheit. Doch macht es, zusammen mit den angeführten Belegen aus den Briefen des Apostels Paulus, die brennende Naherwartung der ersten christlichen Generation deutlich, die am besten verstehbar ist, wenn Jesus selbst mit dem Kommen des Reiches Gottes in allernächster Zukunft gerechnet hat.
V. 2-8: Ist die Tradition ursprünglich eine Ostergeschichte, scheidet ihre Historizität von vornherein aus.
Mk 9,14-29: Der epileptische Knabe
(14) Und als sie zu den Jüngern kamen, sah er eine große Volksmenge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten . (15) Und sogleich sah ihn das ganze Volk und erschrak und lief herbei, um ihn zu begrüßen . (16) Und er fragte sie: »Was streitet ihr mit ihnen? «
(17) Und es antwortete ihm einer aus dem Volk: »Lehrer, ich brachte meinen Sohn zu dir, der einen stummen Geist hat. (18) Und wenn er ihn packt, wirft er ihn auf den Boden; und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, daß sie ihn austrieben, und sie vermochten es nicht.«
(19) Er aber antwortete ihnen und sagt: »Oh ungläubiges Geschlecht, wie lange werde ich noch bei euch sein? Wie lange werde ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir!« (20) Und sie brachten ihn zu ihm.
Und als der Geist ihn sah, riß er ihn sogleich zusammen, und er fiel auf den Boden und wälzte sich schäumend. (21) Und er fragte seinen Vater: »Wie lange Zeit ist ihm dieses geschehen?« Er aber sagte: »Von Kindheit an. (22) Und oft warf er ihn auch in das Feuer oder in Wasser, damit er ihn vernichte. Aber wenn du kannst, hilf uns und hab Erbarmen über uns.«
(23) Jesus aber sagte ihm: »Was das betrifft, sage ich dir: Alles ist möglich dem, der glaubt. « (24) Sogleich schrie der Vater des Knaben auf und sagte: »Ich glaube, hilf meinem Unglauben! «
(25) Als aber Jesus sah, daß das Volk zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist, und sagte ihm: »Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir: Fahre von ihm aus und kehre nicht mehr in ihn zurück!« (26) Und er schrie, riß ihn heftig zusammen und fuhr aus. Und er war wie tot, so daß viele sagten: »Er starb.« (27) Jesus aber nahm seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf.
(28) Und als er in das Haus eintritt, fragten ihn seine Jünger für sich: »Warum konnten wir ihn nicht austreiben?« (29) Und er sagte ihnen: »Diese Art kann durch nichts anderes ausfahren als durch Gebet.«
Redaktion
V. 14-16 sind redaktionell. Die Rückkehr Jesu und seiner drei Begleiter zu den Jüngern (V. 14) schließt an V. 2 an. »Schriftgelehrte« (V. 14) nimmt dieselbe Gruppe aus V. 11 auf. Wenn sie vorher genannt wurden, ging es immer um die Vollmacht Jesu (vgl. 1,22 u.ö.). Hier diskutieren sie mit den Jüngern.
V. 19 steht innerhalb des MkEv in einer langen Reihe von Stellen, die die Unfähigkeit der Jünger, zu verstehen, schlagend belegen (vgl. vorher 8,16-21).
V. 23-24 tragen das mk Glaubensmotiv ausdrücklich in die Geschichte ein. Der beispielhaft dargestellte Glaube des Vaters steht dabei in einem starken Gegensatz zur hilflosen Haltung der Jünger, die in V. 19 als ungläubiges Geschlecht bezeichnet werden.
V. 28-29 sind gleichfalls markinisch: Durch V. 28b versucht Mk vielleicht das Problem seiner Gemeinde zu bewältigen, daß sie sich der eigenen exorzistischen Fähigkeit unsicher geworden ist.
Tradition
Die doppelte Krankheitsbeschreibung (V. 17b-18; V. 21f) und die Tatsache, daß die Jünger nur am Anfang von Bedeutung sind, lassen darauf schließen, daß die von Mk aufgenommene Erzählung eine sekundäre Kombination zweier einander ähnlicher Wundergeschichten ist. Dabei scheint die zweite (etwa V. 21ff) ganz auf den Exorzismus konzentriert gewesen zu sein, während die Pointe der ersten (etwa V. 17ff) »die Gegenüberstellung des Meisters und der Zauberlehrlinge« war, »deren Unfähigkeit die Folie für die Kraft des Meisters bildet« (Bultmann, 225).
Historisches
Zuweilen wird in der Tradition die historisch zuverlässige Erinnerung an ein Jüngerversagen wiedergefunden. Doch kann man nur deswegen, weil das Jüngerversagen in anderen Wundergeschichten kein Thema ist, schwerlich auf historische Erinnerungen schließen. Zudem mag das Jüngerversagen aus der nachösterlichen Situation eingetragen worden sein, denn für sie ist es an anderen Stellen bezeugt (4,13-20; Lk 22,31f).
Zur Exorzismustätigkeit Jesu sei auch auf die Ausführungen zu Lk 11,20 verwiesen.
Zur Frage, ob das erst von Mk in die Geschichte eingebrachte Glaubensmotiv für Jesus bedeutsam war, vgl. zu 11,23.
Mk 9,30-41: Zweite Leidensweissagung. Rangstreit unter den Jüngern. Der fremde Exorzist
(30) Und von dort gingen sie hinaus und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, daß es jemand erfährt . (31) Er lehrte nämlich seine Jünger und sagte ihnen: »Der Sohn des Menschen wird in die Hände von Menschen übergeben und sie werden ihn töten und, getötet, wird er nach drei Tagen auferstehen. «
Читать дальше