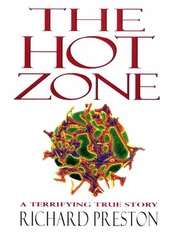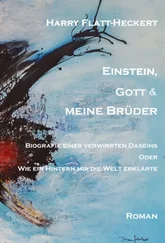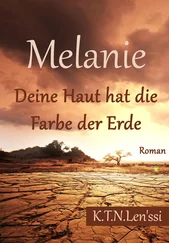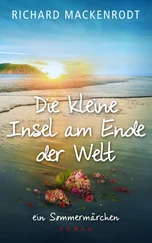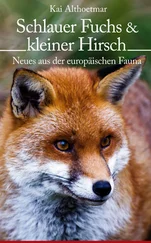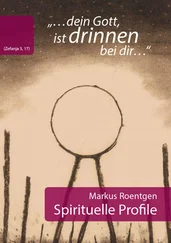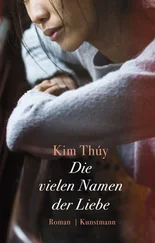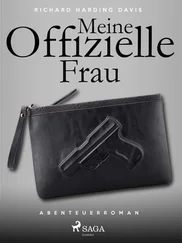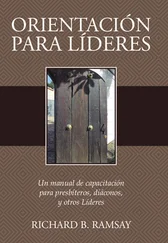Meine Familie und auch deren Vorfahren gehörten zu einer exklusiven christlichen Glaubensrichtung, die heute unter dem Namen Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde firmiert, früher auch unter Brüderbewegung ( Elberfelder Brüder ), Darbysten oder Christliche Versammlung , einer Bewegung, die im 19. Jahrhundert in England unter dem Reformer John Nelson Darby (1800–1882) seinen Ausgang nahm. Darby war Aristokrat, Jurist und vormals Priester der anglikanischen Kirche, bevor er dem Pomp der Hochkirche abschwor, sich dem vertieften Bibelstudium widmete und schließlich der geistige Führer und Kopf der Brüderbewegung wurde. Anfangs und im kleinen Kreis traf man sich privat, doch mit zunehmender Mitgliederzahl entstanden Versammlungsräume, oftmals in Hinterhöfen. Im Dritten Reich waren die Gemeinden vorübergehend verboten und ihre Vermögen beschlagnahmt, weil sie mangels straffer Organisation nicht dem Führerprinzip entsprachen und nur schlecht zu kontrollieren waren. In einer Verordnung des Reichsführers der SS hieß es, die Darbysten seien im gesamten Reichsgebiet aufgelöst und verboten, da sie jegliche positive Einstellung zu Volk und Staat verneinten. Als die christlichen Gemeinden unter bestimmten Bedingungen im Bund freikirchlicher Christen (BfC) wieder zugelassen wurden, erklärte ein Teil der Mitglieder sich mit den von oben verordneten Bedingungen nicht einverstanden. Sie sonderten sich ab, gingen in den Untergrund und riskierten sogar Gefängnisstrafen, wenn sie sich trotzdem „unter dem Wort Gottes“ versammelten. 1941/42 kam es zu einem Zusammenschluss zwischen dem BfC und den Baptisten unter der Bezeichnung Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden .
Der Schock des überraschenden Verbots 1937 hielt die christlichen Brüder allerdings nicht davon ab, in aller Naivität für den „Führer, den wir ja alle so lieben“ 4, zu beten. Dass für den Führer und seine willigen Helfer gebetet wurde, war nicht außergewöhnlich, denn das forderte sogar die Bibel und die musste man in diesen Kreisen wörtlich nehmen. Sie mahnt, für alle zu beten, „die in Hoheit sind“ 5. Peinlich war nur, dass damals für einen Kriegsverbrecher gebetet wurde, wie später auch in den USA unter anderem für George W. Bush. Wer aber ein offizielles Schuldbekenntnis der Brüder nach 1945 – wie etwa das der evangelischen Kirche – erwartet hatte, sah sich getäuscht. Kein NSDAP-Mitglied wurde später von den Gemeinden ausgeschlossen. 6
Kennzeichnend für diese Art der evangelikalen Theologie und Frömmigkeit sind die Zugangsrituale, wie Wiedergeburt durch Bekehrung, persönliche Glaubenserfahrung, Suche nach Heils- und Glaubensgewissheit und schließlich die Erwachsenentaufe. Wer wie ich in einer Familie mit strengem Verhaltenskodex, täglichen Gebeten und Bibellesungen aufgewachsen ist und einer Erwartungshaltung von Seiten der Eltern, sich bereits im Kindesalter zu bekehren, weiß nicht unbedingt, was das bedeutet. Um sicherzugehen, habe ich mich als Kind gleich zweimal bekehrt und wurde von meinem Vater als Halbwüchsiger in einer Badewanne getauft – nicht etwa mit ein paar Spritzern auf den Kopf, wie es bei Babys am kirchlichen Taufbecken geschieht, sondern mit Haut und Haaren ganz unter Wasser, wie es die Bibel lehrt. Die Taufe, in biblischen Zeiten von Johannes dem Täufer am Jordan eingeführt, war ein Novum. Johannes wies damit einen neuen Weg, sich von Sünden reinzuwaschen. Als Jesus von Johannes getauft wurde, hatte er ein ekstatisches Erlebnis. Es wird allerdings nirgends berichtet, dass Jesus selbst von dem magischen Ritus Gebrauch machte, indem er jemanden taufte, obwohl sich der See Genezareth als Arbeitsstätte dazu angeboten hätte. Überliefert ist jedoch, dass Jesus in seiner Abschiedsrede, bevor er emporgehoben in einer Wolke den Blicken seiner Anhänger entschwand, versprach: „Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft werden“ 7, was zu Pfingsten dann auch geschah.
Eine mir eng vertraute Person bekannte im hohen Alter, sie habe sich im Alter von neun Jahren zwar bekehrt, aber erst als Siebzehnjährige Heilsgewissheit erlangt. Das erklärt, wie schwierig es für Kinder ist, sich für die Nachfolge Jesu – wie es heißt – zu entscheiden. Eine Bekehrung beziehungsweise Umkehr setzt ja zunächst die Erkenntnis voraus, dass ich nicht so bin, wie ich eigentlich sein sollte. Warum sollte ich sonst umkehren und einen neuen Weg einschlagen? Da Kinder unschuldig geboren werden, ein Kind also im Bewusstsein lebt, es sei eigentlich in Ordnung, muss das Bedürfnis, sich bekehren zu sollen, einen anderen Weg einzuschlagen, durch Erwachsene zunächst künstlich geweckt werden. Man möge mir den folgenden banalen Vergleich verzeihen: Ich war Jahrzehnte in der Werbung tätig. Da gab es Produkte und Dienstleistungen, für die ein Bedarf erst künstlich geweckt werden musste, und zwar durch einen hohen Aufwand an Werbung, damit die Konsumenten von dem Angebot Gebrauch machten. Auf die christlichen Zugangsrituale übertragen, bedeutet das, Kindern muss zunächst ein Schuldbewusstsein implantiert/suggeriert werden, damit die Bereitschaft entsteht, sich zu bekehren.
Ich fragte mich später: Bedeutet Bekehrung, die Ethik, die Jesus lehrte, zu verinnerlichen und danach zu leben, damit eine bessere Welt entsteht, oder im Erwachsenenalter seinem Vorbild folgend zunächst Vater und Mutter zu verlassen, den Tischlerberuf im väterlichen Betrieb an den Nagel zu hängen, Jünger zu animieren, es ihm gleichzutun, um dann bedürfnislos, von Almosen lebend, predigend auf Wanderschaft zu gehen? Die Geschichte, in der die Jünger ihr gewohntes Leben, wie etwa die familiären Verpflichtungen, fristlos und gänzlich aufgaben, um Jesus zu folgen, spiegelt einerseits die Labilität des Charakters solcher Schüler wider, andererseits die Sogwirkung, die von dem charismatischen Lehrer ausging.
Einer, der es Jesus gleichtun wollte – allerdings unter Verzicht einer Schar von Jüngern, aber mit Unterstützung seiner familiären Fan-Gemeinde – war mein Vater, nachdem 1945 seine Existenz als Inhaber eines Schreibwarengeschäfts in Siegen durch Bomben vernichtet war und eine krankheitsbedingte Kündigung ein Intermezzo in einem ihm fremden Beruf beendete. Ab 1949 fühlte er sich berufen, wie Jesus predigend auf Wanderschaft zu gehen. Er war einerseits Prediger in der örtlichen Gemeinde, jetzt im tiefen Westerwald, andererseits Reisebruder , so die offizielle Berufsbezeichnung dieser Freiberufler. Im ersten Fall zum Nulltarif, als Reiseprediger mit einem mäßigen, ungeregelten Einkommen. Das Einstandskapital war die Bibel, die Finanzierung der neunköpfigen Familie von nun an ungewiss.
Nicht erst jetzt waren wir arm. Obwohl ich mir dafür nichts kaufen konnte, war ich aber mit gewissem Stolz The Son of a Preacher Man , wie es 1968 in dem Song von Dusty Springfield heißt. Das verpflichtete zum Wohlverhalten. Jeder Fehltritt seiner sieben Kinder hätte dem Prediger einen Image-Schaden zufügen können, wie etwa die Heirat mit einem Partner einer anderen Glaubensrichtung. Der lange Arm der strengen Erziehung reichte wirkmächtig auch noch bis in die Ferne, als die Kinder weit weg in anderen Städten wohnten und arbeiteten. Gefordert wurde außerdem, vor jeder richtungweisenden Entscheidung zu beten. Da auf direktem Wege keine Weisung von oben einzuholen war, mussten sogenannte Zeichen Antwort geben – mit anderen Worten, eine Art Wink des Himmels .
Von dem für mein Lebensgefühl zu eng gewordenen Gemeindeleben habe ich mich später, im Alter von 28 Jahren, emanzipiert. Was ich gewonnen habe? Eine neue innere und zeitliche Freiheit und die Möglichkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit elterlichen und geistlichen Instanzen wie deren Lehren. Was mir bleibt, ist das Bewusstsein für eine christliche Ethik der Nächstenliebe, die Anders- oder Nichtgläubige nicht ausgrenzt, nicht missioniert, auch nicht ungefragt bedrängt. Das tat Jesus auch nicht. Er half denen, die freiwillig zu ihm kamen und ihn um Hilfe baten. Er lehrte Gewaltfreiheit und Nächstenliebe, kümmerte sich um Menschen am Rande der Gesellschaft. Man könnte auch sagen: Er war ein Mann in schlechter Gesellschaft, mit Zöllnern und Sündern ohne Berührungsängste. Im Gegensatz dazu haben es Christen jeder Konfession oder Glaubensrichtung immer wieder verstanden, sich abzugrenzen, auf Andersgläubige oder Ungläubige herabzusehen. Bei dem Bemühen, den biblischen Missionsauftrag zu erfüllen, spielen Vokabeln wie du sollst oder wenn du nicht, dann droht oftmals eine entscheidende Rolle.
Читать дальше