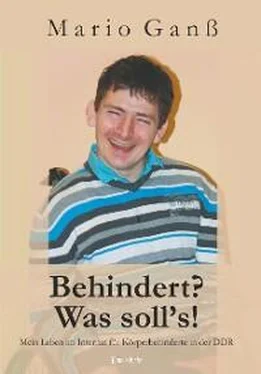Vom Wetter wurden wir beim Zelten in Lehnin sehr verwöhnt und die Erfahrung zeigte uns, dass mit relativer Regelmäßigkeit die letzte Woche im Juli sowie die ersten beiden Wochen des August die Sonne am verlässlichsten schien. Klar gab es in diesen Tagen auch mal Ausnahmen und der Himmel trübte sich ein. Regenschauer mussten wir ebenfalls hin und wieder in Kauf nehmen. Wenn es nachts auf das Zelt regnete, empfand ich das irgendwie als sehr beruhigend. Ein Gewitter mit aufziehendem Wind stellte sich als ein besonderes Abenteuer dar. Kam dann aber noch Sturm dazu, sah die Sache für uns schon anders aus.
In solchen Situationen stand mein Vater nachts auf und machte regelrechte Kontrollgänge um unser Zelt. Zum einen wachte er darüber, dass das Wasser in den kleinen Gräben, die um das Zelt gezogen waren, nicht über und so in das Zelt lief. Desweiteren ging sein besorgter Blick immer erneut nach oben zu den Baumwipfeln. Dort lauerte für uns die größte Gefahr, herunterfallende Äste. Wären diese heruntergefallen und ungünstig auf das Zelt aufgekommen, hätten sie mühelos das Überzelt, das eigentliche Zelt und erst recht die Schlafkabine durchschlagen können. Zum Glück hielten die großen Kiefern jedem Sturm stand.
Der Sommer 1978 muss ein total verkorkster gewesen sein: nass und kalt. Die kühleren Tage nutzten wir, um Ausflüge mit dem Auto in die nähere Umgebung zu unternehmen. Brandenburg, Potsdam oder auch Berlin boten sich dafür recht gut an. Auch einige Tage, an dem wir nur im Zelt spielen konnten, nahmen wir in Kauf. Doch an einem Tag mussten wir kapitulieren.
Es fing schon am Vorabend an zu regnen und auch nachts hörte es nicht auf. Im Gegenteil. Der Regen verstärkte sich immer weiter. Auch die Tage zuvor waren sehr regnerisch. Als wir am Morgen aufstanden, merkten wir, dass wir unter diesen Umständen unsere Sachen überhaupt nicht mehr trocken bekamen. Auch das Bettzeug war schon klamm. Die kleine Propangasheizung spendete uns zwar ein wenig Wärme, doch zum Trocknen der Sachen war sie nicht geeignet. Wir sahen ein, dass es in diesem Moment keinen Sinn hatte, länger im Zelt zu verharren. Kurzerhand entschlossen wir uns, nach dem Frühstück nach Zerbst zu fahren, um unsere Sachen zu trocknen und frische zu holen.
Mein Vater fuhr unseren Trabant so nah wie möglich an das Zelt, um mich halbwegs trocken zum Auto zu tragen. Mit dem Rollstuhl oder dem Handwagen wären wir den schon aufgeweichten Weg bis zum Parkplatz überhaupt nicht lang gekommen.
Der Zeltplatz lag etwa drei Kilometer vom Ort Lehnin entfernt. Zu ihm führte ein teils festgefahrener, teils sandiger Waldweg. Der Sand ließ das Wasser noch einigermaßen gut versickern, sodass wir ohne größere Probleme die befestigten Straßen ab Lehnin erreichten.
Es goss immer noch wie aus Kübeln. Die Scheibenwischer schafften es kaum, die Scheiben vom Wasser zu befreien. Nur im gemäßigten Tempo kamen wir voran.
Auf einmal blubberte unser Trabi. Da uns das Geräusch bekannt vorkam, beunruhigte uns dies wenig. Mein Vater stieg aus, um nachzusehen was defekt war. Aus Solidarität hielt meine Mutti ihm den Schirm. Zielstrebig wechselte mein Vater die Zündkerze. So ein Blubbern war ein sicheres Zeichen, dass mit diesen etwas nicht stimmte und sie meist verstopft waren. Bei den vielen Fahrten, die mein Vater absolvierte, war das Wechseln der Kerzen für ihn zur Routine geworden. Zumal der Trabant nur zwei davon besaß und diese gut zugänglich waren.
Mit neuer Zündkerze fuhren wir einige Kilometer weiter. Doch nach kurzer Zeit das gleiche Spielchen. Diesmal wechselte mein Vater die andere Kerze. Nun konnte nichts mehr schief gehen. Leider erwies sich dies als Irrtum. Unser Trabi blubberte und spuckte weiter. Wir sagten: »Warum lässt der uns ausgerechnet bei so einem Mistwetter im Stich?« Uns wurde es auch immer kühler, denn die Heizung in so einem Trabant funktioniert nur richtig, wenn er einigermaßen schnell fährt.
Mein Vater unternahm einen letzten Versuch, die Kerzen zu trocknen. Aber unser Trabi dankte es ihm nur mit weiteren Aussetzern der Zündung. Wir waren machtlos und auf fremde Hilfe angewiesen. Aber wo sollte zu damaliger Zeit so schnell Hilfe herkommen? Schon allein das Wort »Handy« war uns bei Weitem kein Begriff, zumal es zu dieser Zeit noch überhaupt gar keine gab.
Daher beschlossen wir, so lange zu fahren, wie es irgendwie ging und zu versuchen, die nächste Werkstatt zu erreichen. Diese war in Belzig. Gemächlich tuckerten wir dahin. Unser »Vorhaben« gelang uns. Wir kamen in der Werkstatt an.
Unbürokratisch konnte uns hier weitergeholfen werden. Während meine Eltern und mein Bruder das Auto verlassen mussten, durfte ich drin sitzen bleiben. Obwohl ich nicht viel von der Reparatur sehen konnte, empfand ich es als spannend, hautnah dabei zu sein. Interessierte ich mich doch sehr für Technik.
Die Zündkerzen waren in Ordnung, doch ein anderes Teil der Zündanlage muss verölt gewesen sein. Nach einer halben Stunde schnurrte unser Trabi wieder wie neu und wir konnten damit zufrieden nach Zerbst fahren.
Es goss immer noch ununterbrochen. In Zerbst angekommen, heizten wir zunächst den Ofen an, um uns erst einmal aufzuwärmen. Gleichzeitig trockneten wir so unsere klammen mitgebrachten Sachen.
Ein Mittagessen war schnell gekocht. Einen Vorrat an Lebensmitteln hatten wir immer im Haus. Während des Essens lief der Fernseher: die Tagesschau. Nach Langem waren das die neusten Informationen in Wort und Bild.
Nachdem alle Sachen getrocknet waren und meine Mutti noch neue herausgesucht hatte, machten wir uns erneut auf den Weg nach Lehnin. Der Wetterbericht versprach eine Besserung. Außerdem wollten wir unter diesen Bedingungen unser Zelt nicht länger als nötig unbeaufsichtigt lassen.
Die Fahrt zurück verlief problemlos. Unser Trabi schnurrte wie eine Eins. So erreichten wir zügig das Ortsende von Lehnin. Bis dahin erlebten wir eine ganz gewöhnliche Autofahrt, eben nur bei Regen. Doch was dann folgte, glich wieder einmal einem nicht alltäglichen Abenteuer.
In der langen Zeit, in der es schon regnete, das waren bald 24 Stunden, waren die Waldwege, die zum Zeltplatz führten, so gut wie überflutet. Auch der beste Sandweg ist einmal mit Wasser voll gesogen. Wir konnten nur erahnen, wo in etwa der befahrbare Weg entlangführte. Mein Vater ahnte diesen Umstand schon im Vorfeld und packte sich seine Gummistiefel vorsorglich und griffbereit ins Auto. Wie Recht er damit hatte! Jetzt zog er sie an.
Da der Weg nicht eben war, bildeten sich unterschiedlich große und tiefe Pfützen, die schon eher kleinen Seen glichen. Zwischen diesen lugte immer mal ein winziger Erdhügel heraus. Diese dienten uns sozusagen als Rettungsinseln. Immer wenn wir so eine Insel erreicht hatten, stieg mein Vater aus und schritt mit seinen Stiefeln die nächste Pfütze ab. Er prüfte wo das Wasser in dieser Senke am niedrigsten stand und wo wir am günstigsten durchfahren konnten. Denn Wasser im Vergaser des Autos hätte zum unweigerlichen Ende dieser wahrhaftigen Spritztour geführt. Mein Vater erkundete so jede Pfütze zentimetergenau und fand immer wieder einen Weg, um hindurch fahren zu können. Manche Stellen erwiesen sich dennoch als eine ziemliche Zitterpartie, denn ganz allzeit sicher war sich mein Vater nicht, ob wir durch dieses oder jenes Loch kommen würden. Da half nur ordentlich Gas zu geben und es zu versuchen. Der Motor heulte dann öfters ganz gehörig auf und einige Male fing er auch an zu Stottern. Dann war doch etwas Wasser in den Vergaser gelangt. Wenn wir in so einem Minisee stehen geblieben wären, wäre dies der Gau des Tages schlechthin gewesen! Wir hatten keinen Rollstuhl, ja noch nicht einmal eine Sitzgelegenheit für mich mit. Meine Eltern und mein Bruder hätten aussteigen und zu Fuß gehen können. Doch ich? Ich war außerdem schon zu groß, als dass mich mein Vater drei Kilometer auf seinen Schultern hätte tragen können. Aber glücklicherweise ließ uns unser Trabi an diesem Tag nicht noch einmal im Stich. Mit Bravour meisterte er jedes noch so tiefe Hindernis und brachte uns treu zu unserem Zelt.
Читать дальше