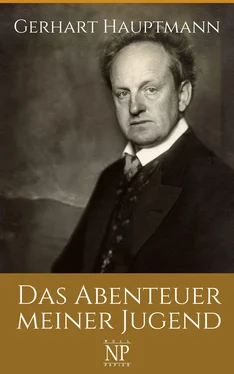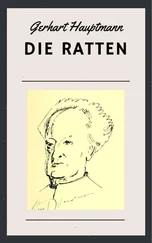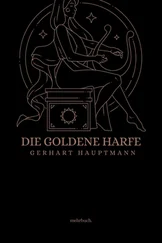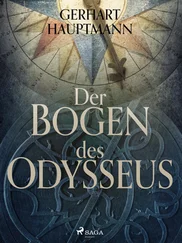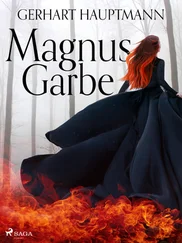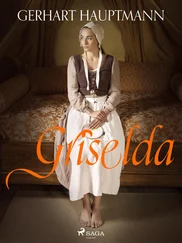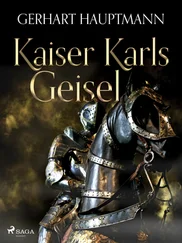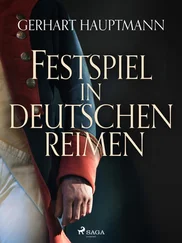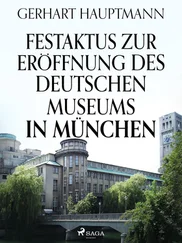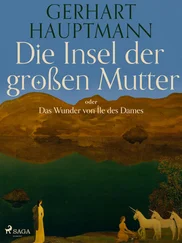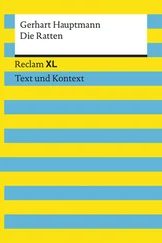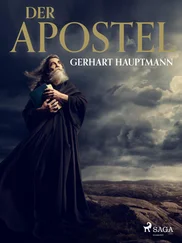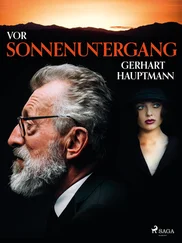Selbstverständlich, dass ich vor dem Eintritt der Gäste alle diese Werke eifrig durchmusterte.
Besonders »Muses et fées« mit seinen durch Gazekleidchen lose verhüllten rosigen Mädchenkörpern entzückte mich. Dann kam die Ilias an die Reihe. Als ich lange das Buch durchblättert und Prosastücke entziffert hatte, ging mir jäh wie ein helles Licht der Gedanke auf, man müsste diese Prosa in Verse umwandeln. Wenn du diese Aufgabe lösen könntest, dachte ich – der Ruhm eines großen Dichters würde damit gewonnen sein.
Ich habe damals weder vom Vorhandensein der Ilias noch der Odyssee noch eines Dichters namens Homer gewusst.
Diese Erkenntnis, der Gedanke, die Ilias zu dichten, die, ohne dass ich es wusste, als Dichtung bereits vorhanden war, die damit verknüpfte Hoffnung des Dichterruhms war eben der silberne Strahl, der keine Mauer zu durchdringen brauchte und sich in freier Ferne in einem silbern-lockenden Nebel verlor.
Irgendeinen Versuch, die gefasste Idee zu verwirklichen, habe ich damals nicht unternommen. Keinerlei Überlegung, sondern höchstens ein unbewusstes Wissen meiner knabenhaften Unzulänglichkeit hielt mich davon zurück.
*
Von großer Bedeutung wurde für mich der dicke Band, der Malereien und plastische Bildwerke Berlins, insonderheit seines Museums, wiedergab. Ich habe zu bekennen, dass mich Murillos »Semele hingegeben dem wolkenhaften Zeus« auf eine rätselhafte Weise angezogen hat, gesünder die Amazone von Kiß, jenes plastische Bildwerk, das noch heut auf der Treppenwange des alten Museums zu sehen ist: in Erz gegossen ein bäumender Gaul, ein nacktes Weib zum Speerwurf ausholend, um einen Panther zu durchbohren, der seine Pranken um die Brust des Pferdes geschlagen hat.
Auch das Denkmal Friedrichs des Großen von Rauch mit seinem Gewirre kleiner Figuren erregte mir Bewunderung, und ich setzte als selbstverständlich voraus, dass nur Halbgöttern, nicht gewöhnlichen Menschen, wie wir es waren, Werke wie das von Kiß und das von Rauch gelingen könnten. Es war eine kindliche Annahme, die ich lange belächelt habe. Heute weiß ich, dass sie zu Recht bestand.
Außer diesen plastischen Bildwerken hatte sich mir von irgendwoher die Ariadne von Dannecker eingeprägt, und ich trug sie als eines von drei Wundern der Kunst im Geiste mit mir herum.
Scheinbare Zufälle sind es meist, durch die folgenschwere Wirkungen ausgelöst werden. Hätte mein Vater nicht wider seine Gepflogenheit eine Gesellschaft gegeben und, um sie anzuregen, den Inhalt seines Bücherschranks ausgelegt, so würde ich weder die Konzeption des großen Homerischen Gedichts haben fassen können, noch hätten sich jene berühmten plastischen Kunstwerke in meiner Vorstellungswelt festgesetzt. An ihnen lernte ich die Wahrheit des Satzes kennen, den Demokritos gesprochen hat, wonach die großen Freuden aus der Betrachtung schöner Werke abzuleiten sind. Hatte die von mir entdeckten eine übermenschliche Kraft geschaffen, so erfüllte sie selber in meinen Augen außer- und übermenschliche Wesenheit. Sie wurden mir in sich und an sich Kultbilder, wie es mir die Kreuzabnahme geworden war und die Raffaelische Madonna im Großen Saal.
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Im Februar erlebte ich einen Faschingsball. Im Maskengewimmel bewegte sich jemand unter einem riesigen schwarzen Dreimaster. Diese ins Gigantische gesteigerte Kopfbedeckung war eigentlich ein Tintenfass, in dem eine Gänsefeder steckte. Das monströse Gebilde zog meine Augen vor allem an und erregte in mir unendliches Staunen. Und mein Staunen steigerte sich, als ich einige Tage später dieses Pappdeckel-Tintenfass in einem Zimmer der Krone entdeckte und erfuhr, dass beim Balle der Kopf meines Vaters darunter gesteckt hatte.
*
Das Vorspiel des Balles innerhalb der Familie zeigte meine Schwester Johanna zugleich als Hauptakteurin und als Unschuldslamm. Es ist insofern merkwürdig, als es wieder Gegensätze und Unstimmigkeiten im Wesen meiner Eltern bloßlegte. Meine Mutter frönte der Tradition, wonach man eine heiratsfähige Tochter ausführte. Diese Gepflogenheit aber, die meine Mutter als schöne Pflicht auffasste, widerte meinen Vater an. Bei der Besprechung zwischen Vater und Mutter, ob man Johanna auf den Ball bringen solle oder nicht, hörte ich meinen Vater sagen: »Tue, was du willst, ich gehe nicht mit; ich müsste mich schämen in Grund und Boden, wenn ich meine Tochter wie ein Pferd auf dem Viehmarkt ausbieten sollte.«
Tante Elisabeth wühlte aus anderen Gründen, nämlich aus Eifersucht, gegen den Ball. Das alternde Mädchen war ziemlich üppig und vollblütig, die Faschingsbelustigung zog sie wie die allersüßeste Lockung der Hölle an, aber sie hätte den Ballbesuch weder vor ihrer Schwester Auguste noch vor ihren pietistischen Freunden verantworten können. Sie fing ihren Feldzug gegen den drohenden Mummenschanz mit Einwänden gegen die zu erwartende gemischte Gesellschaft, gegen die Unsittlichkeit der Maskenfreiheit und ähnliches an, bemäkelte dann die Kostüme, an denen Mutter und Tochter stichelten, und wandte sich gegen die Tanzsünde. Trotzdem sie im Endziel aber mit meinem Vater übereinstimmte, zog sie meistens vor zu verschwinden, sobald er in die Nähe kam.
Tante Elisabeth, deren impertinente Gegenwart meinen Vater allein schon aufreizte, fuhr in diesen Wochen wie eine aufgestörte Hummel zwischen Dachrödenshof und Krone hin und her, beladen mit immer neuen Einwänden, wodurch die Reizbarkeit aller Beteiligten gesteigert wurde. Eines Tages verbot mein Vater dann geradezu Tante Elisabeth das Haus, sprach aber zugleich von Mädchen- und Menschenhandel, an dem er sich keinesfalls beteiligen werde.
Auch meinem Bruder Carl und mir schien das Getue um meine Schwester vor dem Ball etwas Fremdartiges. Musterknaben waren wir nicht. Als wir sie nun von meiner Mutter, der Schneiderin, Tante Elisabeth und den Hausmädchen feierlich wie ein Opferlamm behandelt sahen, ergingen wir uns in allerhand Neckereien, auf die sie je nachdem mit Lachen, mit Erregung oder mit Entrüstung antwortete. Sogar bis zu Tränen brachte sie unsere Unbarmherzigkeit.
Johanna Katharina Rosa nannten wir sie mit den Namen, die sie bei der Taufe erhalten hatte, und fügten einen wahrhaft Rabelaisschen Reim daran. Der Respekt vor der »höheren Tochter« hielt sich nun einmal im häuslichen Kreise nicht. Auch fühlten wir keinen Respekt vor Ballkleidern. Wir malten aus, wie sie ihr zartes Pensionsköpfchen beim Tanz an die Brust des betrunkenen Bauers Rudolf legen würde oder an die des schwindsuchtkranken Briefträgers oder an Glasmalermeister Gertitschkes Kopf, der sich nach Hermann des Cheruskers bei den Römern üblichem Namen Armin nannte.
Читать дальше