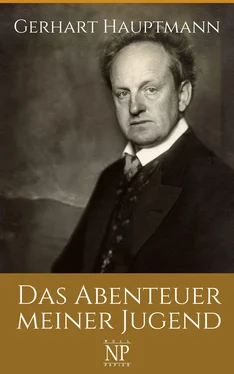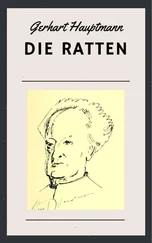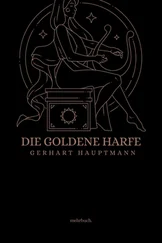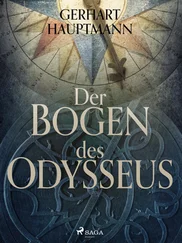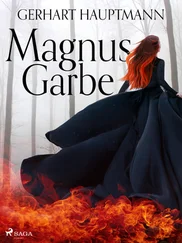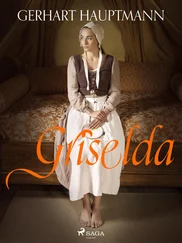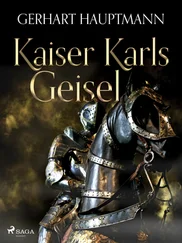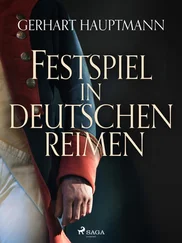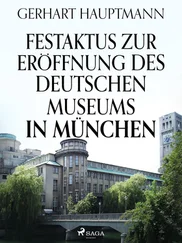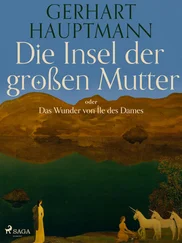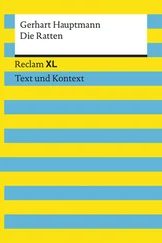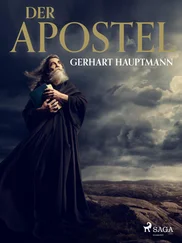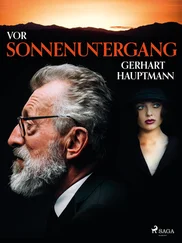Ein resoluter Geist und ein goldenes Herz waren vereinigt in ihr, Eigenschaften, womit sie sich überall durchsetzte.
»Das größte Zartgefühl schulden wir dem Knaben«, sagt Juvenal. Es war auch der Grundsatz, nach dem ich im Kurländischen Hof behandelt wurde. Hier erschloss sich mir ahnungsweise ein bis dahin unbekanntes Bildungsgebiet, wenn es mich vorerst auch nur sehr gelegentlich und sehr flüchtig berühren mochte. Eine gewisse Verwandtschaft bestand allerdings zwischen diesem Hause und Dachrödenshof als den letzten Ausläufern einer Kultur, die im großen ganzen versunken war.
*
In der Umgebung des Fräuleins von Randow herrschte der Geist heiter-ernster Weltlichkeit, der keine moralische Schärfe zeigte und es einem ganz anders als in der scharfen Atmosphäre um das bucklig-fromme Täntchen Auguste wohlwerden ließ, deren spitze Blicke und spitzere Worte fortwährend Kritik übten. Welche der beiden Geistessphären an sich tiefer und bedeutsamer war, entscheide ich nicht.
Es war der Kummer meiner Mutter, dass mein Vater zu seiner Tochter Johanna, solange sie Kind war, kein freundliches Verhältnis gewinnen konnte. Er schien sie immer zurückzusetzen. Es war nicht zu ergründen, ob dies nun nach Hannchens gleichsam triumphaler Rückkehr aus der Pension anders geworden war. Immerhin schien sich mein Vater zurückzuhalten, und wahrscheinlich hatte meine Schwester im Kurländischen Hof mit der imponierenden adligen Dame und ihrer resoluten und gebildeten Pflegetochter einen neuen und starken Rückhalt gefunden.
Dieser Rückhalt verstärkte sich.
Er führte alsbald im Dachrödenshof und sogar bei meiner Mutter zu Eifersucht.
Tante Auguste und Fräulein Jaschke hatten einander nichts zu sagen und mieden sich. Elisabeth stand Fräulein Jaschke näher, da sie immer noch Hoffnungen weltlicher Art nährte, aber das Verhältnis war kriegerisch. Nie ist zwischen beiden das Kriegsbeil vergraben worden. Meistens war es die Seele Johannas, um die man auf beiden Seiten stritt, Elisabeth im zelotischen Sinn, Mathilde ihren Zögling verteidigend.
1 auf der Lehre des Aristoteles beruhend <<<
2 Piedestal = (meist aufwendig gestalteter) Sockel <<<
3 Großgrundbesitzer und Junker <<<
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Anders und tiefer war der Kampf, den meine Mutter damals, durch Jahre, um die Seele der Tochter kämpfte, die ihrer Meinung nach ihre kindliche Pflicht vergaß und in ein fremdes Lager überging.
Wie meine Mutter fühlte und nicht fühlte, lebte sie in einer Art Aschenputtelexistenz. Gram und Kummer deswegen waren vielfach auch mir gegenüber zum Ausdruck gekommen. Sie setzte instinktiv bei Johanna ein ähnliches Fühlen voraus. Vielleicht schwebte ihr von dieser Seite eine Entlastung vor, die sie anderwärts nicht erhoffen konnte.
Johanna ging einen anderen Weg. Obgleich sie, wie mein Vater es nannte, als Siebenmonatskind nur ein kleines Leben war, bestand ein starker Wille in ihr, den auch ich nicht selten zu spüren bekam. Sie schwieg, wo sie anderer Meinung war, verharrte jedoch umso fester auf ihrer. Das Beispiel der Mutter, die in den Sorgen und der Mühsal des Haushaltes ertrunken war, glich einer immerwährenden Warnung, aus Willensschwäche einem ähnlichen Schicksal anheimzufallen. Nein! Eier quirlen, Bouillon abraumen, Knochenbänder durchhauen, Hühner und Fische schlachten, Pfannen reinigen, scharfen Fettdunst einatmen, Bohnen schneiden, Schoten auspahlen, Kirschen entkernen, Strümpfe stricken und Strümpfe stopfen lag meiner Schwester nicht.
Unwiderstehlich fühlte sie sich vielmehr durch die vornehme Geistigkeit des von Randowschen Kreises angezogen, wo man Englisch und Französisch trieb, deutsche Dichter las und am Klavier Mozart, Schubert und Beethoven pflegte.
Die Auseinandersetzungen zwischen meiner Mutter und meiner Schwester, die nicht selten in meiner Gegenwart stattfanden, steigerten sich mitunter zu großer Heftigkeit. Meine Mutter war hierin kurzsichtig. Wäre Johanna ihr gefolgt, wahrscheinlich wäre sie zeitig zugrunde gegangen, denn eine Entwicklung, wie die hier für sie erstrebte, war für sie bei der Zartheit ihrer Anlage Unnatur.
Eine Art Lebenstaumel beherrschte den Badeort, der in dieser Saison den Zustrom von Gästen kaum bewältigen konnte. Während des Trubels inmitten der Julihitze hieß es plötzlich, dass das Fräulein von Randow gestorben sei. Ich schlang gerade wieder einmal mein Mittagessen in der Büfettstube, als mir die Mitteilung gebracht wurde. Im Vorraum kamen und gingen die Kellner und machten mit lauter Stimme ihre Bestellungen. Ich war nicht wenig überrascht, als in meinem abgelegenen öden Raum eine vornehme Dame in tiefer Trauer erschien, die mich nach meinen Eltern fragte. Die Erscheinung war nicht nur wegen der schwarzen Tracht auffällig. Ein blasses, edles Gesicht mit brennenden Augen ward sichtbar, als die Dame den Schleier zurücklegte. Voll Ungeduld ging sie hin und her.
Endlich, als ob sie die Fremde gesucht hätte, trat meine Schwester Johanna ein, entschuldigte die leider unabkömmlich beschäftigten Eltern und entfernte sich mit der Besucherin.
Es sei eine Baronin Maria von Liebig, sagte man mir, eine Freundin von Fräulein Jaschke, die zum Begräbnis von deren Pflegemama eingetroffen war.
Johanna nahm mich mit in den Kurländischen Hof. Hier war das Fräulein aufgebahrt; ein schweres Brokatkleid ist mir erinnerlich, dessen Schleppe man über den Rand des metallenen Sarges bis zur Erde drapiert hatte.
Ich habe vermöge meiner offenen und anschmiegsamen Natur vielen einfachen Leuten, Kutschern, Hausdienern, Dienstmädchen und Kellnern, wie meinesgleichen nahegestanden. Ich hatte mich in diesem Sommer an einen lustigen, liebenswürdigen Sachsen besonders angeschlossen, der als Kellner auch von meinem Vater bevorzugt wurde und sehr tüchtig war. Überraschend hatte sich dieser bis dahin so eifrig tätige Mensch aus dem Dienst entfernt, kam nicht zurück und wurde da und dort in den Kneipen des Orts gesichtet, wo er, ohne grad im Trinken auszuschweifen, seiner Umgebung Reden hielt.
Dieser junge George oder Fritz oder Jean, mit Strohhut, Stöckchen und elegantem Sommerpaletot, stand eines Tages, während ich speiste, vor mir in der Büfettstube. Er schwenkte sein Stöckchen, hob den Hut, wischte mit einem seidenen Taschentuch seine Stirn und fragte mit einer mir an ihm fremden Ungeniertheit: »Sagen Sie, Gerhart, wo ist Ihr Vater?« Ich war erschreckt, denn ich merkte, dass etwas bei ihm nicht in Ordnung war. Als ich zunächst durch Schweigen antwortete, fiel ihm das, wie mir schien, nicht auf. Er pflanzte sich vor den Spiegel und bürstete sorgfältig seinen Scheitel, der tadellos von der Stirn bis zum Nacken ging. Er müsse meinen Vater sprechen, erklärte er, weil er ein Geheimnis entdeckt habe. Er sagte das aber nicht zu mir, sondern führte ein Selbstgespräch, währenddessen er meine Gegenwart, wie ich fühlte, vergessen hatte. »Ich habe ein Geheimnis entdeckt!« war der Schluss, der sich wohl zwanzigmal wiederholte.
Читать дальше