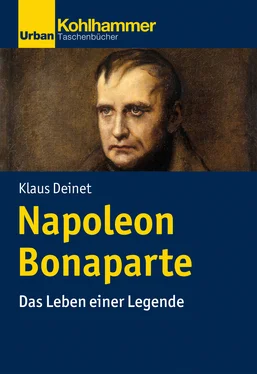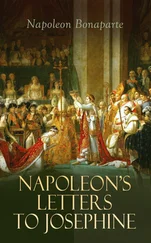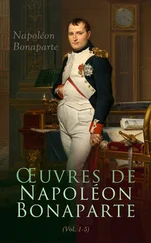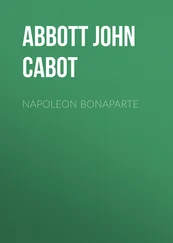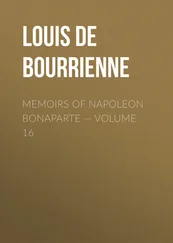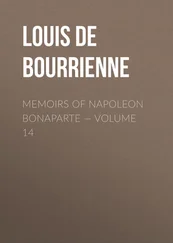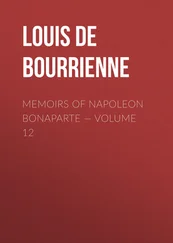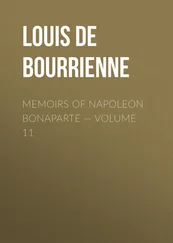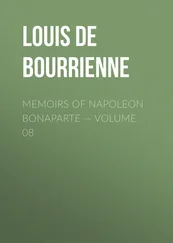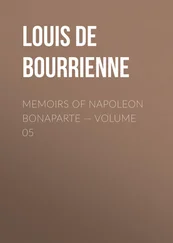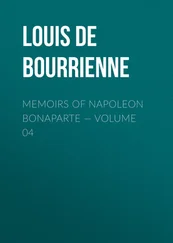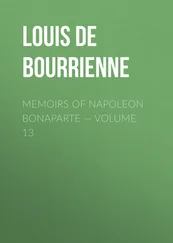War Napoleon also Italiener? Seine Vorfahren fühlten sich lange Zeit als solche. Sie hatten sich von der Seerepublik Genua, zu der ihre ursprüngliche Heimat Sarzana gehörte, durch Steuervergünstigungen und Aufstiegschancen auf die Insel locken lassen. Hier haben sie es zu einem beachtlichen Wohlstand gebracht, der mit einem Adelstitel einherging. Die vom Festland stammenden Familien bildeten eine schmale Elite in den von Genua kontrollierten Hafenstädten, während das Inselinnere weitgehend sich selbst und seinen archaischen Normen überlassen blieb. Die Angehörigen dieser Familien – die Pozzo di Borgo, Paravicini, Saliceti, Ramolino – heirateten untereinander, solange sie an Ansehen einander ähnelten. Napoleons Vater hatte das Glück gehabt, eine Tochter aus dem Clan der Ramolino, die erst vierzehnjährige Laetitia, zu ehelichen, obwohl der Stern der Buona Parte zu dieser Zeit wegen misslungener Bodenspekulationen schon im Sinken begriffen war.
Aber Napoleon als Italiener zu bezeichnen, wäre ebenso falsch, wie ihn wie selbstverständlich zum Franzosen zu erklären. Gewiss, die Intellektuellen unter seinen Verwandten studierten zumeist auf dem Festland, in Florenz, Pisa oder Neapel, und bedienten sich des Italienischen als einer dem eigenen Idiom nahen Lehnsprache. Aber Napoleon kam erst 1797 als General einer französischen Armee nach Italien und sah sich durchaus nicht als Italiener – auch nicht 1805, als er sich im Dom von Mailand die langobardische Krone aufsetzte. Seine Familie mochte sich im Verlauf seiner Eroberungen und auch noch nach seiner Abdankung allmählich wieder der ursprünglichen Heimat assimilieren. Er selbst tat dies nicht. Kaum etwas brachte ihn später so sehr in Rage, als wenn sein Name italienisch – Buonaparte – buchstabiert wurde. Geschah dies noch dazu mit französischer Aussprache des »u« als »ü«, wie es Chateaubriands berühmtes Pamphlet von 1814 suggerierte, kochte er vor Wut. 6
Napoleon war also Korse. Aber was besagte das? Die Spezialisten sind sich bis heute uneins, ob man von einer korsischen Nation sprechen kann. 7 Im Grunde zerfiel die Inselbevölkerung in die Bauern auf dem Lande und die Bewohner der wenigen Hafenstädte. Mit der Zeit war eine Symbiose zwischen den beiden Zivilisationen entstanden, aber es ist höchst zweifelhaft, ob sich im 18. Jahrhundert bereits eine korsische Identität im eigentlichen Sinne ausgebildet hatte. Gerade deshalb faszinierte Korsika die aufgeklärten Europäer des 18. Jahrhunderts. Die Insel, die seit dem 13. Jahrhundert unter der Herrschaft Genuas stand, versprach ihnen gewissermaßen ein Abbild des ›authentischen Wilden‹, den man eigentlich in Amerika oder im Stillen Ozean verortete, quasi vor den eigenen Toren. Der Schotte James Boswell, der die Insel im Jahr 1764 bereiste, trug mit seinen Publikationen, die am ehesten der Reiseliteratur zugerechnet werden können, wesentlich dazu bei.
Im Licht solcher Reiseliteratur waren die Bauernaufstände, die es seit 1729 gegen die Herrschaft Genuas gab, Vorboten einer künftigen großen Revolution. Das gilt umso mehr, als sich prominente Männer des Festlandes auf die Seite der Aufständischen stellten. Der österreichische Baron von Neuhaus ließ sich von einer ›consultà‹ zum König von Korsika proklamieren und hoffte (vergeblich) auf englischen Beistand. Der Neapolitaner Pasquale Paoli errichtete in der Stadt Corte im Inselinneren eine Art Hof, gründete die noch heute bestehende Universität und ließ sich von Jean-Jacques Rousseau eine eigens für die Insel entworfene Verfassung im Geiste des Contrat social schreiben. Auch versuchte er, die von den Genuesen zu Hilfe gerufenen Franzosen aus den Hafenstädten zu vertreiben.
An seiner Seite befand sich Napoleons Vater, Carlo Buona Parte. Als aber auch dieser Befreiungsversuch 1769 scheiterte und Paoli eine britische Fregatte betrat, um sich nach London ins Exil zu begeben, blieb der einheimischen Elite nur die Wahl, entweder den Weg in den Untergrund zu beschreiten oder sich mit den neuen Herren aus Frankreich zu arrangieren. Die Buona Parte wählten den zweiten Weg. Carlo, der gerade noch Paoli assistiert hatte, wurde als »Charles Bonaparte« die rechte Hand des mächtigen Mannes, den die neue Staatsmacht als ihren Vertreter und Verwalter auf die Insel schickte: Baron Marbeuf.

Abb. 1: Die Eltern Napoleons – links der Vater Carlo Maria Bonaparte (1746–1785) in einem Gemälde aus der Zeit 1766–1779 von Anton Raphael Mengs; rechts die Mutter Laetitia Ramolino (1750–1836) in einem Gemälde (um 1802) von François Gérard.
Die Gestalt Marbeufs, der selbst aus der armen Bretagne stammte und ein Gespür für die Kluft besaß, die sich zwischen der hochzivilisierten Pariser Gesellschaft und den entlegenen und sich selbst überlassenen Provinzen auftat, muss dem Knaben Napoleon zum ersten Mal eine Ahnung von dem vermittelt haben, was »Frankreich« bedeutete. Sein Name stand für Macht, Luxus und Aufstiegschancen. Carlo schaffte es, seine beiden ältesten Söhne in Positionen unterzubringen, die das neue Regime für die ihm Wohlgesonnenen unter dem heimischen Adel bereithielt: einen Platz im Priesterseminar für den erstgeborenen Joseph, die Aufnahme in eines der dem Adel vorbehaltenen Militärinternate für den zweitgeborenen Sohn Napoleon. Ob mit solchem Entgegenkommen ein Preis für anderweitige Dienste entrichtet wurde, die Laetitia dem als Frauenheld verschrienen Gouverneur geleistet hatte, wurde gelegentlich vermutet, blieb aber unbewiesen. Sicher ist, dass die schöne Korsin ihrem umtriebigen Ehemann in vielfacher Hinsicht zur Hand ging. Auf jeden Fall war sie, die manche ihrer 13 Kinder überlebte und erst als 85-jährige Matriarchin im Februar 1836 in Rom starb, die treibende Kraft in der Familie. Eine Notwendigkeit, die sich nicht zuletzt daraus ergab, dass sie den Ehemann schon früh ersetzen musste, der kaum 39-jährig 1785 in Montpellier an Magenkrebs starb.
Wie muss man sich also das erste Lebensjahrzehnt des am 15. August 1769 geborenen Napoleon vorstellen? Dass der Knabe, anders als sein Bruder Joseph, zum »Bestimmer« taugte, hat Laetitia früh an ihm bemerkt. Er sei das schwierigste ihrer Kinder gewesen, hat sie später gesagt, und mehr als einmal habe sie zu Ohrfeigen, einmal auch zu einer Tracht Prügel als Erziehungshilfe greifen müssen, zumal der geschäftige Vater die meiste Zeit abwesend war. 8 Auch zeigte sich bald, dass die Anlagen des Jungen über ein bescheidenes Dasein als Advokat oder Notar hinausstrebten und nach mehr verlangten, als es die Insel mit ihren nur rudimentären Bildungschancen bieten konnte. Die Unterrichtsstunden, die ihm der Abbé Recco erteilte, hatten in ihm die Liebe zur Mathematik geweckt. Zu mehr aber, zum Erlernen der französischen Sprache, zu geregeltem Wissenserwerb über die paar Brocken Latein hinaus, die ihm der Kirchenmann beibrachte, war der Aufenthalt auf dem Kontinent erforderlich.
Stationen einer Militärlaufbahn
So teilte Napoleon schon früh die zwiespältige Erfahrung dessen, der aus einem armen Land in eine höherentwickelte Zivilisation wechselt. Denn das starke und spendable Frankreich, das ihm in Bastia, dem Sitz des Gouverneurs, und auf dessen Privatanwesen in Gestalt Marbeufs entgegentrat, hatte auch eine andere, weniger sympathische Seite. Diese lernte er kennen, als der Vater die beiden Ältesten auf eine Reise mitnahm, die ihn als Vertreter der korsischen Stände zum König nach Versailles führte. Die beiden Söhne begleiteten ihn allerdings nicht bis in die französische Hauptstadt. Der Vater ließ die Kinder in Autun zurück, wo sie im Priesterseminar des Bischofs, eines Verwandten Marbeufs, binnen drei Monaten die französische Sprache und Schrift erlernen sollten. Von hier nahm ein anderer Bekannter Marbeufs den Neunjährigen mit nach Brienne-le-Château, wo dem Jungen die dortige Militärakademie zur Ausbildung zugewiesen worden war.
Читать дальше