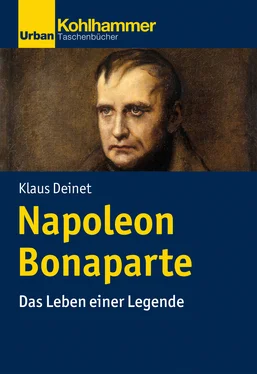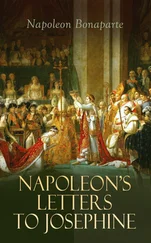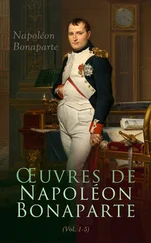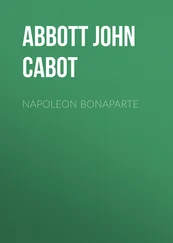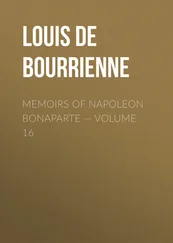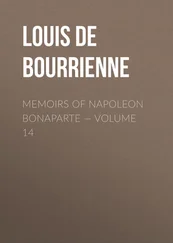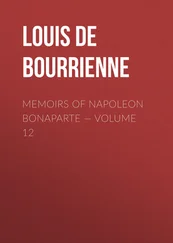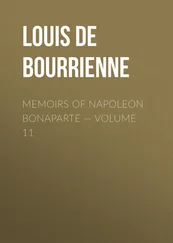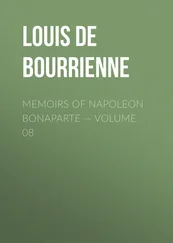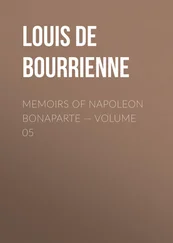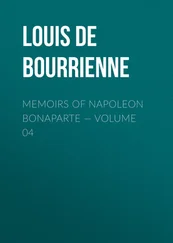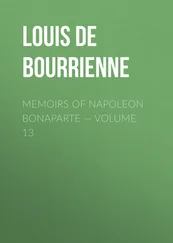3. Die Konstante in allen Verästelungen dieses Entwicklungsbogens, dessen schiere Dramatik die Zeitgenossen ebenso in ihren Bann schlug wie die Nachwelt, ist Napoleons Persönlichkeit. Die in seinem Charakter angelegten Impulse erklären nicht nur den frühen Aufstieg, sondern auch das maßlose Weiterschreiten und die Verbohrtheit beim Abstieg. Insofern sind die genannten Versuche, seine Karriere in die erste Hälfte eines ›guten‹ und die andere eines ›schlechten‹ Diktators zu teilen, ebenso wenig überzeugend, wie die Entscheidung Gueniffeys, seine Lebenserzählung einfach im Jahre 1804 abzubrechen und der Biografie den Titel Bonaparte zu geben – gerade so, als hätte der spätere Kaiser Napoleon I. den Bonaparte in sich betrogen und aus dem Revolutionsvollender den Gewaltherrscher gemacht, dessen Leben und Wirken zu erzählen sich nicht mehr lohnte.
Aus dem Genannten ergibt sich: Napoleon Bonaparte ist nur in seiner gesamten Entwicklung, also chronologisch, zu begreifen und in seiner Person als eine Einheit aufzufassen. Deshalb wird Wert auf die frühen Jahre gelegt, in denen sich bestimmte Züge seines Charakters ausgebildet haben, die auch in den Zeiten des Ruhms, als an seinen Entscheidungen das Leben Zehntausender hing, zum Zuge kamen. Wichtig ist angesichts des Übermaßes der zeitgenössischen Zeugnisse, die teilweise in extenso und ohne allzu viele Bedenken ausgebeutet wurden, eine Beschränkung auf verlässliche Quellen. Dabei haben die Selbstzeugnisse, die nunmehr in einer mustergültigen Form vorliegen, keineswegs einen geringeren Aussagewert als die Beobachtungen derer, die mit ihm zu tun hatten und sich dabei oft selbst in ein entsprechendes Licht rücken wollten. 2
Eine wenig beachtete, aber nicht zu vernachlässigende Quelle bilden die Zeugnisse deutscher Zeitzeugen, die den jungen Bonaparte aus der Nähe beobachteten – so vor allem Konrad Engelbert Oelsner und Gustav von Schlabrendorf, die beide das Egomanische seines Wesens früh erkannt haben. Für die spätere Zeit ist Armand de Caulaincourt ein Hauptzeuge, dessen von Gabriel Hanotaux edierte Memoiren dem Menschen Napoleon Bonaparte in seiner psychischen Unmittelbarkeit sehr nahekommen. Caulaincourt war nämlich bei der mehrtägigen Rückreise aus Russland im Dezember 1812 der einzige Gesprächspartner Napoleons. Der französische Aristokrat war ein kritischer Verehrer Napoleons und ein glühender Patriot, der bis zur Preisgabe des eigenen Lebensglücks die Interessen Frankreichs und die Charaktereigentümlichkeiten Napoleons miteinander zu versöhnen trachtete: ein hoffnungsloses Unterfangen, bei dem er von Metternich ebenso manipuliert wurde, wie er an Napoleons Starrsinn scheiterte.
Methodisch muss eine kurze Biografie auf viele Details verzichten, die sich in den umfangreichen Werken (von Thiers über Kircheisen bis zu Madelin) in oft langatmiger Fülle ausgebreitet finden. Es geht vielmehr darum, die Scharnierstellen herauszuarbeiten, die zeigen, dass die skizzierte Linie von Auf- und Abstieg kein zwangsläufiges Geschehen war, sondern auf Entscheidungen beruhte, die vielfach – nicht immer – Napoleon selbst traf. Es sollte deutlich werden, dass ihm bis 1813 Handlungsräume zur Verfügung standen, aus denen er Alternativen hätte auswählen können. Der Aspekt ›Deutschland und Napoleon‹, der um das Jubiläumsjahr 2004 herum sehr breit behandelt wurde, wird dagegen im Rahmen des chronologischen Fortschreitens der Erzählung nur gestreift. Ebenso können die zahlreichen Schlachtverläufe, die bis heute das gesteigerte Interesse der Geschichtsschreibung finden, nur kursorisch verfolgt werden, auch wenn sich gerade hier das vielgepriesene Genie des Korsen ebenso zeigte wie die Schattenseiten seines Charakters. Von einzelnen Skizzen wie im Falle von Austerlitz, Aspern-Essling und Waterloo abgesehen, verzichten wir auf detaillierte Schlachtbeschreibungen, verweisen aber auf die akribischen Studien vor allem angelsächsischer Historiker. Nicht durch Detailfülle, sondern durch kritische Akzentuierung soll die vorliegende Biografie die Verzeichnungen und Defizite, die zumal das Bild Napoleons in Frankreich immer noch prägen, aufzeigen und geraderücken.
I. Bonaparte
Ob man ihn nun als ihren Vollender oder als ihren Bezwinger ansieht: In jedem Fall konnte Napoleon Bonaparte später zu Recht von sich behaupten, ein ›Sohn‹ der Französischen Revolution zu sein. Denn ohne diese Revolution ist seine Karriere als Militär wie auch sein Aufstieg an die Spitze der politischen Macht nicht denkbar. Als 1769 Geborener gehörte er zur jüngeren Alterskohorte einer um die Mitte des 18. Jahrhunderts geborenen Generation, die wie keine andere die Geschichte Frankreichs geprägt hat und deren Einfluss noch bis weit in das 19. Jahrhundert hineinreichte.
Diese Verbindung war nicht von Anfang an vorgezeichnet. Als Abkömmling der gerade erst Frankreich einverleibten Insel Korsika verfolgte der junge Offizier die Anfänge der Revolution ab 1789 vornehmlich unter dem Gesichtspunkt, wie er ihre Impulse für seine Heimat nutzbar machen konnte. Erst 1793 plädierte er rückhaltlos für Frankreich, in einem Moment, als nach der Hinrichtung des Königs Ludwig XVI. und der Kriegserklärung der meisten europäischen Monarchen an die junge Republik das Überleben des revolutionären Frankreich an einem seidenen Faden hing. Der tödliche Konflikt innerhalb der Volksvertretung zwischen Girondisten und Jakobinern war zugleich ein Konflikt zwischen der Hauptstadt und der Provinz, nämlich zwischen den hinter den Jakobinern stehenden Pariser Massen und einigen mächtigen Städten des Südens und Westens. Der Konvent, also die 1792 nach allgemeinem Männerwahlrecht gewählte Nationalversammlung der neuen Republik setzte eine provisorische Exekutive in Form des zwölfköpfigen Wohlfahrtsausschusses ein. Dieser mit außerordentlichen administrativen und jurisdiktionellen Befugnissen ausstatteten Notstandsregierung gelang es, das demografische Gewicht der loyal gebliebenen Landesteile und der übergroßen Hauptstadt in die Waagschale des Krieges zu werfen und so der ausländischen Invasion ebenso Herr zu werden wie der separatistischen Tendenzen in Lyon, Marseille und Bordeaux. Bevollmächtigte des Konvents, darunter Bonapartes späterer Protektor Barras, gingen dabei mit äußerster Brutalität vor und ließen Hunderte von Todesurteilen vollstrecken. Mit gleicher Härte verfuhren Sondergesandte des Wohlfahrtsausschusses gegen Armeeführer, die keine Erfolge vorzuweisen hatten. Der erste Gatte von Napoleons späterer Frau Joséphine de Beauharnais endete auf diese Weise 1794 auf dem Schafott.
Zum Symbol der militärischen Wende wurde im September 1793 die wichtige Hafenstadt Toulon, die sich der englischen Flotte ausgeliefert hatte. Indem der junge Artilleriehauptmann Bonaparte Toulon für den Konvent zurückeroberte, verhinderte er ein Zusammenwachsen von Bürgerkrieg und Invasion von außen. Von nun an gingen Revolution und Krieg Hand in Hand, was paradoxerweise zur Folge hatte, dass nach den großen militärischen Erfolgen des Jahres 1794, der Eroberung Belgiens und des linken Rheinufers der Druck auf die Notstandsregierung nachließ und die gemäßigte Mehrheit der Konventsabgeordneten sich der Quasi-Diktatur des Wohlfahrtsausschusses entledigte. Auf die Hinrichtung des Revolutionärs Maximilien Robespierre und seiner Clique, die den Ausschuss und den Konvent über ein Jahr lang unter ihrer Fuchtel gehalten hatten, folgte eine Säuberungswelle, der die meisten der vom Wohlfahrtsausschuss eingesetzten Funktionäre und Armeevertreter zum Opfer fielen. Als Protegé von Robespierres Bruder Augustin wäre die Karriere (und das Leben!) des Artilleriehauptmanns Bonaparte hier fast schon zu Ende gewesen, doch kam es ihm zugute, dass er der politischen Macht noch nicht so nahegekommen war, dass er zum engeren Kreis der Männer um Robespierre gezählt wurde.
Читать дальше