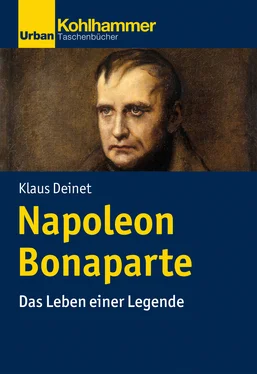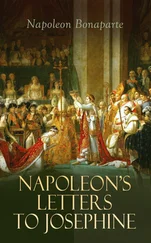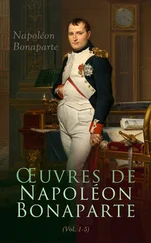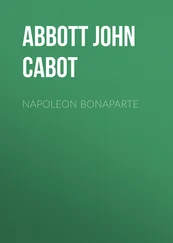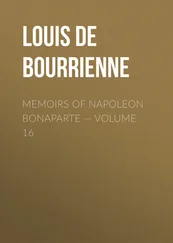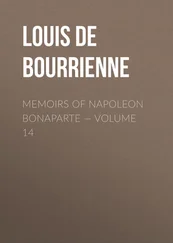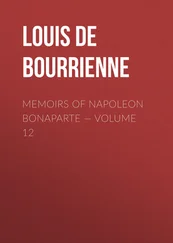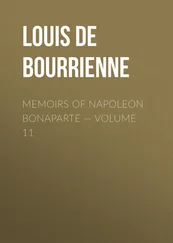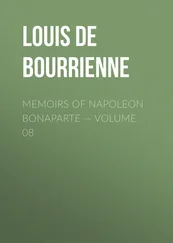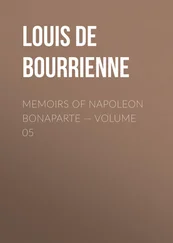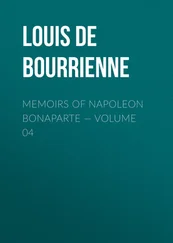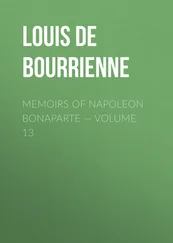Schon 1797 war er der populärste Mann Frankreichs, zumal sein Rivale Hoche kurz zuvor gestorben war. Doch erst das Ausscheiden Reubells aus dem Direktorium und die sich bedrohlich zuspitzende militärische Situation im Sommer 1799, die eine neue alliierte Invasion fürchten ließ, schuf die Voraussetzung für einen erfolgversprechenden Griff nach der Macht. Auf Reubell folgte als Nachfolger im Fünfergremium Emmanuel Joseph Sieyès, der 1789 als Mann der ersten Stunde die Revolution entscheidend auf den Weg gebracht hatte. Von ihm erhofften sich viele eine Überwindung der sich als unbrauchbar erweisenden Verfassung. Sieyès suchte angesichts der äußeren Bedrohung nach einer Verstetigung der Exekutive, um der neojakobinischen Agitation, die nach einer neuen Terreur wie 1792/1793 rief, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das römische Beispiel vor Augen, spekulierte er mit einem Verfassungsmodell, das zwei oder drei Konsuln vorsah. Dabei hielt er nach einem General Ausschau, der nach außen und auf dem Schlachtfeld genug Autorität besaß, ohne dass von ihm zu befürchten war, dass er die Alleinherrschaft anstrebte oder, wie Cromwells früherer Gefolgsmann Monk im England des Jahres 1660, die alte Monarchie zurückholen würde. Bonaparte kam genau im richtigen Moment aus Ägypten zurück, um in diese Leerstelle einzutreten. Wie er dann in den Wochen nach dem Staatsstreich des 9. November 1799 (18. Brumaire) seine Helfer ausmanövrierte und die Macht durch informelle Manöver an sich riss, ging allerdings weit über das hinaus, was Sieyès vorausgesehen und angestrebt hatte.
Die folgenden vier Jahre des Konsulats bilden, im historischen Rückblick gesehen, eine Übergangszeit zum Empire, mit dem Napoleon bis heute identifiziert wird. Aber das konnten die Zeitgenossen noch nicht wissen. Für sie war das Konsulat, das Bonaparte schrittweise in Richtung auf eine Alleinherrschaft ausbaute, der so lange herbeigesehnte Abschluss der Französischen Revolution, nach innen mit den großen Gesetzen wie dem Konkordat und dem Code civil, nach außen mit den Friedensschlüssen von Lunéville und Amiens. Manche Historiker, vor allem die republikanisch Gesinnten, abstrahieren gerne von der Fortsetzung seiner Herrschaft als Kaiser und betrachten die Konsulatsjahre bis heute als Vollendung der Französischen Revolution. Sie können sich dabei auf Napoleons späteres Wort berufen, er habe damit »Granitmassen« in den Boden Frankreichs versenkt, die mehr wögen als seine gewonnenen Schlachten. Tatsächlich hat die administrative Struktur, die damals in erstaunlich kurzer Zeit geschaffen wurde, lange – vielfach bis heute – gehalten.
Aber eine solche Geschichtserzählung lässt den Faktor Napoleon Bonaparte außer Acht. Er hat sich nie mit diesem Ende der Revolution abgefunden, weder mit einem Frankreich in den Grenzen Galliens noch mit einem halb republikanischen, halb monarchischen Zwitterstatus als Erster Konsul auf Lebenszeit. Was er wollte, war das, was alle Gründerväter der Geschichte wollten: Dauer. Und so ließ er sich 1804 zum Kaiser proklamieren und versuchte, aus seinem korsischen Familienclan eine neue europäische Dynastie zu formen, der er fünf Jahre später durch die Heirat mit der Tochter des Habsburgerkaisers die historische Weihe zu geben meinte. Tatsächlich wählte er so den Weg in seinen eigenen Untergang.
Eine Karriere (1769–1796)
Vergleicht man Napoleons frühe Jahre mit denen seiner gleichaltrigen Kameraden wie Hoche, Jourdan, Augereau, Joubert, aber auch den später erbitterten Feinden wie Pichegru und Moreau, so wird schnell klar: Die Armee war der große Katalysator, der talentierten jungen Männern außergewöhnliche Aufstiegschancen bot. In einer Zeit, in der überkommene Schranken wegfielen und jahrhundertealte Strukturen einer hierarchisch gegliederten Ständepyramide wegbrachen, konnten Menschen von ›ganz unten‹ in kurzer Zeit in Spitzenpositionen gelangen. Zunächst noch allmächtiger Diener, ja Retter der Nation unter der Rute des Wohlfahrtsausschusses, entwickelte sich die Armee nach dem Sturz Robespierres rasch zur eigentlichen Macht im Staate. Und spätestens nach dem Fructidorputsch im Jahr 1797, den das Direktorium nur mit Hilfe der Armee inszenieren konnte, war klar, dass die politische Macht jederzeit von der Herrschaft eines siegreichen Generals abgelöst werden konnte. Die Frage war nur noch, wer dieser General sein würde.
Für Napoleon galt es daher, in den Kreis jener Kandidaten zu gelangen, aus dem der künftige »Retter« Frankreichs ausgewählt werden würde. Dieser Aufstieg gestaltete sich keineswegs geradlinig und fand zudem mit einer gewissen Verzögerung statt. Anders als bei Jourdan oder Pichegru hing Napoleons Avancement nicht von einer spektakulär gewonnenen Schlacht oder einem siegreichen Feldzug ab, sondern verlief in Etappen. Diese waren von Wartezeiten unterbrochen, die sehr wohl auch zu seinem vorzeitigen Verschwinden von der politisch-militärischen Bühne hätten führen können und die ihn einmal fast das Leben gekostet hätten. Dass er es dennoch nach ›ganz oben‹ schaffte, verdankte er außer dem Zufall und einigen glücklichen Beziehungen nicht zuletzt seiner stupenden militärischen Begabung.
Der Junge aus Ajaccio (1769–1788)
Franzose – Italiener – Korse
War Napoleon Franzose? Über diese Frage ist viel gestritten worden. Zumal von französischen Historikern wurde sie vehement bejaht. Es sei »noch niemals dagewesen, daß die Franzosen sich einem Manne hingaben, der nicht wenigstens von irgendeiner Seite her zu ihrem eigenen Lande gehört hätte«, erklärte kategorisch Jacques Bainville. 1 Nüchterner, aber mit der gleichen Schlussfolgerung, liest es sich bei einem seiner jüngsten britischen Biografen, Andrew Roberts, für den er ein »Korse mit italienischen Wurzeln« war, aus dem »die Erziehung in Frankreich einen Franzosen gemacht hat.« 2 Gegen das Hauptargument der Gegenseite, dass er nach Sprache und Herkunft ein Fremder war, wetterte Louis Madelin mit den Worten:
»Ob der Mann, so wie er sich der Welt präsentierte, an den Ufern der Loire, der Seine, des Rheins, der Donau oder der Elbe geboren wurde: wir nennen ihn einen ›Römer‹ durch seinen Charakter, das sagt alles.« 3
Damit zielte er auf die spezifisch französische Definition von Nationalität, die jeden, der der ›citoyenneté‹ angehört oder diese aus freien Stücken angenommen hat, unabhängig von seiner Herkunft, Sprache und Hautfarbe als Franzosen ansieht.
Doch es bleibt ein leiser Vorbehalt. Auch wenn Napoleons Vita das Musterbeispiel einer gelungenen Assimilation darstellte, ist es zweifelhaft, dass das Franzose-Sein ihm jemals zur selbstverständlichen Natur geworden ist. Bainvilles Bemerkung, dass die Eindrücke an der Militärakademie in Brienne ihn befähigt hätten, »Frankreich zu verstehen und zu ihm zu sprechen«, 4 bestätigt ungewollt diesen Verdacht. Denn um ein Land zu verstehen und »zu ihm zu sprechen«, muss man außerhalb desselben stehen. Selbst in der Art und Weise, wie Napoleon später, zuletzt in seinem Testament, von dem »französischen Volk« gesprochen hat, das er »so sehr geliebt« habe und inmitten dessen er begraben sein wollte, kommt die Distanz desjenigen zum Ausdruck, der von außen gekommen war und der Frankreich als einem Gegenüber begegnete, dem er sich anverwandelte. 5
Was aber, wenn nicht Franzose, war er dann? Auch diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Im Jahr von Napoleons Geburt gehörte Korsika gerade seit zwei Jahren zu Frankreich, das die Insel offiziell noch im Namen Genuas verwaltete. Doch hatte die administrative und kulturelle Inbesitznahme schon begonnen und die französische Regierung ließ erkennen, dass sie nicht daran dachte, Korsika jemals wieder den hochverschuldeten Genuesen zurückzugeben. Alles, die militärische Inbesitznahme und die Umwandlung in ein pays d’état – also eine halbautonome Ständeprovinz nach dem Vorbild der Guyenne oder der Bretagne – deutete vielmehr auf eine entschlossene, wenn auch bedachtsame Inkorporierung Korsikas in den französischen Staatskörper hin.
Читать дальше