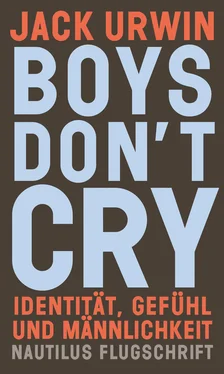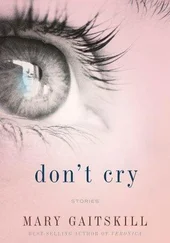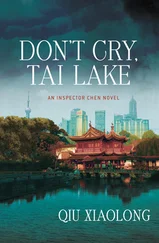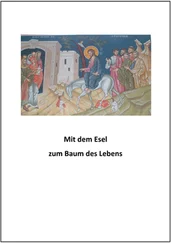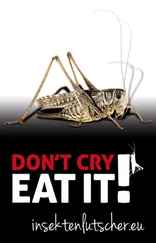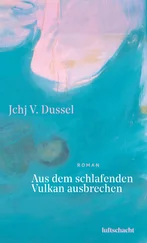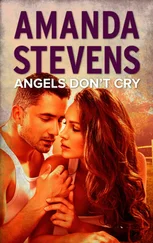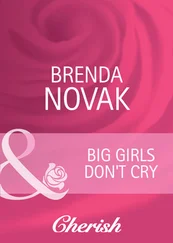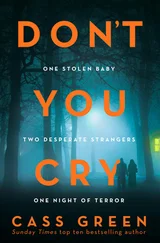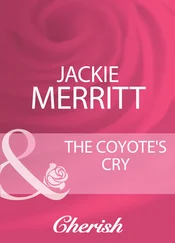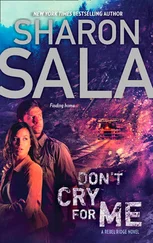Fragt eine beliebige Zahl von Ausländer*innen nach den charakteristischen Eigenschaften des Durchschnittsbriten, und ihr werdet mit Sicherheit ziemlich oft »Höflichkeit« zur Antwort erhalten. Wir haben uns den Ruf erworben, eine zuweilen aufreizend höfliche Gesellschaft zu sein, über die George Mikes, ein in Ungarn geborener Schriftsteller, der mit Mitte zwanzig nach London verpflanzt wurde, schrieb: »Wenn ein Engländer alleine an einer Bushaltestelle wartet, bildet er eine ordentliche Schlange von einer Person.« Diese neue Konzentration auf Etikette, vermutlich eine Nebenwirkung der aufstrebenden Mittelschicht, sorgte für die Herausbildung der äußerst konservativen Haltungen, für die wir bekannt wurden und von denen sich viele zu Qualitäten entwickelten, die wir jetzt (oft fälschlicherweise) als männlich betrachten – wie zum Beispiel die Unterdrückung von Gefühlen. Der Einfluss der viktorianischen Epoche auf das, was heute mit ›britischen Werten‹ gleichgesetzt wird, war so stark, dass man leicht annehmen kann, wir wären immer schon prüde gewesen, emotional und sexuell unterdrückt, beleidigt ob der leisesten Andeutung von Unschicklichkeit. Aber geht nur mal zweihundert Jahre vor die Viktorianer zurück, und ihr werdet feststellen, dass die britische Literatur zu dieser Zeit ziemlich versaut war. Und ich meine keinen Schmuddel von der Sorte »Huch, die Dame zeigt Knöchel«, sondern richtige Sauereien, die heute an den Fernsehzensoren nicht vorbeikämen. Seht euch nur diesen Auszug von John Wilmot, Earl of Rochester, aus dem Jahr 1672 an, A Ramble in St. James’s Park :
Had she picked out, to rub her arse on,
Some stiff-pricked clown or well-hung parson,
Each job of whose spermatic sluice
Had filled her cunt with wholesome juice,
Hätt sie, um sich den Arsch zu reiben,
’nen harten Kerl gewählt, ’nen gut bestückten Pfaff,
so würd die Mös nicht lange trocken bleiben,
wär schnell gefüllt mit zuträglichem Saft.
Wilmot starb acht Jahre später an einer Geschlechtskrankheit – woran auch sonst? Wenn das im 17. Jahrhundert als Poesie durchging (Poesie, ich bitte euch!), dann wage ich mir gar nicht auszumalen, wie Pornografie aussah. Geht noch weiter zurück in die Zeit von Chaucer, und ihr findet Sex und Obszönitäten an jeder Ecke. Was ich damit sagen will? Wir waren nicht immer die sexlosen, prüden Langeweiler, die in der Formulierung »britische Werte« mitschwingen. Vor noch nicht allzu langer Zeit sind wir mit unserer Sexualität ziemlich laut und offen umgegangen, doch die Viktorianer haben das Ihre getan, dem ein Ende zu bereiten. Wenn wir der Straße »Was Poesie uns über unsere Geschichte lehrt« weiter folgen, dann ist Rudyard Kiplings » If … « – » Wenn …« – eines der berühmtesten Gedichte aller Zeiten – im Grunde eine Ode an die »stiff upper lip«. Veröffentlicht im Jahr 1895, erklärt es dem Leser, wenn er einer Reihe von Regeln folgt »und auch nicht klagst, wenn du verlierst«, dann »du, mein Sohn, wirst sein: ein Mann!«. Man kann wohl sagen, dass die Briten – besonders die Männer – zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf dem besten Weg waren, die emotional gestörten Wesen zu werden, als die wir sie heute kennen.
Nach zwei Weltkriegen verändern sich ein paar Dinge …
Als Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts der Prozess der Globalisierung begann, erfuhr die Welt einen Wandel bis dahin nicht gekannten Ausmaßes. Reisen und Handel zwischen den Kontinenten hatte es vorher auch schon gegeben. Hunderte von Jahren, doch ab da funktioniert die Welt wirklich als etwas mehr als eine Ansammlung individueller Staaten. Angesichts der menschlichen Natur überrascht es nicht, dass in dieser Zeit im Abstand von gerade mal zwei Jahrzehnten die ersten beiden Weltkriege ausbrachen. Auch wenn die Globalisierung an sich nicht der Auslöser für diese Konflikte war, führten die veränderten geschäftlichen Beziehungen und die wachsende gegenseitige Abhängigkeit zwischen internationalen Verbündeten fast unvermeidlich dazu, dass sehr viel mehr Länder in diese Kriege hineingezogen wurden. Das hieß natürlich, dass Großbritannien Zugriff auf mehr Menschenpotenzial hatte; die Kehrseite war, dass das auch für unsere Feinde galt.
Bis dahin hatte Großbritannien auf eine allgemeine Wehrpflicht verzichtet, doch als 1914 der Krieg ausbrach, suchte der Kriegsminister Lord Kitchener Wege, so viele Männer wie möglich dazu zu bringen, sich freiwillig zum Militär zu melden. In der Annahme, Männer wären eher bereit, ihrem Land zu dienen, wenn sie dies im Kreis ihrer Familie und Freunde tun könnten, wurden die sogenannten Pals-Bataillone aufgestellt. Diese bestanden aus Männern, die sich zusammen bei örtlichen Rekrutierungskampagnen meldeten, und sie erwiesen sich, wie der Journalist und Historiker Bruce Robinson bemerkt, als äußerst erfolgreich:
»Lord Derby war der Erste, der die Idee auf die Probe stellte, als er Ende August erklärte, er werde versuchen, in Liverpool ein Bataillon aufzustellen, das ausschließlich aus Ortsansässigen bestand. Innerhalb von Tagen hatten sich in Liverpool so viele Männer eingeschrieben, dass es für vier Bataillone reichte.
Der Erfolg in Liverpool war anderen Städten Ansporn gleichzuziehen. Das war das große Geheimnis hinter den ›Pals‹: Der Stolz der Städte und der Gemeinschaftsgeist spornten andere Städte an, miteinander in Wettstreit zu treten, wer die größte Zahl an Rekruten aufbrachte.« 11
Das Ziel, die Kriegsstärke zu vergrößern, wurde erreicht, doch im ganzen Land wurden Straßen und Städte eines Großteils ihrer männlichen Bevölkerung beraubt. Als wären die Toten, die dem Feind zum Opfer fielen, nicht genug, wurden im Laufe des Krieges 306 britische Soldaten für Verbrechen exekutiert, auf die im zivilen Leben nicht die Todesstrafe stand. Bei vielen lautete die Straftat Feigheit. Heute, wo ein größeres Verständnis für psychische Gesundheit herrscht, hat sich das Wissen durchgesetzt, dass diese Männer unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litten und ihr vorgebliches Verbrechen keine bewusste Entscheidung war. Noch im Jahr 1993 weigerte sich Premierminister John Major, diese Männer zu begnadigen, indem er behauptete, sie hätten einen fairen Prozess bekommen und sie zu begnadigen hieße, jene zu beleidigen, die einen ehrenhaften Tod auf dem Schlachtfeld gefunden hatten. Die Blair-Ära brachte schließlich eine Kehrtwende, aber erst im Jahr 2006.
Noch nie zuvor hatten so viele Männer für ihr Land gekämpft. Die Männer, die den Krieg überlebten, hatte das strenge Reglement der militärischen Kultur, der sie sich hatten unterwerfen müssen, verändert. Die Hinrichtungen wegen Feigheit waren genauso sehr eine Warnung wie eine Strafe: Wer sich auch nur den kleinsten Augenblick der Schwäche erlaubt, läuft Gefahr, in der Morgendämmerung durch ein Exekutionskommando den Tod zu finden. Das wurde den Rekruten mit solcher Schärfe eingedrillt, dass die Auswirkung oft unumkehrbar war, so dass sie bei ihrer Rückkehr nicht die geringste Chance hatten, sich wieder in eine gesunde Gesellschaft zu integrieren. Zwar wurden sie als Helden bejubelt, doch von ihrer Regierung wurden sie im Stich und mit ihren körperlichen und seelischen Wunden allein gelassen.
Krieg war einmal etwas gewesen, an dem teilzunehmen britische Männer sich aus freien Stücken entschlossen, doch mit der Einführung der Wehrpflicht während des Ersten Weltkriegs und der Rückkehr dazu bei Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 markiert die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts einen beachtenswerten Wendepunkt. Die Wehrpflicht galt offensichtlich nur für Männer, denn nur Männer waren damals befähigt, in der Armee zu dienen, aber es muss hier trotzdem vermerkt werden.
Читать дальше