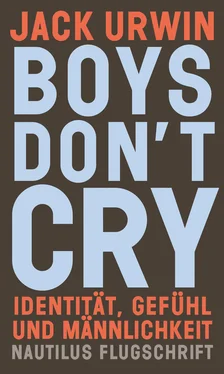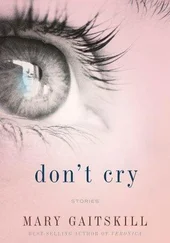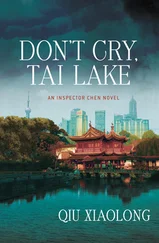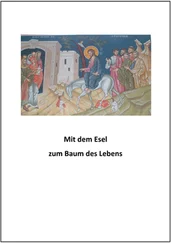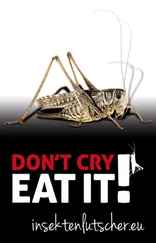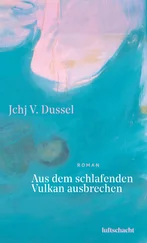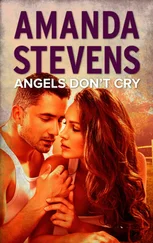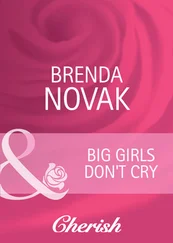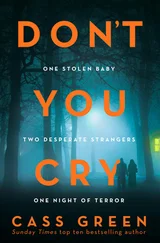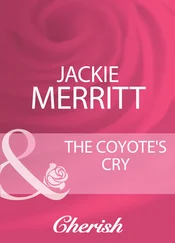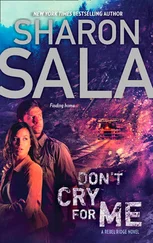Die Assoziation von Männlichkeit und Militär mag schon Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg zementiert worden sein, doch die Wehrpflicht veränderte den Blick der Gesellschaft auf Männer grundlegend, indem sie ihnen ihren freien Willen raubte und sie zwang, sich zu fügen. Mit anderen Worten, sie machte ihre Männlichkeit obligatorisch.
In dem Moment, als man die Männer der Möglichkeit beraubte zu wählen, ob sie in den Krieg zogen oder nicht, gab es einen neuen, staatlich sanktionierten Bedarf an Männlichkeit. Wehrdienstverweigerer und Pazifisten, die sich zu kämpfen weigerten, riskierten, ins Gefängnis zu gehen, aber bedeutsamer ist vielleicht, dass sie großer gesellschaftlicher Ächtung ausgesetzt waren und in den Augen mancher selbst heute noch als Feiglinge gelten. In einer Folge von Question Time im Jahr 2009 reagierte Nick Griffin (der damalige Anführer der ultrarechten British National Party) auf Anschuldigungen von Jack Straw (zu dem Zeitpunkt Justizminister), er sei ein Nazi-Unterstützer, mit dem Hinweis, sein eigener Vater habe im Zweiten Weltkrieg in der Royal Air Force gedient, während Straws Vater im Gefängnis gesessen habe, weil er »sich geweigert hatte, gegen Adolf Hitler zu kämpfen« 12. Das war unleugbar eine billige Nummer, aber der Vorfall macht anschaulich, dass Wehrdienstverweigerer immer noch stigmatisiert werden. Es besteht kein Zweifel daran, dass viele derer, die im Krieg kämpften, dies widerstrebend taten, doch es herrschte allgemein Einigkeit darüber, dass es schlicht die Pflicht eines Mannes war, seinem Vaterland zu dienen, und dieser Pflicht unterwarf man sich fraglos. 1960 wurde die Wehrpflicht wieder aufgehoben, doch bis dahin war sie für zwei Generationen britischer Männer Realität gewesen, und auch wenn sich die rechtliche Situation geändert hat, sind die Einstellungen, die daraus erwuchsen, so fest in der Gesellschaft verankert, dass sie noch an zukünftige Generationen weitergegeben werden.
Ich fasse mich hier kurz, denn über den emotionalen Tribut des Krieges habe ich bereits gesprochen, und auf das Militär komme ich später noch ausführlicher zurück, doch es ist wichtig: Nicht nur der Kriegsdienst war Pflicht – auch alles, was danach kam, war obligatorisch. Von den Männern wurde erwartet, mit dem Leben ganz normal weiterzumachen, und wenn es Probleme gab – insbesondere psychische –, hatten sie diese, wie alle anderen auch, klaglos durchzustehen. Weil es eine allgemeine Pflicht war, weil man nur einer von vielen war, die alle denselben Mist durchgemacht hatten, und weil man weder etwas Besonderes war noch einzigartig, war der Druck groß, es abzuschütteln, wie alle anderen es auch abzuschütteln schienen, und sich so zu verhalten wie alle anderen Männer auch. Infolgedessen betrachtete die Gesellschaft das, was unter Männern zur Norm wurde, zunehmend als männlichen Wesenszug. Männlichkeit ist im Kern schlicht ein Spiegel dessen, wie die Mehrheit der Männer agiert, und wenn ein Ereignis einen großen Prozentsatz der männlichen Bevölkerung verändert, verändert sich damit auch das, was wir als männlich erachten.
… aber es ist nicht alles schlecht für alle
Nicht nur Männer mussten in dieser Zeit feststellen, dass sich ihre Genderrollen veränderten. Der Zweite Weltkrieg bereitete den Boden für den wohl größten Durchbruch für die Frauenrechte, nämlich für ihre Eroberung der Arbeitswelt. 13Da die meisten Männer im arbeitsfähigen Alter ihren Kriegsdienst ableisteten, wandte sich das Vereinigte Königreich an seine weibliche Bevölkerung, um die Lücken zu füllen, und wies den Frauen Rollen zu, in denen sie entscheidenden Anteil an den Kriegsbemühungen und dem Funktionieren des Landes hatten.
Der Krieg brachte große Veränderungen mit sich, und als er 1945 zu Ende ging, hungerten die Briten nach einer neuen, gerechteren Gesellschaft. Winston Churchill wurde groß gefeiert, weil er das Land zum Sieg geführt hatte, doch seine Konservative Partei verlor bei den allgemeinen Wahlen keine zwei Monate nach dem V-Day erdrutschartig gegen die Labour-Partei von Clement Attlee. Nach dem Ersten Weltkrieg war großer Unmut aufgekommen, weil Versprechungen der Regierung – wie etwa »homes fit for heroes« (Häuser für unsere Helden) – sich nicht erfüllt hatten. Soldaten aus der Unterschicht waren unglücklich, in eine Gesellschaft mit unverrückbaren Klassenschranken zurückkehren zu müssen, nachdem sie genauso tapfer gedient hatten wie alle anderen. Das hatten viele 1945 noch frisch in Erinnerung, und es war klar, dass die Dinge diesmal anders laufen mussten. Das führte zur Gründung des Wohlfahrtsstaats und des NHS (des staatlichen Gesundheitswesens), die auch heute noch eine Quelle großen Nationalstolzes sind. An der Heimatfront schien es, dass man von Frauen, nachdem sie sich in der Arbeitswelt mehr als bewiesen hatten, nicht erwarten konnte, wieder in ihre alten Rollen als Hausfrauen zu schlüpfen. In allen Arbeitsfeldern wurde ihr Anblick mit der Zeit immer vertrauter, und auch wenn sie von wahrer Gleichheit noch weit entfernt waren (und heute noch sind), war der Weg doch geebnet.
Da es Frauen jetzt erlaubt war, bezahlter Arbeit nachzugehen, hatte sich die Zahl der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte im Land im Grunde verdoppelt, und auch wenn sie nicht als so nützlich galten wie Männer, so führt doch jede Marktsättigung unvermeidlich zu Wertverlust. Um eine Familie über die Runden zu bringen, braucht man im Allgemeinen heute das Einkommen von zwei Erwachsenen; vor einem halben Jahrhundert reichte dafür gewöhnlich eines – das veränderte die Art, wie wir arbeiteten, und es veränderte die Art, wie wir Gender sahen. Für Frauen war es eine Befreiung: Sie waren nicht mehr darauf angewiesen, einen Mann zu haben, der dafür sorgte, dass sie ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen hatten. Für Männer war die Sache ein wenig komplexer. Traditionelle Genderrollen hielten für Männer und Frauen einen recht beständigen Regelkanon bereit, an den sie sich halten sollten, und Männer zogen oft beträchtlichen Stolz daraus, wenn sie taten, was von ihnen erwartet wurde. Zur Arbeit zu gehen und allein für ihre Familie zu sorgen gab ihnen ein Gefühl der Erfüllung, und indem sie taten, was angeblich nur Männer konnten, fühlten sie sich in ihrer Männlichkeit bestätigt. Als die Zahl arbeitender Frauen stieg und Männer mitansehen mussten, wie ihre Frauen und Freundinnen Jobs bekamen, verloren sie dieses Gefühl der Erfüllung allmählich, und ihre Männlichkeit geriet unter Beschuss.
Viele toxische Aspekte moderner Männlichkeit können wir bis dahin zurückverfolgen. Bei allem Negativen, das wir mit den alten Traditionen verbinden, verhalfen diese Männern doch zu einer gewissen gesunden Bekräftigung ihrer Männlichkeit. Auch ohne sie brauchten Männer aber das Gefühl, sich als Männer fühlen zu können, und leider musste das jetzt aus ihrem Verhalten und ihrer Haltung kommen. Toxische Männlichkeit in ihrer grundlegendsten Ausprägung ist nichts anderes als aus Unsicherheit geborene Überkompensation: eine übertriebene Zurschaustellung von Verhaltensweisen und Handlungen, die man als männlich erachtet. Zur Arbeit zu gehen war nicht mehr männlich genug, und Männer hatten das Gefühl, ihre Männlichkeit auf jede andere erdenkliche Art und Weise beweisen zu müssen. Doch bevor ihr jetzt den Frauen die Schuld gebt, will ich euch daran erinnern, dass Milchersatznahrung zu diesem Zeitpunkt leicht zu erhalten war. Wenn ein Kind in den frühen Lebensjahren von einem Elternteil aufgezogen wird, kann das für beide eine wunderbare Erfahrung sein, und es gibt keinen Grund, warum dieser Elternteil nicht der Vater sein sollte. In der Nachkriegszeit hatten Männer alles, was sie brauchten, um ihre Kinder aufzuziehen, und als Gesellschaft hätten wir leicht entscheiden können, dass jetzt, wo Frauen arbeiten gingen, Männer zu Hause bleiben und sich um die Familie kümmern könnten. Wir hätten ein Land aufbauen können, in dem Männer wie Frauen zur Arbeit gingen und Männer wie Frauen zu Hause blieben und jedes Paar für sich entschied, was ihm lieber war, und dann wäre das Kind von einem Elternteil aufgezogen worden und es hätte keine Rolle gespielt, von welchem, solange das Kind geliebt worden wäre. Doch das haben wir nicht getan. Frauen sind zur Arbeit gegangen – dass sie das konnten, wussten sie schon lange – und haben bewiesen, dass sie das konnten, was Männer konnten, und das gab ihnen zunehmend das Gefühl, fähig, stark und unabhängig zu sein. Männer dagegen zeigten nicht, dass sie konnten, was in der Geschichte bis dato Frauen getan hatten, und so, könnte man argumentieren, waren die Probleme, die aus diesem Wandel erwuchsen, ganz allein von Männern gemacht.
Читать дальше