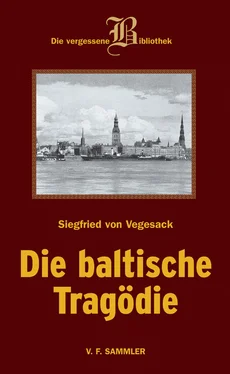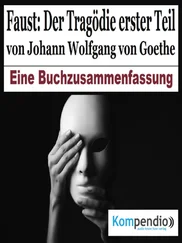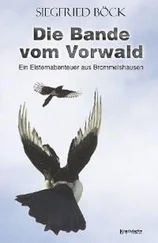„Man kann auch ohne Waffen kämpfen – für Gott!“
Dann fragte sie Aurel, was er werden wolle.
„Ich will Musik machen“, sagte Aurel; und erst jetzt, als diese Augen ihn fragten, war er sich dessen bewußt geworden. Noch nie hatte er darüber nachgedacht.
„Musik“, wiederholte Großtante Ernestine, „das ist schön. Damit kannst du viele Menschen glücklich machen!“
Aber wie sollte er Musik machen? Nicht einmal auf der Weidenflöte und der Mundharmonika konnte er spielen! Und singen schon gar nicht. Während der Morgenandacht im Saal, wenn alle aus dem Gesangbuch den Choral sangen, brummte er nur leise mit. Und auch das tat er nur, wenn niemand es hörte. Als er einmal mit Warinka in ein Gesangbuch sehen mußte, bewegte er nur die Lippen.
„Aber du singst ja gar nicht mit!“ hatte sie ihn nachher geneckt. „Warum bewegst du dann den Mund?“
Seitdem hielt er auch die Lippen geschlossen.
Wenn man so singen und so spielen könnte wie Tante Madeleine! Oder wenigstens wie die Spieldose! Manchmal, wenn Aurel allein war, hörte er eine Musik. Aber er hörte sie nur ganz tief in sich drinnen, wie ein feines Summen, und wie sollte er dieses Summen aus sich herausholen, so daß auch andere es hören konnten?
Als die Jungen ins Große Haus heimkehrten, brannten Lichter in allen Fenstern. Und als sie die Steinstufen hinaufstiegen und aus der Kälte und Dunkelheit in den Flur traten, schlugen ihnen wohlige Wärme und blendende Helligkeit entgegen.
Und durch die offenen Flügeltüren tönten Musik und Gesang.
Es wurde Winter. Der Schneepflug zog knirschend um den verschneiten Platz, dicke Schneemauern türmten sich zu beiden Seiten der Anfahrt. An den Fensterscheiben im Schulzimmer wuchsen Frostblumen. Auf dem See war ein Stück vom Schnee frei gefegt worden, die Jungen und Mädchen, Mademoiselle, Miß Mabel, ja sogar Tante Madeleine liefen hier am Nachmittag Schlittschuh.
Herr Bjelinski stapfte in hohen Galoschen im Schnee. Nein, auf das Glatteis ging er nicht. Hat das einen Sinn, immer in der Runde zu laufen?
„Aber das ist doch so gesund“, rief Tante Madeleine, „und so schön!“
„Immer in der Runde, ist das so schön?“ spottete Herr Bjelinski. „Man muß doch auch vorwärts kommen!“
Und er stapfte weiter. In seinem schwarzen Stadtmantel, mit der schwarzen Karakulmütze und dem schwarzen Fransenbart sah er im weißen Schnee wie ein Gespenst aus.
Auch Boris und Aurel fanden das Schlittschuhlaufen ein wenig langweilig, besonders, weil die Mädchen immer dabei waren. Und dann mußte man mit Mademoiselle und Miß Mabel laufen, französisch und englisch sprechen, immer „n’est-ce pas“ und „isn’t it“ sagen – „oui, mademoiselle, la journée est magnifique!“ Oder „how lovely!“ – lauter Quatsch und dazu immer in der Runde laufen!
Viel schöner war es, wenn die Jungen die alte Jurka vor die Ragge anspannen und mit ihr spazierenfahren durften. Sie saßen im niedrigen, flachen Schlitten auf einem Strohsack, die Beine in dicke Schaffelle eingewikkelt, und kutschierten abwechselnd. Sie fuhren auf der Landstraße, bogen dann in den verschneiten Wald ein, durch dichte junge Schonungen zur Fasanenfutterstelle. Manchmal sahen sie den großen Vogel mit dem langen rostroten Schweif über die Schneise streichen. Oder sie kutschierten zur kleinen Bude beim Kruge und fragten den zappligen, rundlichen Mann, der hinter seinem Ladentisch immer so tiefe Bücklinge machte, nach den unmöglichsten Dingen, nur um seine unerschütterlich immer gleiche Versicherung zu hören:
„Solche is nich, kommt nächste Woche!“
Aber einmal kauften sie sich doch etwas: zwei kurze Tonpfeifen mit silbernem Deckel. In der alten Scheune sammelten sie dann Klee- und Heustaub, der zwischen den Balken lag, stopften damit die Pfeifenköpfe und schmauchten nun ganz so wie die Bauern, behaglich ausgestreckt auf der gleitenden Ragge. Das eine Bein baumelte über den Schlittenrand, um ein plötzliches Umkippen zu verhindern. Der Kleetabak brannte gut, stank aber und kratzte schrecklich im Halse. Keiner wollte es dem andern gestehen. Ein wenig grün im Gesicht kamen die Jungen zu Hause an. Die Pfeifen wurden sorgfältig hinter den Schulbüchern versteckt.
Als es taute, errichteten Aurel und Boris mitten auf dem Platz vor dem Hause eine gewaltige Schneeburg mit dicken Mauern und hohen Türmen. Dann krochen sie hinein, und Krischjan und Dirick, die Söhne vom Viehpfleger, mußten die Burg beschießen. Aber sie wagten gar nicht, richtig scharfe Schneebälle zu werfen, und sobald Boris und Aurel einen Ausfall machten, rannten sie kreischend davon. Einmal erwischte Boris den langen Krischjan, riß ihn in den Schnee und wusch sein Gesicht ab.
Da stapfte gerade Herr Bjelinski um die Hausecke:
„Schämst du dich nicht“, rief er schon von weitem, „den Jungen so zu behandeln!“
„Er ist so feige“, erklärte Boris, „er läuft immer fort!“
Krischjan erhob sich und lief heulend davon.
„Und ist das nicht auch feige, mit jemand zu kämpfen, der sich nicht wehrt?“ fragte Herr Bjelinski, und seine Stimme bebte.
„Aber warum wehrt er sich denn nicht?“ erwiderte Boris entrüstet. Schmal, mit geröteten Wangen stand er da, die braune Samtmütze schief auf dem Kopf.
„Weil du der Herr bist, wagt er es nicht, dich anzufassen“, sagte Herr Bjelinski, und in seinen schwarzen Augen war wieder das Feuer, vor dem man den Blick senken mußte. „Und weil du der Herr bist, darfst du deine Macht nicht mißbrauchen!“
„Dann dürfen wir also nicht mit den Jungen spielen?“ fragte Aurel bekümmert.
„Spielen dürft ihr“, sagte Herr Bjelinski, „aber das ist kein Spiel, wenn ihr die Jungen, die sonst nichts anzuziehen haben, in den Schnee schmeißt und mit Schnee abreibt!“
Wieder war diese unsichtbare Mauer da: man konnte nicht hinüber, man war abgesperrt von allem, was hinter der Glaswand lag. Und wenn man sie mal durchbrechen wollte, zerschnitt man sich nur die Finger. Da blieb man lieber drinnen und gewöhnte sich daran, wie die Pflanzen im Treibhaus unter schützendem Glas zu leben.
Ja, es war warm und hell hinter den vielen erleuchteten Fenstern, auf dem spiegelnden Parkett, auch wenn es draußen dunkel wurde und der eisige Nordwind über den See und die endlosen Wälder fegte. Und immer waren frohe Stimmen, ein helles Lachen in der weiten Flucht der Zimmer, immer das leise Gebuller brennender Birkenscheite in den vielen Kachelöfen, das Getrappel von Kinderfüßen auf dem Parkett und den knackenden Treppen.
Und immer gab es Besuch: vom Pastorat, vom Doktorat, von den vielen Nachbarn und Verwandten. Schon an den verschiedenen Schlittenglocken und am Schellengeklingel konnte man hören, wer gerade vorgefahren kam. Die Pastoratsglocke war ganz tief und dumpf, die vom Doktorat bimmelte grell und aufgeregt; die Laiskumschen hatten immer zwei Glocken: eine brummende und eine lustig klimpernde; „die brummende, das ist Sascha, und die klimpernde – Arnold“, meinte Onkel Nicolas. Der Tormasche Baron Igelströhm hatte ein ganzes Glockenspiel, es hieß, zum Andenken an seine vielen Frauen. Der Paykulsche Herr von Dunten, ein alter Junggeselle, hatte nur Schellen, und wenn er kam, drückte er dem Diener gleich sein Nachthemd in die Hand, damit es in der Ofenröhre gewärmt wurde. Tante Olla hatte ein Ungeheuer von Glocke, die man wersteweit hörte. „Wo hast du diese Kirchenglocke gestohlen?“ fragte Onkel Nicolas sie. Nur der alte Mojahnsche fuhr immer ohne Geläut: „Ich kann dies Gebimmel nicht ausstehen“, erklärte er, „ich bin doch keine Kuh mit einer Glocke um den Hals!“
Aber richtig voll wurde erst das Haus, als die zwei italienischen Nichten von Tante Madeleine aus Mailand kamen: Laura und Nena.
Beide waren unheimlich schwarz, Laura ein wenig rundlich, Nena ganz schmal, und beide hatten nur Unsinn und Streiche im Kopf. Unglaublich, was sie zusammen mit Isa, Maurissa und Warinka alles anstellten; Mademoiselle und Miß Mabel waren natürlich auch mit ihnen im Bunde. Besonders hatten sie es auf den armen Herrn von Dunten abgesehen: Die Ärmel seines in der Ofenröhre gewärmten Nachthemdes wurde zugenäht. Zum Frühstück bekam er Zucker ins Salzfaß. Unter sein Laken wurden Pferdestriegel gelegt – die scharfen Kanten nach oben.
Читать дальше