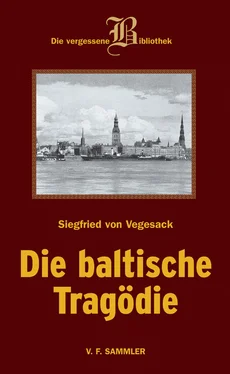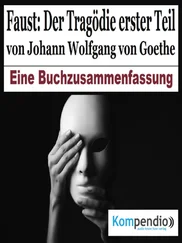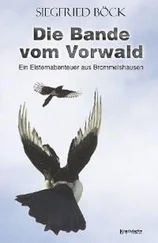Und ein tiefes Mitleid mit sich selbst kommt über ihn, weil er hier so allein ist, weil er ganz allein an Acka denkt, während die andern sich so gar nicht um ihn kümmern. Er möchte gern weinen, aber die Tränen wollen nicht kommen, er preßt den Kopf in das Heu – nein, es geht nicht. Er zwinkert mit den Lidern, bohrt die Finger in die Augenwinkel, untersucht sie genau: nicht eine Träne. Vielleicht ist er so traurig, daß er nicht weinen kann, und das macht ihn noch trauriger. Jetzt hat er niemand: Mila ist fort, Acka ist fort. Nie wieder wird er in „Afrika“ sitzen und Sonnen und Weihnachtsbäume malen.
Nein, zu Herrn Tiedebök geht er nicht. Obgleich der ihm oft etwas Süßes schenkt: Schokoladenplätzchen oder ein Bonbon. Aber Herr Tiedebök lacht immer so laut, und wenn er geht, wippt er so mit den Beinen und schlenkert so mit den Armen, als wollte er extra zeigen, wie schön er gehen kann: immer Brust heraus und Bauch herein. Aber Aurel findet das gar nicht schön. Und er versteht nicht, warum er mit den Brüdern auch so marschieren muß, im Großen Korridor, und Herr Tiedebök klatscht dann immer laut mit den Händen und zählt: „Eins – zwei, eins – zwei, eins – zwei!“ Weiter kann er nicht. Er wollte es ihnen vormachen, wie man richtig springen muß. Als er glücklich oben auf dem schräg über den Weg geneigten Apfelbaum stand, wippte er lange mit den Knien, schlenkerte mit den Armen, aber dann kam es ihm doch ein wenig zu hoch vor, und kleinlaut kroch er wieder herunter. Damals lachte er nicht. Aber die großen Brüder lachten. Und Aurel schämte sich sehr. Wenn er ihn jetzt so stolz wippen und schlenkern sieht, muß er immer denken: aber vom Kletterbaum herunterspringen, das kannst du doch nicht!
Aurel hört das Knirschen von Rädern. Durch die Lukenspalte sieht er, wie der alte Marz mit der kleinen Kalesche langsam im Schritt von der Veranda auf das Wagenhaus zufährt. Da fällt ihm ein: heute sollte die russische Gouvernante kommen, um den Brüder russische Nachhilfestunden zu geben. Gut, daß er nicht zu Hause ist. Er gruselt sich vor der unheimlichen Russin, möchte aber doch wissen, ob sie wie Grischa auch im Sommer einen Schafspelz und hohe Stiefel trägt? Der alte Marz spannt jetzt unten die Pferde ab und führt sie in den Stall. Die kleine Kalesche steht da, verstaubt, die leere Deichsel stößt in die Luft.
Aber jetzt muß Aurel doch hinunterklettern, es zieht ihn zum Bock. Er weiß, dort unter dem Kutschersitz, im Bockkasten, neben dem Hafersack, liegt etwas für ihn, etwas, was Marz ihm jedesmal mitbringt, wenn er von der Station kommt. Und das lockt ihn so, daß er es nicht länger auf dem Heuboden aushält. Schließlich ist er ja auch lange genug hier oben gewesen, so ganz allein, und wenn Acka ihn sieht, wird er ihm nicht böse sein, wenn er jetzt hinunterklettert.
Unten im Stall führt Marz gerade die Pferde in die Boxen. Dann streut er Häcksel und Hafer in die Krippen. Aurel steht dabei und sieht aufmerksam zu. Und als Marz zur Kalesche geht, folgt er ihm in stummer Erwartung. Er möchte nicht zeigen, daß er etwas erwartet, und deshalb bückt er sich und betrachtet ganz genau die staubigen Speichen des Rades, obgleich da eigentlich nichts zu sehen ist.
Endlich hat Marz das Geschirr, die schwarzen Lederleinen und die lange Peitsche ins Wagenhaus getragen, und jetzt – ja, jetzt steigt er auf den Bock, klappt den Sitz auf und holt eine braune Tüte hervor. Und aus der Tüte nimmt er zwei Wasserkringel und gibt sie Aurel. Hinter dem buschigen Vollbart lacht sein braunes Gesicht unter der staubbedeckten Kutschermütze.
Diese Wasserkringel sind uralt und steinhart, man kann nur mit großer Mühe ein kleines Stück abbeißen, und sie riechen nach Kutscherbock, nach Leder und Wagenschmiere und schmecken ein wenig nach Staub und Sand. Aber Aurel liebt sie, kaut langsam, andächtig und mit Behagen. Diese Kringel kommen weit her von der Station, dort, wo die Eisenbahn fährt, also beinahe aus der Stadt. Und wenn man sie kaut und den Reisestaub schmeckt, ist es fast, als wäre man selbst ganz weit, in einem fremden Lande, in großen, fremden Städten. Denn hier, zu Hause, gibt es nie Wasserkringel, nur Karrasch, Schwarzbrot und Kümmelkuchen. Und die schmecken nie nach Staub.
Den zweiten Kringel steckt Aurel in die Tasche: der ist für Adda.
Es ist Sommer, immerfort Sommer, und es ist Tag, immerfort Tag. Die Sonne bückt sich nur ein wenig hinter dem Wald und fliegt dann gleich wieder auf wie ein Gummiball, der nur die Erde berührt, um wieder in die Luft zu hüpfen. Zwischen Abend und Morgen ist keine Nacht, nur eine hellgrüne Dämmerung, mit einem roten schmalen Rand über den schwarzen Wäldern. Das Knarren der Schnarrwachteln und das Dengeln der Sensen hört nicht auf, und von den feuchten Heuschlägen weht durch die offenen Fenster ein betäubender Duft von frischgemähtem Gras, Klee und Nachtviolen.
Und dann, an einem frühen Morgen, spannt der alte Marz den Viererzug und die beiden Schimmel vor die große Familiendroschke: an der Spitze Scheck und Schalk, dann Brauni, Iipsi, Mascha und Mazurka. Und alles, was Beine hat, klettert in den mächtigen Wagen, der breit und wippend wie ein Doppelbett ist, mit zwei hohen Türmen: dem Kutscherbock vorn und dem Dienersitz hinten.
Die Mutter, der Vater, Karlomchen, Fömarie, Herr Tiedebök, Marja Petrowna, die russische Gouvernante, Doktor Martinell, die Pastorin – alles hat rechts und links auf dem Doppelbett Platz, und in der Mitte ist noch so viel Raum, daß Aurel und Adda zwischen den beiden Rückenmauern liegen können. Bal sitzt natürlich vorn auf dem Bock neben dem Kutscher, und Rei und Tof sind hinten auf den Dienersitz hinaufgeklettert. Janz und Karlin sind mit allen Vorräten in einer Fuhre vorausgefahren.
Marz klatscht mit der langen Peitsche, und das rollende Haus setzt sich in Bewegung. Es rollt auf der alten Landstraße, an dicken Weidenstümpfen, an Korn- und Kleefeldern, an endlosen Heuschlägen vorbei, bollert dumpf über eine Bohlenbrücke, schaukelt durch kühlen, schattigen Fichtenwald. Sechzehn Werst sind es bis zu den Aa-Heuschlägen, wo die Knechte und Mägde seit einer Woche beim Mähen sind.
Aurel liegt auf dem Rücken: zwischen den dunklen Tannenmauern ist ein blauer Himmelweg, auf dem weiße Lämmerwolken ziehen. Manchmal hat die Mauer ein Loch, und dann wird der blaue Weg plötzlich breiter. Endlich hören die grünen Wände auf, Land und Himmel öffnen sich weit und rund. Die Räder knirschen im tiefen Sand, eine dicke Staubwolke zieht neben dem Wagen her. Manchmal, wenn es aufwärts geht, muß man aussteigen.
Herr Tiedebök geht wippend voran, reißt hier und dort eine Blume ab und fragt, wie sie auf lateinisch heißt und wie viele Staubfäden sie hat.
Doktor Martinell geht neben der Mutter und ist begeistert: vom Wetter, vom Weg, vom Leben. Auch der Tod kann ihm nichts anhaben:
„Wenn er früher nach Meran gekommen wäre“, sagt er und tupft mit dem Taschentuch die rote Stirn, „aber es war zu spät, viel zu spät. Oder gewissermaßen auch zu früh: in zehn Jahren wird es in zivilisierten Ländern keine Tuberkeln geben. Wie es heute keine Pest gibt. Der Fortschritt der Wissenschaften …“
Marja Petrowna zeigt auf die Pferde und sagt: „Loschadji!“ Und Aurel soll es auch sagen. Aber warum soll er das tun? Die Pferde verstehen bestimmt kein Russisch. Er läuft zum Vater hinüber und geht hinter ihm her. Manchmal bleibt der Vater stehen und schnauft. Dann bleibt Aurel auch stehen. Aber der Vater sieht sich nicht um.
Fömarie sagt: „Es staubt!“ Und stelzt mit hochgezogenen Röcken am Grabenrande.
Die Pastorin geht auf der anderen Seite neben dem Roggenfeld und pflückt Kornblumen. Sie trägt ein blaues Sommerkleid, und rund und blau sieht sie selbst wie eine Kornblume aus.
Dann steigt alles wieder ein, und das fahrende Haus rollt weiter.
Читать дальше