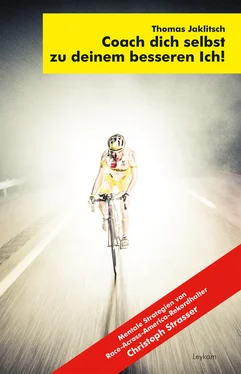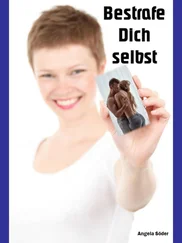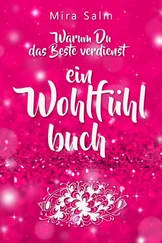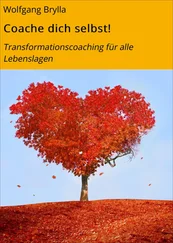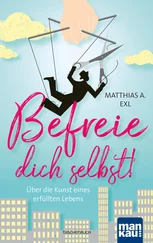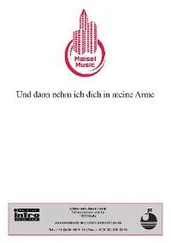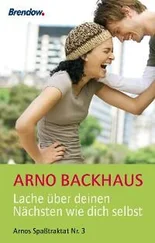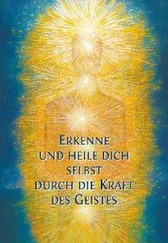Vorbereitung von T. Jaklitsch auf das RAW 2015 Foto: www.lucaspflanzl.at
„Das beste Gehirnjogging
ist Jogging!”
Über die Funktion und die weitreichenden lebensverlängernden Effekte von Bewegung habe ich bereits im Vorgängerbuch hingewiesen. Mittlerweile gibt es ausreichend Studienergebnisse, welche positiven Effekte Bewegung und auch individuell angemessener Sport auf das persönliche Wohlbefinden haben und es steigern können. Und klarerweise nicht nur das, sondern sie können auch das Leben verlängern und die Möglichkeiten des Lebens in vielen Bereichen erweitern.
Unser Körper ist ein dynamisches System, welches sich ständig verändert und sich immer wieder erneuern kann. Spannend ist jedoch auch die Erkenntnis, dass der Takt und die Geschwindigkeit der Erneuerung von Zellen, also ein Effekt der Gesundung, nicht konstant ist. Was bestimmt nun den Rhythmus und die „Motivation“ der Zellen, sich zu erneuern und sich zu entwickeln? Verschiedenste Forschungen legen nahe, dass die Variation der Erneuerung abhängig von deinen Aktivitäten und deinen Emotionen ist.
„Ein Schlüsselsignal, das Ihren Zellen sagt, ob sie absterben oder wachsen sollen,
ist beispielsweise die Bewegung. Eine eher sitzende Lebensweise fördert das Absterben der Zellen. Ein aktiver Lebensstil hingegen fördert die Zellerneuerung.
Das trifft sowohl auf Ihren Körper als auch auf Ihr Gehirn zu.”
(B. Fredrickson, Die Macht der guten Gefühle, 2011, S. 102)
Aktuellen Studien zufolge ist der neueste Risikosport, der in unserem Kulturkreis am häufigsten ausgeübt wird, das Sitzen! Manche Zeitungen titelten sogar „Sitzen ist das neue Rauchen“ (z. B. Gerald Gartlehner im Standard, 20. März 2015). Unterschiedlichste Studien brachten im Detail verschiedene Ergebnisse hervor. Der durchgängige Trend aus den Untersuchungen zeigte aber, dass wir 50 bis 70 Prozent des Tages sitzend verbringen und dieses Faktum kostet uns einige Jahre Lebenszeit. Die Conclusio einer amerikanischen Studie aus dem Jahr 2012 folgert hingegen, dass wir unsere Lebenserwartung um zwei Jahre steigern könnten, wenn wir nur mehr maximal drei Stunden am Tag sitzen würden! (L. Katzmarzyk, Zusammenhang von inaktivem Verhalten und allgemeinem Sterblichkeitsrisiko in den USA, 2012) Die Frage, die sich stellt, ist, ob Bewegung helfen würde, den negativen Effekt des zu langen Sitzens zu neutralisieren? Die Antwort gibt es später.
Sporttreibende Menschen kennen den Effekt: Der Tag war anstrengend, der Akku ist leer, der Kopf hingegen voll! Doch du ringst dich durch, ziehst die Laufschuhe an oder schwingst dich aufs Rad oder welche Bewegung auch immer die passende ist, und nach einiger Zeit der kontinuierlichen Bewegung ist vieles anders. Vielleicht nach 20 Minuten, vielleicht nach 40 Minuten, vielleicht auch erst nach einer guten Stunde gewinnen viele Menschen, obwohl sie Energie für die Bewegung verbrauchen, subjektiv mehr an Energie. Der Lebensenergie-Akku darf sich wieder füllen, der Kopf hingegen leert sich und so manche Lösung für scheinbar unlösbare Herausforderungen wurde inmitten der Natur, während sportlicher Aktivität gefunden.
Es geht dabei nicht immer nur um das sogenannte „Runners High“, dieses Hochgefühl, welches aus einem körpereigenen Drogencocktail wie Endorphinen, die zu den Opioiden zu zählen sind und ähnlich wirken wie Opium, bereitgestellt wird. Auch das entspannte Gefühl und das Wohlbefinden danach werden selbst produziert und von körpereigenen Entspannungsgehilfen, nämlich Endocannabinoiden, verursacht. Sind wir selbst unser bester Drogenproduzent? Letztlich zieht unser Gehirn vermutlich mindestens den gleichen Nutzen wie unser restlicher Körper, wenn wir uns bewegen. Wir können besser denken, erlangen mehr Selbstbewusstsein und werden ausgeglichener. Bewegung sei Dank (vgl. Focus Magazin, Glücksfaktor Sport, Nr. 28, 2012). Es gilt, Aufmerksamkeit für die weitreichenden Konsequenzen des sensiblen Wechselspiels zwischen Stress und dessen persönlichen Folgen sowie unseren Möglichkeiten, Stress auch abzubauen, zu schaffen. Letztlich mit dem Ziel, uns hoffentlich ein Leben lang wohl zu fühlen und so gesund wie nur möglich zu sein, muss einerseits die kontinuierliche Zellregeneration und müssen andererseits die wechselseitigen Abhängigkeiten von Psyche, Nerven-, Hormon- und Immunsystem im Fokus der Bemühungen sein. Immerhin titelte bereits im Jahr 2007 eine Pressemitteilung der Universität Ulm: „Laufen macht schlau!“ Nachgewiesenerweise haben bei der dreijährigen Studie die Teilnehmer bereits nach sechs Wochen regelmäßigen Lauftrainings in den Bereichen „visuell-räumliches Gedächtnis“ und „Konzentrationsfähigkeit“ bessere Ergebnisse erreicht und allgemein für sich eine „positive Stimmung“ genossen. Die Conclusio von Professor Manfred Spitzer ist hoffnungsvoll: „Wir konnten jetzt zum ersten Mal zeigen, dass ganz bestimmte geistige Leistungen direkt vom Sport profitieren“. Die im EEG messbare hirnelektrische Aktivität wird von der körperlichen Fitness mitbestimmt. Je fitter, umso schneller erfolgt die Reizverarbeitung im Gehirn. Wieso es, obwohl es diese Erkenntnisse nun bereits seit Jahren gibt, noch immer Diskussionen über das Sportpensum von Kindern und Jugendlichen in der Schule gibt, ist fraglich.

Selbstproduzierte Drogen, RAAM 2013 Foto: www.lupispuma.com
Wir sind zwar selbst unser bester Drogenproduzent, doch unser Drogendealer handelt oft eigenmächtig!
Schon in der Antike war man sich der Wechselwirkung zwischen Gefühlen und körperlicher Gesundheit bewusst. Doch erst im Jahre 1974 konnte der amerikanische Psychologe Robert Ader (1932–2011) einen Nachweis erbringen, dass das zentrale Nervensystem mit dem Immunsystem nicht nur in Verbindung steht, sondern zusammenarbeitet und beide voneinander lernen können. Diese Wissenschaftsdisziplin nennt sich Psychoneuroimmunologie und hat ihr Hauptaugenmerk auf die Folgen der wechselseitigen Beeinflussung von Leib und Seele und ihre Wirkung auf die menschliche Gesundheit gelegt. Im Zuge unserer Menschheitsgeschichte entwickelten wir die Notwendigkeit, ein gut ausbalanciertes Gleichgewicht zwischen Umwelt, Psyche, Hormon- und Immunsystem herzustellen. Dabei dienen verschiedenste Botenstoffe der Kommunikation und dem ständigen Austausch zwischen unserem Gehirn, sprich unseren Gedanken, und unserem Immunsystem. Die Wechselbeziehung ist so intensiv, dass das quasi gestresste Gehirn über Botenstoffe die Immunzellen strapazieren kann. Umgekehrt produziert auch das Immunsystem Botenstoffe, die sich direkt auf unser Denken und Fühlen auswirken können.
Die Abwehrreaktion des Menschen auf Stress oder Überforderung ist evolutionär genial, aber hinterlässt Folgen. Ganz automatisch werden in der ersten Abwehrreaktion vom Auftraggeber Zwischenhirn im Nebennierenmark Adrenalin und Noradrenalin produziert. Diese Aktivierungshormone sorgen dafür, dass die Muskeln und das Gehirn bestens durchblutet und aufgrund der Erhöhung des Blutzuckerspiegels auch voller Energie sind. Immerhin muss der Körper in Verteidigungsbereitschaft sein und geschützt werden können. Sobald die ersten Belastungsspitzen überstanden sind, wird der Körper mit dem Hormon Cortisol wieder beruhigt. Dieses Beruhigungshormon dämpft und reduziert möglicherweise entstandene Entzündungen.
Bei Stress als Dauerzustand produziert der Körper zu viel Cortisol, dämpft damit die Immunabwehr und bringt diese aus der Balance, vor allem das besonders sensible Gleichgewicht zwischen zellulärer und humoraler Immunabwehr. Bekämpft werden Bakterien, die zum Beispiel durch eine Wunde in den Organismus eindringen können, von der humoralen Abwehr. Viren und mutierte Zellen – Krebszellen – werden von der zellulären Immunabwehr bearbeitet. Das Zuviel an Stress, das wie beschrieben zu zu viel Cortisol führt, verschiebt dieses Gleichgewicht und führt zur Schwächung der zellulären Abwehr und damit gleichzeitig zu einer Verstärkung der humoralen Immunabwehr. Die Folge ist vielen bekannt: Wenn der Stress nachlässt, wird man krank. Viele Menschen beklagen sich, die Weihnachtsferien anstatt mit der Familie krank im Bett zu verbringen. Der Weihnachtsstress sorgt mit den oben beschriebenen Prozessen für ein Ungleichgewicht der Immunabwehr, verschlechtert die Immunfaktoren und steigert somit, gerade in Zeiten, wo eigentlich aufgrund der Witterung ein starkes Immunsystem benötigt würde, die Gefahr einer Infektion. Bei Sportlern wird dieser Effekt, der nach sehr harten und intensiven Trainingseinheiten auftreten kann, als „Open-Window-Phänomen“ bezeichnet. Überlastendes Training bzw. zu stark fordernde sportliche Aktivität – also evolutionär gesehen vom System als Stress erkannt – schwächt das Immunsystem und somit können etwaige bakterielle Krankheitserreger nicht mehr ausreichend beseitigt werden. Gerade in der Übergangszeit und in den kalten Wintermonaten sind Leistungssportler besonders gefährdet. Einerseits ist die Ansteckungsgefahr allgemein erhöht, andererseits ist das Atmen von sehr kalter Luft im Freien eine enorme Zusatzbelastung für die Schleimhäute. Durch die Schwächung der zellulären Abwehr werden wir anfälliger für Virusinfektionen wie Grippe oder Herpes. Zufall oder nicht, gerade in der Woche vor dem Start des Race Across America 2015 plauderte ich in der Zeit der Hitzeakklimatisation in der Wüste von Borrego Springs mit Extremradler Severin Zotter. Er war – wie Christoph Strasser und ich – nach dem Organisations-, Einpack- und Flugstress zur Entspannung und für den Hitzefeinschliff vor Ort. Drei Mal darf man raten, was ich an seiner Lippe entdecken durfte ...
Читать дальше