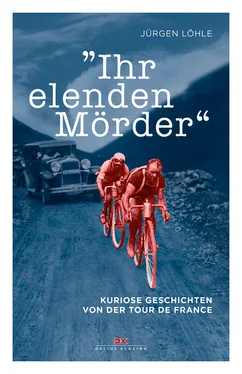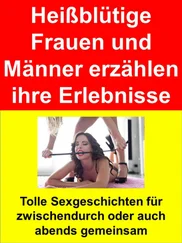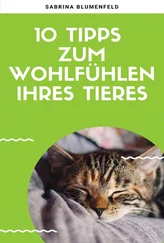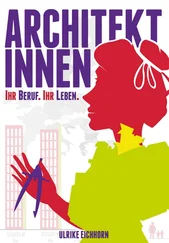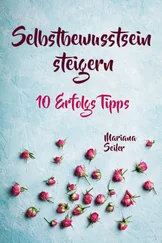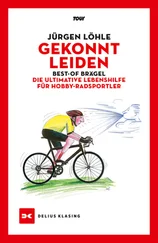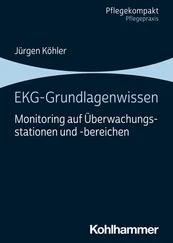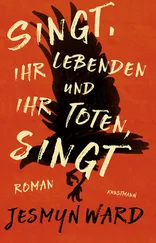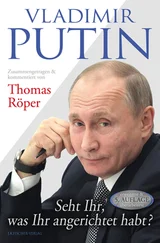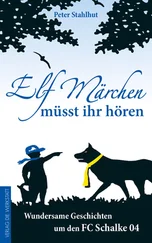Von da an war die Tour 1904 dann eine einzige Skandalfahrt. Überall an der Strecke gingen „Lokalpatrioten“ auf Fahrer aus anderen Regionen los, streuten Nägel auf die Straße oder schlugen sogar zu. Garin wurde dann auch noch einmal im Südwesten von Zuschauern verprügelt. Alfred Faure gab danach seine Startnummer ab und fuhr nach Hause: „Ich habe keine Lust, auf dem Weg nach Paris umgebracht zu werden.“ Auch die Fahrer waren sich untereinander nicht grün und streuten selbst Nägel hinter sich aus, um der Konkurrenz möglichst wirkungsvoll zu schaden. Da man sich nicht helfen lassen durfte, war so ein Reifenschaden mit einem gewaltigen Zeitverlust verbunden. Die Tour gewann dann wie im Jahr zuvor der zweimal niedergeschlagene Garin – aber sein Erfolg hielt nur kurz. Fünf Monate später, Anfang Dezember 1904, kassierte der französische Radsportverband das Klassement und disqualifizierte nachträglich 29 der 87 gestarteten Fahrer wegen Vergehen wie unerlaubtes Fahren mit dem Auto oder auch mit der Eisenbahn, verbotene Verpflegung oder Windschattenfahren. Unter den für die Fahrer belastenden Aussagen war auch die, nach der einige Fahrer einen Flaschenkorken auf einen Draht aufgezogen hätten, der wiederum mit einem Auto verknüpft worden sei. Den Kork zwischen den Zähnen, hätten sie sich von den Autos ziehen lassen und dabei darauf vertraut, dass dies unbemerkt bleibe, weil sie ja die Hände am Lenker hatten. Kurzum, die ganze Tour war ein einziger kurioser Skandal.
Unter den nachträglich Bestraften waren auch die ersten vier des Gesamtklassements. Maurice Garin beendete daraufhin mit 32 Jahren erbost seine Karriere, beklagte aber bis zu seinem Tod 1957 die aus seiner Sicht grobe Ungerechtigkeit, die ihm da widerfahren sei. Sieger der zweiten Tour wurde so der im Juli 1904 erst 19-jährige Henri Cornet, der damals als Fünfter in Paris gut drei Stunden Zeitrückstand auf Garin hatte. Cornet gehörte nicht zu den Großen der Szene und konnte später bei der Tour als bestes Ergebnis einen achten Platz erringen, ist aber bis heute der jüngste Toursieger. Den Platz in den Geschichtsbüchern dürfte er auch behalten. Die Tour de France stand nach dieser kuriosen Nummer übrigens bereits nach der zweiten Auflage vor dem Aus. Henri Desgrange schrieb unter dem Titel „Das Ende“ einen resignierten Abgesang in seinem Blatt. In diesem Leitartikel hieß es wörtlich: „Ich befürchte, die zweite Auflage der Tour ist auch zugleich die letzte. Sie ist an ihrem Erfolg zugrunde gegangen, und an den nicht zu zügelnden Leidenschaften, die sie entfesselt hat.“ Aber schon kurze Zeit später bereitete er die Tour 1905 vor. Es war dem alten Fuchs schnell klar geworden, dass vor allem die Skandalstorys für seine Zeitung L’Auto eine wunderbare Wirkung hatten. 1903 verkaufte er 20.000 Exemplare, zwei Jahre später war die Auflage auf 100.000 gestiegen. Und aus keinem anderen Grund hatte Henri Desgrange die Tour de France schließlich gegründet.
Dass Zuschauer die Radfahrer körperlich angehen, ist heute zum Glück nur noch ganz selten der Fall. Es traf in der jüngeren Geschichte vor allem den vierfachen Toursieger Christopher Froome, dem die Fans das monatelange juristische Rumgeeiere nach einer positiven Dopingprobe verübelten. Am Ende stand zwar ein Freispruch, aber keiner, der so richtig überzeugen konnte. All das ist natürlich kein Grund, Rennfahrer wie im Fall Froome mit Urinbeuteln zu bewerfen. In der Gründerzeit der Tour gingen die Angriffe jedoch auch nach 1904 noch munter weiter. Manchmal trafen sie dann auch Leute, die eigentlich mit der Tour der Berufsradfahrer überhaupt nichts zu tun hatten. Es war damals so, dass das Rennen nicht auf abgesperrten Straßen lief und dass sich Amateure unter die Profis mischen durften, ganz legal. Wer sich anmeldete, konnte mitfahren, ganz einfach.
So startete zum Beispiel 1907 ein gewisser Baron Henri Pépin de Gontaud. Der Mann hatte Geld, seine Form dagegen war eher nicht renntauglich. Der Herr Baron engagierte deshalb zwei Berufsfahrer als Helfer, darunter Jean Dargassies, den Vierten der Tour 1904. Einer Quelle zufolge zahlte Pépin de Gontaud dem Schmied aus dem Languedoc so viel, wie er als Sieger der Tour erhalten hätte. Zu den Essenszeiten fuhren die beiden professionellen Helfer voraus und orderten in einem sehr guten Restaurant ein opulentes Mahl für den adligen Radler, der sich dann direkt vom Sattel an einen reich gedeckten Tisch setzen konnte. Übernachtet wurde in den besten Häusern an der Strecke. Von solchem Luxus konnten die anderen Teilnehmer, inklusive der Spitzenprofis, natürlich nur träumen. Wer von sich aus nicht gut betucht war und auch keine Chance auf ein Preisgeld hatte, für den war die Tour eine echte Herausforderung, da Desgrange zu Beginn nicht einmal die Hotels bezahlte. Es soll Profis gegeben haben, die nach der Zieldurchfahrt Ansichtskarten verkauften, andere machten Kunststückchen wie Rückwärtssaltos auf dem Marktplatz und gingen danach mit dem Hut Geld sammeln. Wohlgemerkt, nach oft 16 Stunden Rennen.
Falscher Bart und falsche Brille
Dass es bei der Tour zwei Klassen von Rennfahrern gab, hielt sich noch recht lange. 1930 stellte Henri Desgrange das Rennen radikal um. Da seit 1913 außer Henri Pélissier im Jahr 1923 kein Franzose mehr die Tour hatte gewinnen können und die Auflage seiner Zeitschrift L’Auto mit der Zeit sogar während des Rennens zu sinken begann, änderte der Tour-Gründer den Austragungsmodus. Statt wie bisher von Fahrradherstellern gesponserter Einzelstarter traten nun Nationalmannschaften gegeneinander an. Desgrange glaubte, dass die Franzosen mehr starke Profis als andere Nationen in einer Mannschaft würden bündeln können und dass so am Ende ein Franzose gewinnen würde. So kam es dann auch. André Leducq beendete nach 17 Jahren die sieglose Serie der Franzosen. Desgrange war damals der Meinung, dass eigentlich nur fünf Nationen in der Lage seien, eine würdige Nationalmannschaft für die Tour aufzubieten. Neben Frankreich waren das noch Belgien, Italien, Deutschland und Spanien. Alle anderen Nationen durften zwar in teilweise gemischten Teams ebenfalls teilnehmen, ihre Fahrer bekamen aber die Hotels nicht bezahlt und waren so eher Profis zweiter Klasse. Und damit sie die Stars auch ja nicht behinderten, mussten sie zehn Minuten nach den großen Teams starten. 1931 ist ihm diese Regelung aber sauber auf die Füße gefallen: Max Bulla fuhr bei der zweiten Etappe aus der Gruppe der zweiten Garde heraus die beste Zeit, überholte die vor ihm Gestarteten aus den großen Nationalmannschaften und eroberte das Gelbe Trikot. Als erster Österreicher übrigens. Der Profi aus Wien gewann dann noch einmal zwei Etappen, und Desgrange musste reagieren. Der Tourchef sorgte schließlich dafür, dass Bulla im Jahr darauf mit der deutschen Mannschaft starten durfte. Eine Etappe konnte er zwar nicht wieder gewinnen, als Mitglied der deutschen Mannschaft genoss er aber den Sonderstatus mit bezahlter Unterkunft und gutem Essen.

Max Bulla (links) war der erste Österreicher im Gelben Trikot – und einer, der die Avantgarde ärgern konnte .
Das war damals schon erstrebenswert, denn Reichtümer waren für die Leute aus der zweiten Reihe nicht zu verdienen. Die Fahrer waren dankbar für jedes Gratisessen oder ein kühles Getränk. Allerdings mussten die Profis schon aufpassen, was sie so alles annahmen. 1910, als die Tour zum ersten Mal über die Pyrenäenriesen führte, lag Paul Duboc in Führung, als er bei einer Pause plötzlich leichenblass im Straßengraben liegen blieb und sich ständig übergeben musste. Duboc hatte von einem Zuschauer eine Wasserflasche angenommen, in der auch ein Gift gewesen sein soll, hieß es. Nach einer Stunde fuhr er zwar weiter, erreichte das Ziel aber mehr schlecht als recht als Letzter. Die Chance auf den Gesamtsieg war perdu, da ging nichts mehr. Nutznießer des vermuteten Anschlags auf Duboc war Gustave Garrigou, der nun die Spitze übernahm. Ein normaler Vorgang im Sport, aber schnell entstand die Verschwörungstheorie, Garrigou stecke hinter der präparierten Flasche, von der man bis heute nicht mal weiß, ob es sie überhaupt gegeben hat. Dass Garrigou ihn vergiften wollte, glaubte zwar nicht einmal Duboc, aber als die Tour sich in Richtung Rouen, Dubocs Heimatstadt, bewegte, war allen klar, dass Garrigou in großer Gefahr war. Und so kam es zu einem bis heute einmaligen Kuriosum: Gustave Garrigou wurde eine dicke Brille aufgesetzt, ein falscher Bart angeklebt, und sein Rad wurde in einer anderen Farbe lackiert. Da der Führende damals noch kein Gelbes Trikot trug, war der verkleidete Garrigou für die aufgebrachten Menschen in Rouen nicht zu erkennen. Die Sache ging gut, Garrigou gewann die Tour. Duboc war übrigens schnell wieder auf dem Damm, gewann danach noch zwei Etappen und wurde am Ende noch Gesamtzweiter. Das Gift konnte also nicht besonders aggressiv gewesen sein. Wenn es denn überhaupt eines gegeben hatte.
Читать дальше