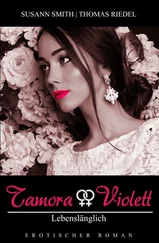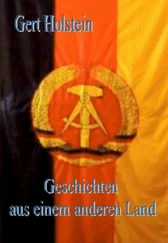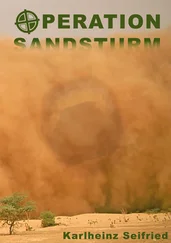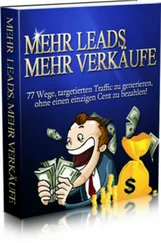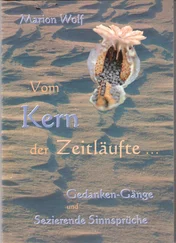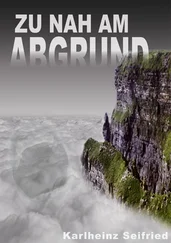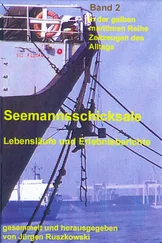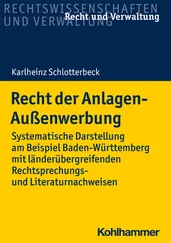M Carolina Maria geb. Ohloff, ∞ 1. 1750 Maria Theresia Tassi (aus Hannover, † 1756), 2. 1757 Ludmilla (Maria Luise?) v. Rava verw. v. Carcani (aus Breslau, † 1776), 3. 1777 Maria Barbara v. Rava (aus Polnisch-Gandau?, † 19.5.1823 im Benediktinerinnenkloster Striegau/Schlesien, dessen letzte Äbtissin ihre Schwester war),
Söhne:
Adolf Daum (13.5.1751-23.5.1817), Privatmann in Berlin und Danzig
Friedrich Franz Daum (5.6.1777-22.1.1801), betrieb nach dem Studium der Naturwissenschaften Botanik und Astronomie
Über die Kindheit und Jugend von Friedrich Karl Daum ist nichts bekannt. Er hatte keinen direkten Anteil an dem Handelshaus Splitgerber & Daum. Friedrich II. erteilte dem 26-Jährigen am 13.8.1753 eine 15-jährige Konzession zur Barchentmanufaktur mit Monopol im Altstädtischen Rathaus in Brandenburg (Havel), die er mit eigenem Kapital und dem seiner Schwester Caroline Maria Elisabeth Daum finanzierte. Er schied 1756 aus der Leitung der Manufaktur aus, die 1762 sein Schwager Gustav Wilhelm Köppen und der Brandenburger Kaufmann C. W. Wagner unter dem Namen Köppen & Wagner weiter betrieben (1807 aufgehoben?). Daum lebte nun von dem großen ererbten väterlichen Vermögen ganz seinen Neigungen. Er wohnte mit Frau und Söhnen winters in seinem Altköllner Haus Breite Straße 15 (in dem er Räume an die Kasse der Witwenverpflegungsanstalt vermietete) und sommers auf seinem Gut Lietzow bei Charlottenburg, Grüne Carls-Ruhe genannt. Er besaß eine Bibliothek mit 4000 Bänden aller Wissensgebiete (die 1811 versteigert wurde), bedeutende Kunstsammlungen (Porträt seines Vaters von Antoine Pesne, Stiche, Zeichnungen, Porzellan, Keramik, Waffen, Münzen) und botanische Sammlungen. Eine seine Liebhabereien galt den Bienen. Daum publizierte im Periodikum der 1766 gegründeten Oberlausitzer Bienengesellschaft ein Verzeichniß dererjenigen Blumen und Blüthen, so die Bienen am vorzüglichsten lieben (1768/69) sowie den Aufsatz Seltsame Nachricht von einem versteinerten Bienenstocke oder Neste, welchen Herr Lippi, der Arzneykunst Licentiat bey der Facultät in Paris, auf den Gebirgen Siout in Oberegypten entdeckt hat (1770). Wann und wo Daum Freimaurer wurde, ist nicht ermittelt. Er war bereits ein Freimaurer höherer Grade und offenbar hoch angesehen, als die Mutterloge zu den drei Weltkugeln , deren Mitglied er im selben Jahr geworden war, ihn 24.6.1762 zum 1. Großvorsteher des Maurerischen Tribunals , einer Schiedsstelle der Berliner Logen zur Beilegung ihrer Streitigkeiten, wählte. Daum hielt am selben Tag auf dem Johannisfest die Festansprache Über Stärke, Weisheit, Schönheit, die Grundlagen des Bundes, müssen im Charakter der Brr. zum Ausdruck gelangen ; die von → Georg Jakob Decker gedruckte Rede ist nicht überliefert. Am 5.10.1765 nahm ihn die Hauptloge der Afrikanischen Bauherren auf als Zeichen der Verbrüderung mit den Vereinigten Logen strikter Observanz ( Mutterloge zu den drei Weltkugeln , Zur Eintracht , Zum flammenden Stern ), blieb aber Mitglied der Mutterloge zu den drei Weltkugeln . Die Afrikaner wählten ihn 1766 zum Großmeister. Er trat am 15.10.1768 von dem Amt zurück. Mit dem Niedergang der Afrikanischen Bauherren endete seine aktive Zeit als Freimaurer. Er hatte gehofft, daß es ihm gelingen würde, "alles in Ordnung zu bringen und unseren Logen den Ruhm zu verschaffen, Vorbilder wahrer und vollkommener Maurer zu sein. Aber ach, ich sehe mich getäuscht. Jeder Bruder tut, was ihm gut scheint, jeder will befehlen und Regeln aufstellen, ohne selbst zu wissen, was Maurerei ist.“ Daum war einer der Mitgründer der St. Hedwigs-Kirche in Berlin, die Ignacy Graf Krasicki (1735-1801), Fürstbischof von Ermland und später Primas von Polen, ein aufgeklärter Schriftsteller, am 1.11.1773 weihte. Krasicki hatte 1772 Friedrich II. kennengelernt, der ihn an seinen Hof und zu seiner Tafelrunde in Sanssouci einlud. Er hielt in Heilsberg, seinem ermländischen Bischofssitz, seine schützende Hand über die Loge Äskulap , die sein Leibarzt? Watzel gegründet hatte ( GLL , 10.11.1780 Stiftungsurkunde).
Andreas Ludwig Christian Watzel († 11.1.1791 Heilsberg), Arzt in Heilsberg, Kreisphysikus des Ermlandes, vermutlich Leibarzt des Bischofs, a. 1773 in Königsberg von der Loge Zum Totenkopf ( GLL ), 1775 Mitglied der Königsberger Schwesterloge Phönix , 1777/78 Sekretär, 1778 10.9.1779 Logenmeister, gründete 1780 in Heilsberg die Loge Äskulap
Daum machte 1786, ein Jahr vor seinem Tod, sein Testament. Er gab einen Teil seines Vermögens in ein beständiges Familien-Fideikommiß (zwei Güter in Lietzow bei Charlottenburg, das Haus Breite Straße in Berlin, wertvolle Sammlungen; Majorat wurde 1805 und 1813 in Geldkapital umgewandelt).
Decker I, der Vater, der Ältere, Georg Jakob(12.2.1732 Basel/Schweiz-17.11.1799 Berlin), ref., entstammte einer Basler Drucker- und Verlegerfamilie, V Johann Heinrich Decker (vor 1710-1754), Rats- und Universitätsbuchdrucker in Basel, M Anna Katharina geb. Respinger (1706-1780, V Nik. Respinger [1677-1737], Kaufmann in Basel, M Anna Katharina geb. Silbernagel), ∞ 1755 Dorothea Luise Grynaeus (2.8.1734-23.11.1784, V Jean [Johann] Grynaeus [1685-1749], akademischer Oberhofbuchdrucker, M Katharina Louise geb. Caravacini [1705-1763], übernahm nach dem Tod ihres Mannes die Geschäftsführung der Offizin), von den zehn Kindern überlebten sechs das Kindesalter:
→ Georg Jakob Decker II
Katharina Dorothea Decker (* 1756) ∞ 29.10.1780 Christian Sigismund Spener (28.10.1753-30.10.1813), Buchdrucker
Luise Elisabeth Decker (1764-1832) ∞ 28.10.1781 → Friedrich Philipp Rosenstiel , deren Tochter Karoline Henriette Rosenstiel (1784-1832) ∞ 1817 → Johann Gottfried Schadow
Katharina Maria Susanna Decker (* 28.11.1767) ∞ 19.11.1788 Heinrich August Rottmann (1755 Bülzig/Herzogtum Württemberg-1837 Basel), im Geschäft Deckers tätig, 3.6.1788 Buchhändlerprivileg, 1791 Verlagsbuchhändler in Berlin, verlegte 1791 Wilhelm August Iffland Figaro in Deutschland. Lustspiel in fünf Aufzügen ; 1791 → Sigismund Friedrich Hermbstädt Systematischer Grundriß der allgemeinen Experimentalchemie, zum Gebrauch seiner Vorlesungen (3 Teile)
Johanna Henrietta Decker (28.8.1768-1852) ∞ 19.11.1788 den Baseler Schrift- und Stempelschneider Wilhelm Haas (15.1.1766 Basel-22.5.1838 Basel), Besitzer einer Schriftgießerei und eines Verlags
Georg Jakob Decker besuchte das Gymnasium in Basel, begann 14-jährig eine Lehre bei dem Berner Buchdrucker (Emanuel?) Hortin, arbeitete anschließend in der Offizin seiner Großmutter Dorothea Decker geb. Wild (1671 Basel-1754), die nach dem Tod ihres Mannes Johann Heinrich Decker (1705-1754), Rats- und Universitätsdrucker in Basel, dessen Druckerei im elsässischen Colmar fortführte, studierte anderthalb Jahre an der Universität Straßburg, wo er bei seinem Onkel Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), Professor für Geschichte und Rhetorik (1770/71 Universitätslehrer Johann Wolfgang Goethes ), wohnte. Er ging 1750 auf die Walz über Mainz, Frankfurt am Main, Leipzig und Zeitz, kam Ostern 1751 nach Berlin. Er arbeitete bei dem Hofbuchdrucker Christian Friedrich Henning (verlegte Karl Philipp Emanuel Bach: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen , 1753; fertigte den Satz von Voltaires Siècle de Louis XIV ), dann bei dem Buchdrucker Christian Ludwig Kunst, schließlich in der Akademischen Buchdruckerei (in der Wallstraße, 1762 fünf Pressen) des Oberhofbuchdruckers Jean Grynaeus, dessen Tochter Dorothea Louise Grynaeus er 1755 heiratete. Seine Schwiegermutter, die verwitwete Katharina Louisa Grynaeus, nahm ihn 1756 als Teilhaber in die Buchdruckerei (Grynaeus & Decker) auf, in deren alleinigen Besitz er nach ihrem Tod 1763 kam. Decker erwarb 1757 das Berliner Bürgerrecht sowie die Mitgliedschaft in der französischen Kolonie. Er verband Energie und berufliches Können mit Weltgewandtheit und politischem Gespür. Sein Aufstieg begann im Siebenjährigen Krieg 1758 mit zwei Flugschriften gegen die Gegner Preußens ([Johann Heinrich Gottlob]? Justi: Rechnung ohne Wirth, oder das eroberte Sachsen , Rentmeister Grüne: Ernsthaftes und vertrauliches Bauerngespräch , in brandenburgischem Niederdeutsch, mit großen Erfolg, 12 Fortsetzungen, druckte 15 000 Exemplare). Friedrich II. erteilte Decker wichtige Aufträge und verlieh ihm bedeutende Auszeichnungen: 1) 1763 die Direktion der typographischen Anstalt (Druckerei) für das kgl. Lotto, deren fünf Pressen im Gartensaal des Finckensteinschen Palais in der Wilhelmstraße standen; Faktor war sein Schwager Simon Kaspar Reinhard Grynaeus († 23.8.1781); 2) den Titel kgl. Hofbuchdrucker, dessen Rechte nach dem Tod des Hofbuchdruckers Henning auf ihn übergingen, der Titel wurde 1769 in der Familie erblich; 3) den Druck aller kgl. Arbeiten; 4) 1769 den Nachdruck aller im Ausland erschienenen, durch kein Spezialprivileg geschützten französischen Bücher. Decker nahm 1769 Werke für eigene Rechnung in Verlag. Er besaß Niederlagen in Mannheim, Frankfurt am Main, Basel, Halle (Saale), wo er ab 1772 Formulare und Accidenzien druckte, Wittenberg, Potsdam (bei dem Buchdrucker Sommer). Zudem eröffnete er einen umfangreichen Buchhandel, besuchte Jahr für Jahr die Messen in Leipzig, wo er bei dem Verlagsbuchdrucker Bernhard Christoph Breitkopf (1695–1777) Quartier nahm. In seinem Unternehmen arbeiteten 1772 25 Setzer und Drucker, 1782 31 Setzer und Drucker, 1783 in Schriftgießerei und Druckerei 50 Arbeiter, 1788 47 Setzer und Drucker. Der Berliner Arzt und Enzyklopädist Johann Georg Krünitz (1728-1796) stand 1776-1784 als Korrektor in seinen Diensten. Friedrich Wilhelm II. verlieh 1787 ihm und → Christian Friedrich Voß (1724-1795) das kgl. Privileg zu Druck und Verlag der Werke Friedrichs II. ( Œvres Posthumes de Frédéric II Roi de Prusse , 1788). Die Offizin mit zehn Pressen befand sich im Stadtschloß über dem Schloßportal. Herausgeber war → Johann Christoph v. Wöllner , Faktor → Johann Heinrich Wilhelm Dieterici . Bis 1789 erschienen 25 Bände der Œvres in großem Quartformat mit einer Auflage von 200 Exemplaren. Decker hatte schon früher Schriften Friedrichs II. verlegt, unter anderen Dialogue de morale à l'usage noblesse (1770), Essai sur les Formes de Gouvernement et sur les Devoirs des Souverains (1777) und De la littérature Allemande (1780). Seine Autoren waren Königin Elisabeth Christine, Ewald Friedrich v. Hertzberg, August Wilhelm Iffland, Johann Heinrich Jung (Jung-Stilling), → Anna Luisa Karsch, Friedrich Maximilian Klinger, Johann Kaspar Lavater, Johann Karl Wilhelm Möhsen, Johann Heinrich Pestalozzi. Er druckte musikalische Werke, so die von Karl Heinrich Graun. Daniel Chodowiecki lieferte zu vielen seiner Verlagstitel die Illustrationen. Zudem gab Decker mehrere Zeitungen und Zeitschriften heraus, ab 1762 Gazette françoise de Berlin (ab 1793 sein Sohn → Georg Jakob Decker ), 1764-1790 die von → Joseph du Fresne de Francheville gegründete und redigierte Gazette littéraire de Berlin , deren Redaktion 1781-1790 → Claude Étienne Le Bauld de Nans hatte, Journal littéraire mit dem Hauptmitarbeiter → Frédéric Adolphe de Castillon , 1772-1807 Nouveaux mémoires , ab 1792 das Intelligenzblatt . Der Verlagskatalog 1792 verzeichnete 400 Titel. Decker kaufte am 1.4.1765 das dreigeschossige Haus im Zopfstil Brüderstraße 29. Er wohnte bis zu seinem Tod in der Mitteletage des Vorderhauses, während sich die Buchdruckerei im Seitenflügel und im Quergebäude und die Schriftgießerei (1767) im linken Hofflügel befanden, außerdem ab 1769 der Verlag und das Sortiment. Das schmiedeeiserne Geländer des Treppenhauses befindet sich heute im Märkischen Museum Berlin. Decker war gastfreundlich, betrieb keinen falschen Aufwand, litt aber auch keine kleinliche Sorge und Kümmerlichkeit, besaß viel Gefühl für Natur. Er gab oft kleine Konzerte mit Dilettanten und Virtuosen in seinem Haus. Er hatte einen großen Freundeskreis. Bei ihm verkehrten der Schriftsteller und Direktor des kgl. Nationaltheaters Johann Jakob Engel (1741-1802), eines der Häupter der Berliner Aufklärung, Johann Karl Wilhelm Möhsen (1722-1795), Leibarzt Friedrichs II. und Mitglied der Gesellschaft der Freunde der Aufklärung, der Astronom Johann Elert Bode (1747-1826), Direktor des Berliner Observatoriums, Johann Gottlieb Gleditsch (1714-1786), Professor für Anatomie und Botanik am Collegium medico-chirurgicum und Direktor des Botanischen Gartens, → Anna Luisa Karsch. Decker trat am 15.3.1762 in Berlin, während des Siebenjährigen Krieges, der französisch arbeitenden Loge De la Concorde bei, einer Gesellschaft mit starkem gewerblichem Anteil. Die Loge beförderte ihn innerhalb eines Dreivierteljahres bis zum IV. Grad: 15.3.1762 Lehrling, Geselle, 26.4.1762 Meister, 26.11.1762 Schottenmeister, Mitglied der altschottischen Loge L'Union . Die Johannisloge wählte ihn am 7.6.1762 mit 11 zu 3 Stimmen zum Sekretär, 1768 zum 1. Vorsteher (bis 1776) und 1778 zum deputierten Meister. Er machte wie die Mehrheit der Berliner Freimaurer 1764 den Systemwechsel von der englischen Maurerei zur tempelherrlichen Strikten Observanz mit, erhielt als Ordensbruder der Präfektur Templin der VII. Provinz am 17.5.1765 den Ritterschlag mit dem Ordensnamen Eques a plugula (VI. Grad); sein Wappen zeigt in blauem Schild einen zusammengerollten Bogen weißen Papiers mit der Inschrift Oculis errantibus lucem invenit . Er blieb indes für andere freimaurerische Ideen und Systeme offen und schloß sich 1768, gleichzeitig mit seiner Zugehörigkeit zur Loge Zur Eintracht , den Afrikanischen Bauherrenlogen an (bis 1771). Nach dem Niedergang der Strikten Observanz folgte er der Führung seiner Großloge in den Gold- und Rosenkreuzerorden , der ihn 1778 in den Berliner Zirkel Heliconus einordnete (Direktor → Johann Christoph Wöllner ) mit dem Ordensnamen Gobii Gareus Keder Cocus. Wöllner erteilte ihm bis 1785 alle Grade bis zu dem VIII. des Meisters, der das große Werk, den Lapis philosophorum , den Stein der Weisen, bereitete, damit den höchsten in Preußen verliehenen Ordensgrad, und ernannte ihn zum Zirkelkassierer. Er charakterisierte seine Gemütsneigungen 1781 mit Großmut, Mitleiden, Gefühl für Religion u. Tugend . Decker erreichte 1785 den Höhepunkt seiner maurerischen Laufbahn mit der Wahl zum Meister vom Stuhl der hoch angesehenen Loge Zur Eintracht, der ältesten Berliner Tochter der Mutterloge zu den drei Weltkugeln . Er beklagte zuletzt die Uneinigkeiten und Unordnungen in der Großen National-Mutterloge , wodurch sein maurerischer Eifer merklich erkaltet sei, und legte am 9.12.1794 die Leitung der Eintracht enttäuscht nieder. Der 60-Jährige zog sich 1792 aus dem Geschäft zurück, das er seinem gleichnamigen Sohn übergab. Decker schrieb 1799 Erinnerungsblätter seines Lebens (bis 1763), die bisher nicht veröffentlicht sind.
Читать дальше