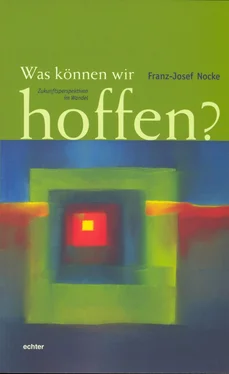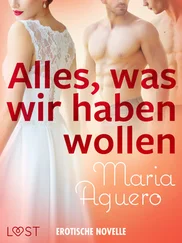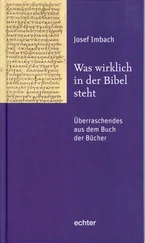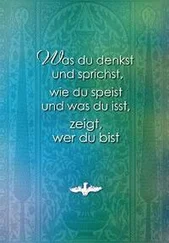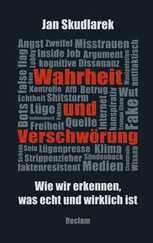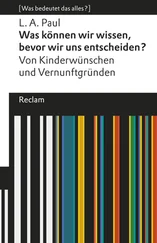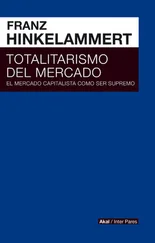Was ich hier begrifflich entfaltet habe, möchte ich noch durch eine persönliche Erinnerung illustrieren. Ich denke an die Jahre meiner Mitarbeit in einer Kirchengemeinde im Duisburg-Meidericher Ortsteil Hagenshof. Der Hagenshof war von der Stadt als Mustersiedlung geplant worden, entwickelte sich aber mit seiner zur Anonymität verleitenden Hochhausarchitektur schon während der Bauzeit zu einem sozialen Brennpunkt. Monatlich wird in jeden Haushalt das Gemeindeblatt gebracht, in dessen Kopfteil, leicht stilisiert, die Skyline des Hagenshofs zu erkennen ist – und darunter steht: „die neue stadt “.
Als das Blatt im September 1971 zum ersten Mal erschien, fragten sich manche: Was ist damit gemeint? Der Ortsteil, der hier mit zahlreichen Baukränen errichtet wird? Oder ein biblisches Motiv, das himmlische Jerusalem, das sich am Ende der Zeiten vom Himmel herab auf diese Erde senkt? Gemeint war beides – die Bilder sollten ineinander übergehen: „Aus dem Glauben an einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo es weder Tränen noch Leid noch Jammer geben wird, will die Katholische Kirchengemeinde … ein wenig dazu beitragen, dass unsere Neubausiedlung Hagenshof eine neue Stadt wird, in der es schon jetzt viele frohe Menschen gibt“, schrieb der Gründungspfarrer in der ersten Ausgabe. Er spielte damit auf die Bilderwelt der Johannesoffenbarung 7an, in der wiederum Hoffnungsbilder des Alten Testaments, besonders aus den Büchern Jesaja und Ezechiel 8verdichtet sind.
Diese Bilderwelt hat im Laufe der europäischen Geschichte immer wieder dazu inspiriert, Heilsgeschichte und Weltgeschichte miteinander in Beziehung zu setzen. Der Philosoph, Literaturkritiker und Theologe Johann Gottfried Herder nannte die Johannesoffenbarung „ein Buch für alle Herzen und alle Zeiten“. 9In jüngster Zeit sprach der Journalist Paul Badde von dem Einfluss, den das biblische Bild von der himmlischen Stadt auf die abendländische Geschichte ausgeübt habe: „Es gibt einen Schlüssel zum Geheimnis Europas. Er findet sich am Schluss der Bibel… Diese Worte liegen fast allen Umwälzungen unseres Erdteils wie ein verborgener Code zugrunde.“ 10Die Theologin Rita Müller-Fieberg hat eine differenzierte Dissertation über das Gespräch zwischen Theologie und Literatur über das Motiv „Neues Jerusalem“ vorgelegt. Sie schließt mit der Feststellung, das Bild von der verheißenen Stadt fordere dazu heraus, „die versprochene Lebensfülle schon jetzt in die eigene Gegenwart hineinzulassen.“ 11
Für uns, die wir jahrzehntelang die Bilderwelt der Johannesoffenbarung wie die verschlüsselte Botschaft einer uns fremden Welt eher umgangen hatten, traf sich ihre Wiederentdeckung mit der Neubelebung einer Theologie der Hoffnung. Heute rückschauend, sehen wir, woher wir gekommen waren und welchen Weg wir gegangen sind: Gegenüber einer „Jammertal-Frömmigkeit“, in welcher wir gelernt hatten, das „Irdische zu verachten und das Himmlische zu lieben“, 12wollten wir die Erde lieben, damit auf dieser Erde Himmel anfangen kann. In unseren jugendbewegten Träumen hatten wir das Geheimnis der Welt „jenseits des Tales“ gesucht, jetzt sollte Gottes geheimnisvolle Welt mitten in einer Hochhaus-Stadt wenigstens anfangshaft Wirklichkeit werden. Anders als im „Milieukatholizismus“ der ersten Jahrhunderthälfte, dem die Kirche wie eine Fluchtburg erschien, wie ein Bollwerk gegen die böse Welt draußen, sollte die Gemeinde dazu beitragen, dass es „frohe Menschen“ nicht nur im Gemeindezentrum, sondern im ganzen Hagenshof gibt: Kirche nicht in Abgrenzung zur Welt, sondern Kirche für die Welt. Im Unterschied aber zur Skepsis der Religionskritik, welche in der Religion nur ein Betäubungsmittel sah, mit dem geplagte Menschen sich vorübergehend über die Lasten des Lebens hinwegtrösten, das sie aber um so schlimmer lähmt, je mehr sie davon Gebrauch machen, setzten wir darauf, dass der Glaube ein Lebenselixier sein könnte: eine Prise Hoffnung zur Kräftigung für die nächsten Schritte. Es sollte eine „geerdete“ Hoffnung sein: Hier auf Erden soll anfangen, was einmal, bei der Vollendung der Schöpfung, ganz groß dastehen wird.
„In deinen Toren werd ich stehen…“
Es ist gewiss kein Zufall, dass unter den neuen geistlichen Liedern, die in dieser Gemeinde gesungen wurden, das Lied von der verheißenen neuen Stadt 13einen besonderen Platz einnahm. Das Lied geht mit seiner Melodie und mit manchen sprachlichen Bildern auf ein modernes israelisches Lied 14zurück, in welchem Jerusalem als ersehnte Stadt Israels besungen wird. Die durch die evangelische Pfarrerin Christine Heuser geschaffene deutsche Fassung setzt allerdings andere Akzente. Die „freie Stadt Jerusalem“ wird hier zu einem Bild für die ersehnte und erhoffte Vollendung der Welt. Das Ziel liegt noch in weiter Ferne. Die da singen, fühlen sich wie die Verschleppten in Babylon unter der Fremdherrschaft von mächtigen Herren. Ihre Wunden schmerzen:
„Ihr Mächtigen, ich will nicht singen
eurem tauben Ohr.
Sions Lied hab ich begraben
in meinen Wunden groß.“
Das erinnert an Motive des 137. Psalms:
„An den Strömen von Babel, da saßen wir
und weinten, wenn wir an Zion dachten.
Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land.
Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder,
unsere Peiniger forderten Jubel: ‚Singt uns Lieder vom Zion!’
Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn,
fern, auf fremder Erde?“ 15
Aber ein Versprechen hält die Hoffnung wach:
„Ich halte meine Augen offen,
liegt die Stadt auch fern.
In die Hand hat Gott versprochen:
Er führt uns endlich heim.“
Aus den Bildern der Erinnerung an die Mühen und Schmerzen der eigenen Geschichte werden Bilder der Hoffnung, aus den Steinen der Gefängnisse und der Gräber werden die Mauern der kommenden Stadt:
„Die Mauern sind aus schweren Steinen,
Kerker, die gesprengt,
von den Grenzen, von den Gräbern,
aus der Last der Welt.“
Die Erinnerung an die vergossenen Tränen verschmilzt mit dem Bild von den Stadttoren, die nach der Johannesoffenbarung wie Perlen glänzen:
„Die Tore sind aus reinen Perlen,
Tränen, die gezählt.
Gott wusch sie aus unsern Augen,
dass wir fröhlich sind.“
Und immer wieder klingt im Refrain das Grundmotiv durch: die Hoffnung, einmal in dieser Stadt zu Hause zu sein:
„In deinen Toren werd ich stehen,
du freie Stadt Jerusalem.
In deinen Toren kann ich atmen,
erwacht mein Lied.“
Mit solchen Bildern der Hoffnung bekamen Menschen in der gemeindlichen Alltagspraxis Augen für die Perspektive der Hoffnung. Diese Hoffnung entdeckte inmitten all der Lebensfeindlichkeiten und Unbehaustheiten dennoch die Anfänge einer neuen Welt. In zusammengewürfelten, einander zunächst fremden Menschen wuchs zumindest eine Ahnung davon, was Wohnung, Heimat, Gemeinschaft bedeuten könnte. Gemeinde wurde zum Treffpunkt, wo man einander vom eigenen Leben erzählen konnte – und wo man lernen konnte, welche Freude es macht, einander beizustehen.
Ermutigt durch diese Perspektive, engagierten sich viele in einer Bürgerinitiative, die sich, weit über die Grenzen der Kirchengemeinde hinaus, für mehr Lebensqualität im Ortsteil einsetzte. Dabei fühlten sie sich nicht wie Leute, die notdürftig noch einige Reparaturen an einem Haus anbringen, das letzten Endes doch zum Abbruch bestimmt ist, sondern eher wie Bauleute, welche die Bausteine für eine kommende Welt zusammentrugen. In dem, was sie taten, sahen sie den, wenn auch nur sehr bescheidenen, Anfang jener neuen Stadt, von der sie sangen: „In deinen Toren kann ich atmen.“ Und so konnten sie hin und wieder schon in der Gegenwart, auf der noch sehr unfertigen Baustelle, aufatmen.
Читать дальше