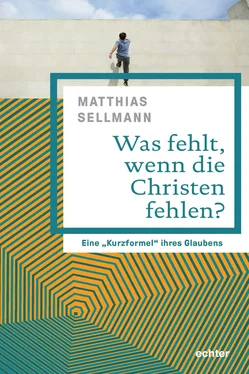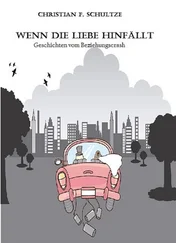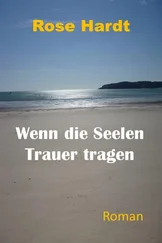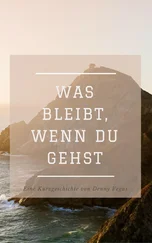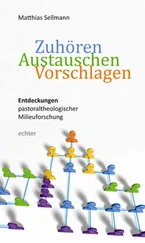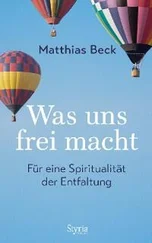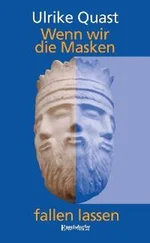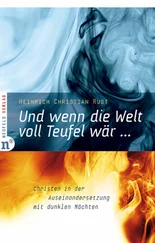Christsein, so die These hier, ist also erstens eine bestimmte Kompetenz, die man hervorragend dafür benutzen kann, seine individuelle Lebensleistung zu bringen und damit auch für das Gemeinwohl etwas beizutragen. So nämlich nutzt man die Dynamik der Kurzformel. Willst du deine Freiheit so leben, dass dein Leben im Ebenmaß zu dem deiner Leute gelingt und qualitativ gesteigert wird, dann prüfe für dich diese Kompetenz.
Und zweitens: Diese Kompetenz ist Ausdruck einer bestimmten Klugheit, also einer mentalen Ressource. Präziser: einer ‚geistlichen‘ Klugheit. Was dieses Adjektiv ‚geistlich‘ heißt, vor allem aber, was nicht, ist Gegenstand weiter unten in Kapitel 3.
Hier reicht für die Einführung, dass die beiden Begriffe ‚Kompetenz‘ und ‚Klugheit‘ wichtige Weichenstellungen der ‚Kurzformel‘ ausmachen. Zum einen sind es eminent auf Praxis hinzielende Substantive: Kompetenz ist das, was jemand kann; und klug ist die, die sich bewährt. Zum anderen aber geht es natürlich um Religiosität, wenn es um das Christsein geht. Man wäre schön enttäuscht, wenn sich das Lebenswissen einer religiösen Gruppe dann doch restfrei in säkulare Philosophie auflösen ließe. Auch wenn ich nichts vom obigen Versprechen zurücknehmen werde, dass sich die typisch christliche Lebensklugheit auch säkular leben lässt (worauf es im Projekt der Lebensleistung doch wohl zentral ankommt), so wäre es doch übergriffig in beide Richtungen, zu verschweigen, dass Christinnen und Christen diese Kompetenzen von ihrem Meister lernen, Jesus von Nazareth, den sie als präsent erfahren und als sehr, sehr kraftvoll.
Darum ‚geistliche‘ Klugheit. Dieser Vorschlag, Christsein elementar als eine Klugheit zu konzipieren, aus dem sich klare Kompetenzbündel folgern lassen, hat natürlich eine Spitze: Er will von vornherein verhindern, dass man im Christsein vor allem eine Ethik, eine Tugendlehre oder gar einen Benimm-Katalog vermutet. Das aber ist mit Sicherheit die Haupterfahrung vieler Leserinnen und Leser: dass das Christsein vor allem deswegen angeboten wird, damit man nichts falsch macht, nicht ‚sündigt‘, wie es dann heißt, dass man nicht aufbegehrt, sich im Zaum hält, keinen Ärger verursacht, nicht auf dünnem Eise wandelt oder den eigenen Trieben folgt. Christsein wird durch solch moraline Durchsäuerung zu einem ganz blutleeren Geschäft, völlig ungeeignet zum Bestehen eines Lebens, erst recht eines modernen, beschleunigten, technisierten Lebens. Das Ziel scheint darin zu liegen, einen Ball gar nicht zu treten, weil man danebenschießen könnte. Frommgesprochene Risikoangst beherrscht die Agenda; und das Ethos der Willfährigkeit lullt das gesunde Aggressionspotenzial ein, das auf Veränderung aus ist, auf Selbstwirksamkeit, auf start-up und auf die once in your lifechance .
Die Rede von einem Christsein als Klugheit steuert klar gegen solch eine kleinbürgerlich nörgelnde Gouvernanten-Ethik (Karl Rahner) – die übrigens erst seit dem 19. Jahrhundert triumphiert, seitdem aber einen langen Schatten wirft. Wir werden im Buch mit höchster biblischer Autorität sogar nicht einmal davor zurückschrecken müssen, dass es hier auch um eine bestimmte Bauernschläue geht, um strategische Intelligenz, um Durchsetzungsvermögen. Die Lebensleistung ist eben eine echte Leistung; Leistung aber ist, physikalisch gesehen, Arbeit durch Zeit; und man kann Religiosität auch so denken, dass sie zu einer Intensivierung dieser Arbeit aufrüttelt, statt vor der Knappheit der verfügbaren Zeit zu warnen.
Der Gedankengang in der Übersicht
Getreu dem Titel steht das Wort ‚Kurzformel‘ im Zentrum des Buches. Diese Formel wird sofort im nachfolgenden Kapitel 2 präsentiert.
Ist man ehrlich, muss man sagen: Mit diesem Kapitel könnte auch Schluss sein. Denn es wurde ja festgestellt: Leben muss man schon selbst; das Lesen wird die Mühe (aber auch den Spaß) nicht ersetzen; und Klugheit hat es an sich, dass man sie nur erlangt, wenn man riskiert, sie zu brauchen. Das Buch wird zeigen, dass auch geistliche Klugheit nur aus Risikobereitschaft resultiert.
Nimmt man nun noch hinzu, dass der Beweis für eine Erprobung der christlichen Lebensentdeckungen auch von nicht-religiös Gebundenen darin liegt, dass man ‚es‘ einfach tut, hat man einen weiteren guten Grund dafür, das Buch nicht bis zum Ende zu studieren. Trainiert wird das Ganze in realen Situationen.
Für die, die nach Kapitel 2 schon Lust kriegen, das Ganze auszuprobieren, hat das Buch bereits eines seiner Ziele erreicht. Es wird aber manche andere geben, die mit so viel Vorschussvertrauen doch etwas sparsamer sind. Man will ja nicht überredet, man will überzeugt werden.
Darum kümmern sich die weiteren Abschnitte. Kapitel 3 fokussiert auf das Adjektiv ‚geistlich‘. Hier sind eine Menge Missverständnisse abzuwehren, bis man auch hier die Karikaturen hinter sich gelassen hat. Der Lohn: Mit dem griechischen Wort ‚phronesis‘ erhält man einen neuen und überraschend profanen Zugang auf etwas sehr Frommes.
Kapitel 4 löst ein, warum das Buch den Optimismus verbreitet, auch nicht-r eligiöse Personen könnten von religiösen Gedanken real profitieren. Neue Erkenntnisse über das, was religiöse Erfahrungen im Kern sind, lassen die Monopole erodieren und geben den Blick frei auf jene weltanschauliche Kreativität, in der wir alle längst stecken – und zwar gerne. Zudem zeigt der Blick auf die alttestamentliche Weisheitsliteratur, dass sogar die Bibel lange nicht so konventionell religiös ist, wie man eventuell dachte.
Kapitel 5 bietet die neutestamentliche Grundlage für die hier entwickelte Kurzformel. Diese wird ja nicht einfach am grünen Tisch entwickelt, sondern hat den Anspruch, authentisch die ‚Schrift und die Tradition‘ auszulegen, wie man theologisch sagt. Der Text, um den es geht, ist ein Lied, an das sich der Apostel Paulus im Gefängnis erinnert, als er um sein Leben fürchtet.
Nach Kapitel 5 ist etwa die Hälfte des Buches erreicht. Die andere gehört der weiteren Erläuterung der Kurzformel und ihrer Elemente. Drei weitere griechische Begriffe – alle abgeleitet aus dem Gefängnislied des Paulus – bilden die Kapitel 6 bis 8 und die Überschriften: physis, kenosis und dynamis . Sie stehen für die drei Kompetenzen geistlicher Klugheit: immer weniger wegrennen müssen; aus sich herauskommen; Kraft von außen aufnehmen.
Um diese drei Lebenskünste kreist alles. (Und da ist sie wieder: die Zahl Drei.) Wer sie hat und wer sie kann, ist ein Glückspilz. Sie sind das, was fehlt, wenn die Christen fehlen. Nicht weil sie diese Künste virtuos leben – das wäre vermessen zu sagen. Aber sie erinnern daran, dass es sie gibt. Und sie vermissen es, wenn niemand sie lebt.
Ihre Kurztitel heißen: physis, kenosis und dynamis . Sie alle ergeben die eine Klugheit ( phronesis ). Wer diese Klugheit lebt, so das Versprechen und die Erfahrung, füllt sein Leben und im selben Zuge, das ist das Schöne, auch das der anderen.
Einen Griechisch-Kurs bilden die Kapitel 6 bis 8 trotzdem nicht. Zwar werden die Begriffe gut erklärt; dann aber geht es bunter zu. Es wird gezeigt, wie große und wie normale Gestalten christlichen Lebens diese drei spirituellen Varianten umgesetzt haben. Und dann: wie physis, kenosis und Co. riechen (keine leere Ankündigung – reiben Sie mal an der beigefügten Postkarte!), wie sie aussehen, sich anhören, wie man mit ihnen Ernst und wie man mit ihnen Comedy macht. Eine multisensuale Präsentation also – da es um Lebensleistung geht, darf es schließlich nicht zu trocken werden.
Am Ende kommen in Kapitel 9 Abrundungen, Anwendungen, Überraschungen, Weiterleitungen.
*
So weit das Verlesen der Speisekarte. Bevor aufgetragen wird, vier kurze Klärungen:
Читать дальше