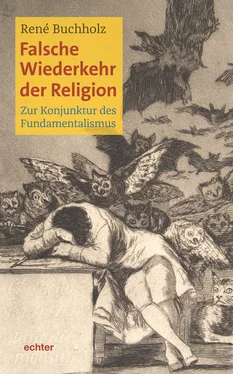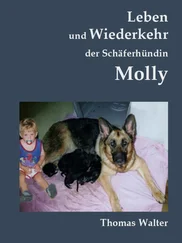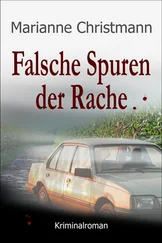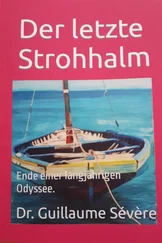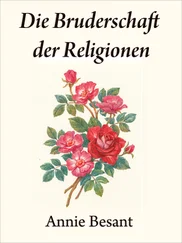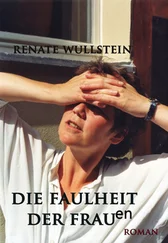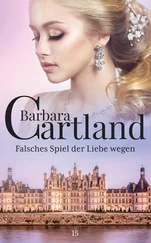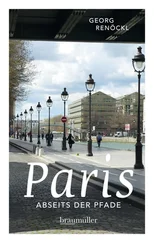Aber auch außerhalb Frankreichs werden ähnliche Fragen diskutiert. Fallen die Sanktions- und Steuerungsinstrumente des laizistischen Staats in die Hände eines noch vor wenigen Jahren als gemäßigt eingestuften Islamismus wie in der Türkei unter Recep Tayyip Erdoğan, so stehen wichtige demokratische Errungenschaften auf dem Spiel, wie sich inzwischen zeigt. Der Siegeszug des Islamismus nach dem Sturz der mehr oder weniger säkularen Diktaturen in Teilen Nordafrikas und im Nahen Osten, der erhebliche Einfluss eines fundamentalistischen Protestantismus in den Vereinigten Staaten, die Priesterbruderschaft St. Pius X. im katholischen Raum nebst einer Reihe von traditionalistischen Gruppen, die den offenen Bruch mit Rom zu vermeiden suchen, die religiöse wie säkulare Siedlerbewegung und ultra-orthodoxe Gruppen in Israel – dies alles müsste den Aufklärern des 18. Jahrhunderts als Albtraum erscheinen und nährt auch bei heutigen Zeitgenossen die Befürchtung, wir lebten in einer Epoche des Fundamentalismus. Schon die Fatwa gegen Salman Rushdie gab einen ersten Vorgeschmack der antiliberalen, totalitären Tendenz des Fundamentalismus. 19Dieser rechtfertigt sich nicht als legitimer Teil einer multikulturellen Welt. Mit Blick auf die Attentate von Paris im Januar 2015 – man denkt inzwischen auch an andere Anschläge – schrieb der israelische Schriftsteller Amos Oz : „Vielleicht ist es an der Zeit, aufzuhören, Multikulturalismus und Political Correctness mit absolutem moralischen Relativismus zu verwechseln. Mord ist ein absolutes Übel, kein relatives. Manche Verfechter eines radikalen Multikulturalismus, manche Anhänger fanatischer Political Correctness sagen uns: ‚Sie glauben an die Meinungsfreiheit, andere glauben an Allah, wo liegt der Unterschied?‘ Nun, der Unterschied liegt darin, dass die, die an Meinungsfreiheit glauben, nicht diejenigen ermorden, die an Allah glauben, während einige wenige, die an Allah glauben, diejenigen abschlachten, die an Meinungsfreiheit glauben.“ 20Abgesehen von der nicht unwichtigen Frage, ob die Meinungsfreiheit Gegenstand eines – wie auch immer definierten – ‚Glaubens‘ ist oder, was näher liegt, analytisch aus der Würde des Menschen folgt, ist die hier markierte Differenz genau zu beachten. Um möglichen Missverständnissen und Applaus von der falschen Seite vorzubeugen, schreibt Amos Oz: „Die Plage des 21. Jahrhunderts ist nicht der Islam, sondern der Fanatismus. Die Morde von Paris haben viel mehr gemein mit gewalttätigen Christen und jüdischen Rassisten als mit friedlichen Muslimen.“ 21
Der religiöse Fanatismus ist – auch und bewusst nach Europa – zurückgekehrt. Er erweist sich kaum noch als „maskierter Nihilismus“ – wie es im Titel von Christoph Türckes Studie heißt 22–, sondern als offener. Das Übermaß an Grauen, Absurdität und Destruktion, mit dem er sich verbindet, ist offensichtlich, es hat nichts Kryptisches mehr. Der Fundamentalismus kann im 21. Jahrhundert nicht mehr als ‚Schrulle‘ und zu tolerierende Besonderheit einiger harmloser Narren angesehen werden. Auch dort, wo er nicht zu gewaltsamen Aktionen übergeht – und dies betrifft glücklicherweise immer noch den größten Teil seiner Anhänger –, verbindet er sich mit Geistfeindschaft, oft mit autoritären politischen Programmen oder – wie in weiten Teilen des protestantischen Fundamentalismus in den USA – mit einem Begriff von Freiheit, der sich auf das Recht des ökonomisch Stärkeren reduziert und eher an Nietzsches Idee des Übermenschen erinnert.
Die Bezeichnung ‚Fundamentalismus‘ hat, wie Sébastien Fath schreibt, „eine stigmatisierende Wirkung“ 23; the „dirty 14-letter word“ oder gar the „F-word“, wie auch Malise Ruthven es provokativ nennt, 24ist durchaus geeignet, Individuen wie Gruppen zu diskreditieren. Es wird zum Stigma sowohl in politischen als auch in religiösen Auseinandersetzungen. Aus einer positiven Selbstbezeichnung bestimmter christlicher Gruppen im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts über einen summarisch gebrauchten religionswissenschaftlichen, soziologischen und kulturtheoretischen Terminus bis hin zum Schimpfwort reicht das Spektrum. Gerade in seinem pejorativen Sinne zielt es auf Leute, die als unsympathisch, humorlos, fanatisch, ja bedrohlich eingestuft werden. Und vor allem: Fundamentalistisch und fanatisch sind immer die anderen; 25eben jene, die bestimmten Maßstäben von Aufklärung und Pragmatismus nicht zu genügen scheinen.
Diese selbstsichere Zuordnung eines hässlichen Etiketts provoziert allerdings ihrerseits Fragen: Ist etwa jeder ein Fundamentalist, der zögert zugunsten kurzfristiger Erfolge in Politik und Wirtschaft zentrale Grundsätze und Überzeugungen preiszugeben? Müssen Religionsgemeinschaften sich ihrem säkularen Umfeld unbegrenzt assimilieren? Ist gar die Alternative zum Fundamentalismus nur grenzenloser Opportunismus? Zudem ist die Gleichsetzung von Säkularismus und Demokratie angesichts der Diktaturen im ehemaligen Ostblock, des Schah-Regimes und der Bath-Regimes im Irak und in Syrien problematisch. Umgekehrt entfalteten gerade die monotheistischen Religionen seit ihren Anfängen in ihrer Geschichte ein von ihren Verächtern unterschätztes oder übersehenes kritisches Potenzial. Die Krisenbewältigung und ein Bewusstsein für die Ungerechtigkeit der Geschichte sind ihrer Genese eingeschrieben. Die Reduzierung dieser Religionen auf eine harmlose theologische Überhöhung des Alltags würde ihr vielleicht das Gefahrenpotenzial nehmen – aber auch jegliche Relevanz, die über die Bestätigung des ohnehin Bestehenden hinausgeht. Der Fundamentalismus beansprucht gerade die nonkonformistische, produktive Seite des Monotheismus für eine verhärtete Pietät und bringt ihn so um sein Bestes.
Es gibt also eine ganze Reihe von Fragen, deren Beantwortung in einem Grenzgang zwischen Religionswissenschaft, Philosophie, Theologie, Soziologie und Politikwissenschaft versucht werden soll. Der Fundamentalismus ist ein modernes Phänomen, 26nicht einfach eine Rückkehr in das Mittelalter, von dem seine Verehrer und Verächter sich ohnehin ein wenig zutreffendes Bild machen. Es gab – in vielen Regionen sogar bis Ende des 19. Jahrhunderts – eine Tradition, in die man hineingeboren wurde, in die man innerhalb der Familie hineinwuchs und die nicht mit allen Mitteln verteidigt werden musste, weil sie selbstverständlich galt und das gesamte Leben prägte. In einem nicht geringen Umfang waren Differenzierungen möglich, welche der auf Homogenität achtende Fundamentalismus verwirft. Ihm gegenüber erscheint das Mittelalter geradezu als ‚aufgeklärt‘. Im Raum mittelalterlicher Städte zeichneten sich mit der zunehmenden Rationalisierung von Wirtschaft und Politik erste Transformationsprozesse der Gesellschaft ab, ohne die Geltung religiöser Überlieferungen prinzipiell infrage zu stellen. Eher förderte die urbane Gesellschaft des Mittelalters weitere Differenzierungen der Religion. So waren – anders als es der Sehnsucht modernitätsskeptischer Zeitgenossen behagt – vormoderne Gesellschaften, Kulturen und Religionsgemeinschaften keineswegs in sich einheitlich und geschlossen, was sich nicht zuletzt in den unterschiedlichen Ausprägungen der Tradition niederschlägt. Schichtenspezifische Interessen, diverse Bräuche, Mentalitäten, reformorientierte wie konservative Gruppen und nicht zuletzt starke regionale Unterschiede arbeiteten intensiv an der Ausgestaltung der Tradition, von der man nicht ohne Bedenken im Singular sprechen kann. So ist bereits prima facie der unbefangene Traditionalismus vom Fundamentalismus, der auf die immer schnelleren Modernisierungsschübe und die dadurch ausgelöste Erosion der Tradition reagiert, zu unterscheiden, auch wenn die Übergänge oft fließend sind. Identität – religiöse wie kulturelle – gerät mehr und mehr zu einem aufwendigen Projekt, sobald deren Fragilität im historischen Prozess offenbar wurde und die einstige Unbefangenheit verloren ging.
Читать дальше