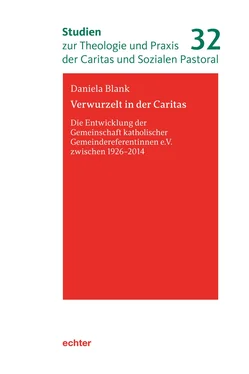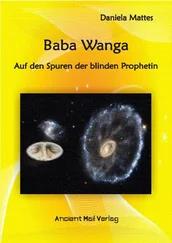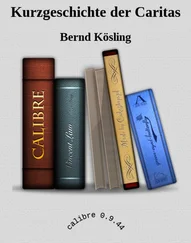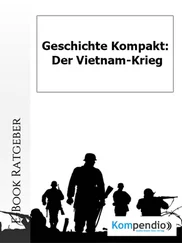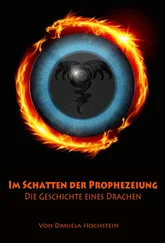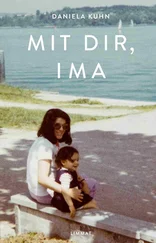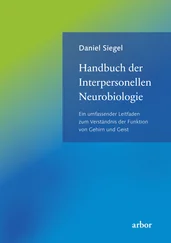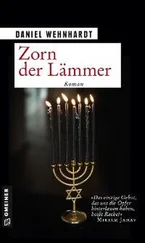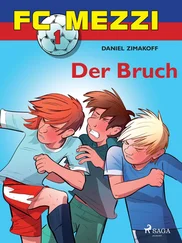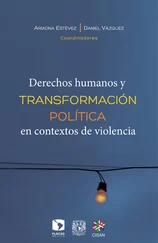Abbildung 1: Pater Wilhelm Wiesen und Margarete Ruckmich (1935).
Quelle: AMRH
Abbildung 2: Erster Nachschulungskurs 1926. Ganz links: Pater Wilhelm Wiesen; in der Mitte sitzend: Margarete Ruckmich.
Quelle: Brigitte Schuster
Abbildung 3: Das Werthmannhaus in Freiburg. Sitz des Deutschen Caritasverbandes, der Geschäftsstelle der Berufsgemeinschaft von 1926 bis 1969, sowie der Gemeindehelferinnenschule.
Quelle: ADCV Bilder zur Chronik 1926-1980
Abbildung 4: Ein Mitglied mit Haube und Berufsabzeichen.
Quelle: ADCV 2011/025 (7)
Abbildung 5: Das Berufsabzeichen. Die erste Brosche der Berufsgemeinschaft katholischer Gemeindereferentinnen.
Quelle: ADCV Bilder zur Chronik 1926-1980.
Abbildung 6: Schulheim der Gemeindehelferinnen und Erholungsmöglichkeit in der Hildastraße 65 in Freiburg.
Quelle: Brigitte Schuster
Abbildung 7: Ausbildungskurs 1928/1930.
Quelle: ADCV Bilder zur Chronik 1926-1980.
Abbildung 8: Der Frohhof in Günterstal bei Freiburg. Quelle: AMRH.
Abbildung 9: Die zweite Brosche der Berufsgemeinschaft katholischer Seelsorgehelferinnen. Quelle: Brigitte Schuster
Abbildung 10: Das Bruder-Klaus-Heim in Bad Kissingen. Heim der Berufsgemeinschaft von 1948 bis 1952. Quelle: AMRH.
Abbildung 11: Mitgliederanzahl 1926-2011
Abbildung 12: Organe der Berufsgemeinschaft ab 1927
Abbildung 13: Organe der Berufsgemeinschaft ab 1934
Abbildung 14: Organe der Berufsgemeinschaft ab 1980
Abbildung 15: Elemente d. Bedeutung d. Berufsgemeinschaft für ihre Mitglieder
Abbildung 16: Faktoren der Etablierung des Berufsbildes der Seelsorgehelferin
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Inhalte des Interviewleitfadens
Tabelle 2: Beispiel für die Verwendung des Anonymisierungsprotokolls
Tabelle 3: Übersicht über das Kategoriensystem
Tabelle 4: Interne und externe Faktoren für den Mitgliederrückgang
1. Einleitung
1.1 Forschungsgegenstand und -ziele
1.1.1 Forschungsgegenstand
Die vorliegende Arbeit stellt die Entwicklung der Gemeinschaft Katholischer Gemeindereferentinnen von ihrer Entstehung bis zu ihrer Auflösung dar. Sie soll einen Beitrag dazu leisten, die innerkirchliche sowie gesellschaftliche Wahrnehmung des Beitrags der Frauen in der (katholischen) Kirche zu vergrößern. Frauen in der Seelsorge stellen sich selbst und ihre Arbeit häufig nicht in den Vordergrund, und doch haben sie eine Bedeutung, die historisch selten aufgearbeitet wird. Da die Berufsgemeinschaft sich beim Entstehen dieser Arbeit in der Auflösung befand, bestand die Gefahr, dass die jahrzehntelange Arbeit und das erfolgreiche Bemühen um die Festigung eines mittlerweile selbstverständlichen und anerkannten hauptamtlichen Berufes für die Frau in der katholischen Kirche in Vergessenheit geraten würde.
1.1.2 Fragestellungen
Neben der historischen Aufarbeitung und Darstellung der Entwicklung der Berufsgemeinschaft mit ihren Inhalten und Zielen wird insbesondere die Bedeutung der Berufsgemeinschaft zum einen für den Berufsstand insgesamt und zum anderen für die einzelnen Mitglieder der Berufsgemeinschaft in den Fokus der Arbeit gestellt. Die Gründe für den Mitgliederrückgang und damit auch für die Auflösung der Berufsgemeinschaft sollen dargestellt werden. Somit ergeben sich folgende Fragestellungen:
■ Mit welchem Hintergrund wurde die Berufsgemeinschaft gegründet und welche Ziele verfolgte sie?
■ Welche Möglichkeiten besaß die Berufsgemeinschaft, ihre Ziele zu verfolgen und wie nutzte sie diese konkret?
■ Welche Bedeutung hatte die Berufsgemeinschaft für ihre Mitglieder?
■ Welche Begründungen für den Mitgliederrückgang in der Berufsgemeinschaft lassen sich finden?
■ Inwieweit kann die Berufsgemeinschaft als relevante Institution betrachtet werden in Bezug auf die Entwicklung der pastoralen Laienberufe für die Frau in der katholischen Kirche, vor allem in Bezug auf das Berufsbild der heutigen Gemeindereferentin und des heutigen Gemeindereferenten?
Der Psychologe Heinz Schuler ist der Auffassung, dass auch Kirchen und Verbände als Organisationen zu gelten haben. Als solche sind sie demnach auch für die Organisationspsychologie interessant. 2Für die vorliegende Arbeit können vor allem folgende Themen als besonders relevant betrachtet werden: Das Commitment in Organisationen, die Organisationsentwicklung sowie die Unternehmenskultur. 3
Das Commitment sowie die Unternehmenskultur werden schwerpunktmäßig im empirischen Part dieser Arbeit durch eine Befragung von (ehemaligen) Mitgliedern mithilfe von Interviews sichtbar. Preisendörfer empfiehlt drei Fragen, die zu stellen sind, um eine Organisation zu untersuchen:
„Für diejenigen, der [sic!] eine Organisation wissenschaftlich beschreiben und analysieren wollen, empfehlen sich stets die drei Fragen: Wer sind die relevanten Akteure bzw. Akteurgruppen, welche Interessen haben sie, und über welche Möglichkeiten zur Durchsetzung ihrer Interessen verfügen sie […]?“ 4
Die vorliegende Arbeit versucht, den hier genannten Fragen nachzugehen und die Akteurinnen der Berufsgemeinschaft mitsamt ihren Interessen und Optionen zur Durchsetzung derselben darzustellen.
1.2 Forschungsstand und Quellenlage
1.2.1 Stand der Forschung
Während zu dem Thema pastorale Berufe in der Katholischen Kirche auch in Bezug auf Frauen in der Katholischen Kirche einige Veröffentlichungen zu finden sind, existiert eine Publikation zur Geschichte der Berufsgemeinschaft bisher nicht. Zu dem Thema wurde eine Masterarbeit von der Verfasserin selbst verfasst, die allerdings nicht publiziert wurde und lediglich die ersten 40 Jahre der Berufsgemeinschaft erforschte. 5Die Berufsgemeinschaft selbst gab weiterhin einige Jubiläumsschriften heraus.
Eine Publikation von Almut Rumstadt über Margarete Ruckmich leistet bereits einen wertvollen Beitrag über die Initiatorin des Berufes der heutigen Gemeindereferentin. 6
Die an der Theologischen Fakultät Freiburg mit dem Titel Frauen als Seelsorgerinnen. Die Entwicklung des Berufs Seelsorgehelferin, dargestellt am Lebenswerk von Margarete Ruckmich (1894-1985) eingereichte Dissertation bearbeitet sowohl eine umfassende Biografie Ruckmichs als auch die Darstellung der Entwicklung des Berufes der Seelsorgehelferin. Hierbei wird auch ein besonderes Merkmal auf die erste Ausbildungsstätte (Katholische Gemeindehelferinnenschule) in Freiburg gelegt, die von Ruckmich wesentlich geprägt wurde. Die Berufsgemeinschaft findet ebenso Erwähnung, wird aber nicht umfassend dargestellt. 7
1.2.2 Quellenlage
Im Archiv des Deutschen Caritasverbandes, welches sich in der Zentrale des Deutschen Caritasverbandes in Freiburg befindet, finden sich einige Akten zur Berufsgemeinschaft. Kurz vor Beginn des Dissertationsvorhabens wurde von der Berufsgemeinschaft eine große Auswahl an Akten in das Archiv des Deutschen Caritasverbandes übermittelt. Eine außerordentliche Zugangsberechtigung wurde von der damaligen Vorsitzenden der Berufsgemeinschaft an die Verfasserin erteilt, sodass ein Zugang zu diesen einzigen Archivunterlagen möglich wurde. Die dortigen 64 Akten sind zum Zeitpunkt der Dissertation noch nicht inventarisiert worden, befanden sich aber größtenteils in mit Jahreszahlen gekennzeichneten Aktenordnern. Das Archivmaterial umfasst beispielsweise einen allgemeinen Schriftwechsel ab 1926, Protokolle der Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen, Protokolle und Berichte aus der Arbeit der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Berufe der Gemeindereferentinnen und Religionspädagogen (ab 1978), Protokolle und Unterlagen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Gemeindereferentinnen und Religionspädagogen (ab 1987), Unterlagen der Jubiläumsfeiern der Jahre 1951 (25 Jahre), 1976 (50 Jahre), 1986 in Limburg, 1996 in Vierzehnheiligen und 2009 in Limburg. Außerdem befinden sich Unterlagen zu Entwicklung des Berufs und der Gemeinschaft im Archiv.
Читать дальше