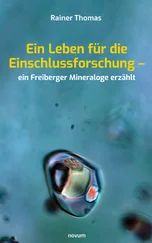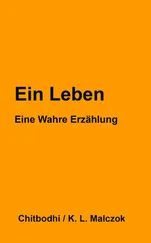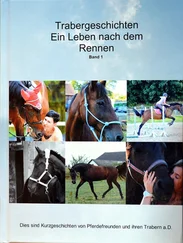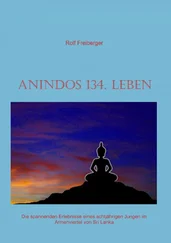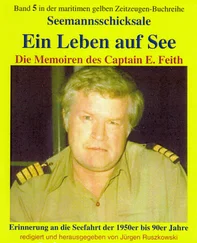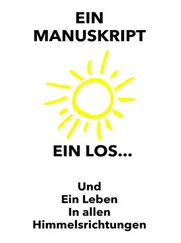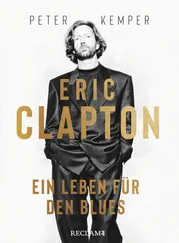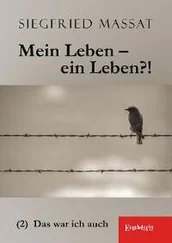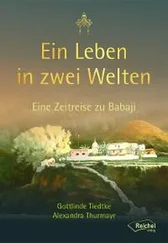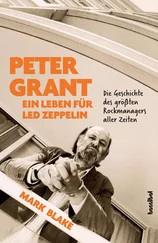1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 Zuerst gefiel es Margrit gut in Vilvoorde. Ausser ihr besuchte nur eine weitere Schweizerin das Institut, sie sei «ein nettes Ding». Was Margrit auffiel, war vor allem die gute Verpflegung. «Hier in Belgien hat es sehr guten Kaffee, alle Tag Fleisch manchmal zweimal, Kartoffeln und Gemüse. Das Essen gefällt mir also sehr gut. Bald hätte ich noch vergessen dass es jeden Tag Dessert gibt.» Auch mit den Klosterschwestern vertrug sie sich von Anfang an gut. Trotz der strengen Hausordnung empfand sie das Leben als nicht besonders anforderungsreich: «Schaffen müssen wir nicht allzu viel. Wir haben viel freie Zeit.» Sie arbeitete in der Kapelle und erhielt dafür grosses Lob. In der 16-jährigen Louise Marijmissen, einem einfachen, lieben, vielleicht etwas naiven belgischen Mädchen fand sie eine gute Freundin. Sie schloss offenbar auch einige Kontakte mit der lokalen Bevölkerung und kannte die Familie des Vilvoorder Bürgermeisters. In einer undatierten Karte von 1934 schreibt Margrit dann allerdings, dass es «streng» sei. Die Geschwister und die Mutter schrieben zurück, berichteten vom eigenen Alltag und von Ereignissen und Routine in Familie und Nachbarschaft.
Dann kam es zu einer Veränderung. Anfang 1935 verfasste Margrit einen Brief an Ida, konnte ihn aber offenbar nicht abschicken, da sie krank wurde. Das übernahm eine Schwester M. M. Berchmans, die für Margrit eine Art Vertrauensperson geworden war. Diese fügte dem Brief einige persönliche Zeilen bei und erwähnte, dass Margrit seit einiger Zeit sehr schlecht esse. Sie habe versprechen müssen, mehr zu sich zu nehmen, wenn sie bis Juli 1935 am Institut bleiben wolle – offenbar war das der vorgesehene Zeitpunkt, an dem Margrit die Ausbildung abschliessen und in die Schweiz zurückkehren sollte. Schwester Berchmans betonte, sie sehe keinen Anlass zur Sorge. Offenbar durchlebte Margrit eine Krise – oder einen innerlichen Kampf. Die knapp 18-Jährige trug sich ernsthaft mit dem Gedanken, in Vilvoorde ins Kloster einzutreten. Ihre Freundin Louise wurde denn auch Postulantin und trat in den Orden der Ursulinen ein. Wahrscheinlich hatten die Freundinnen die Idee gemeinsam ausgeheckt, wie in einem späteren Schreiben von Louise angedeutet wird. Ob die Unlust zum Essen damit zusammenhing oder vielmehr diesen Gedanken auslöste, lässt sich nicht feststellen. Die beunruhigte Mutter verlangte von Schwester Berchmans, dass Margrit sofort einen Arzt aufsuche. Dieser stellte indes nichts Ernstes fest und meinte, Margrit könne problemlos bis Juli bleiben, wenn sie richtig esse. Er gab ihr ein Stärkungsmittel.
Die Nachrichten aus Belgien müssen zu einem ungünstigen Zeitpunkt am Kapellenweg eingetroffen sein. Anna war nun ernstlich erkrankt. Auch mit dem Vater gab es – einmal mehr – Probleme: Entweder war er krank, oder der Wunsch seiner jüngsten Tochter löste bei ihm einen Tobsuchtsanfall aus – feststellen lässt sich das nicht mehr. Auf alle Fälle wurde Margrit nun in die Schweiz zurückbeordert, vor Ablauf der regulären Ausbildungszeit. Schwester Berchmans ermahnte Margrit, sie solle sich noch gedulden mit einer Entscheidung zum Klostereintritt. Sie sei sehr jung und solle nichts überstürzen. Wenn Gott wolle, dass sie den Schleier nehme, werde er ihr das schon rechtzeitig zeigen. In der Zwischenzeit solle sie für den richtigen Weg beten. Die Ursulinen-Schwesterngemeinschaft werde das auch für sie machen.
Ende April 1935 verliess Margrit Vilvoorde wieder in Richtung Heimat. Ob sie ihre Ausbildung abgeschlossen hatte oder nicht, lässt sich nicht eruieren. Die Arbeitssuche in der Schweiz gestaltete sich schwierig. Sie nahm deshalb eine weitere Ausbildung als Zahnarztgehilfin in Angriff und fand damit Ende 1935 eine Stelle beim Brugger Zahnarzt Gloor. Dort blieb sie nur kurze Zeit; bereits am 1. September 1937 wechselte sie als Sekretärin und Buchhalterin zum Landwirtschaftlichen Bauamt des Bauernverbands in Brugg.
Kontext
Die Region Brugg-Windisch 1917–1970
Das Prophetenstädtchen Brugg war lange von der Industrialisierung unberührt geblieben. 3Doch in den zwei Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg ging es dann umso schneller voran: Aus dem verschlafenen Provinznest wurde ein nicht unbedeutendes Industriezentrum, zwar hinter dem nachbarlichen Rivalen Baden, das mit der Brown Boveri & Cie (BBC) schon damals einen Weltkonzern in seiner Mitte hatte, aber doch zumindest auf gleicher Augenhöhe mit der Kantonshauptstadt Aarau und weit vor allen anderen Bezirkshauptorten und Provinzstädten des Kantons. Windisch hatte, abgesehen von der schon 1829 angesiedelten Spinnerei Kunz, keinen solchen Industrialisierungsschub; aber in Windisch wohnten viele der Arbeiter und Angestellten der Brugger Industrieunternehmen. Zwischen den beiden Gemeinden entstand, bei allen politischen und mentalitätsmässigen Rivalitäten, eine enge wirtschaftliche Symbiose. Waren die beiden Orte über Jahrhunderte physisch klar voneinander getrennt, war bis 1920 der Siedlungsteppich entstanden, den wir heute kennen. Die Einwohnerzahl Windischs betrug 1920 3491, jene Bruggs 4860. Gegenüber dem frühen 19. Jahrhundert war das eine Versiebenfachung (Brugg) beziehungsweise eine Verfünffachung (Windisch) der Bevölkerung in etwas mehr als 100 Jahren. Brugg war zudem ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt des Landes. Mit dem Bau der Bözbergbahn wurden hier die wichtigen Linien von Zürich nach Bern und von Basel nach Zürich miteinander verbunden. Nach 1882 kam noch die Strecke nach Wohlen dazu. Es gab hochtrabende Pläne, den Schienen- mit dem Flusstransport zu koppeln: Im Brugger Auschachen sollte ein grossartiges Hafenareal entstehen, die einheimischen Gewässer sollten von Basel bis zum Bodensee und bis Brugg für Lastkähne schiffbar gemacht werden.
Der Erste Weltkrieg, die Spanische Grippe und der Landesstreik von 1918 bremsten diese ungestüme Entwicklung abrupt. Die Kehrseiten der Industrialisierung traten zutage. Obwohl die Schweiz glücklicherweise von den Feindseligkeiten des Ersten Weltkriegs verschont blieb, brachen die sozialen Spannungen, die (allzu) lange unter den Teppich gekehrt worden waren, mit grosser Wucht los. Es kam zum Landesstreik vom November 1918, der in Brugg als Industrie- und Eisenbahnzentrum befolgt wurde, auch wenn es – wie im übrigen Aargau – zu keinen grösseren Zwischenfällen kam. Obwohl zumindest in seinen kurzfristigen Zielsetzungen erfolglos, löste der Landesstreik eine starke Gegenreaktion auf bürgerlicher Seite aus. Einer ihrer Anführer, der umstrittene Aarauer Arzt und Oberst Eugen Bircher, berief für den 24. November 1918 eine gesamtschweizerische Tagung ins Windischer Amphitheater ein, um gegen die Sozialdemokratie, den Landesstreik und die – wie man meinte – drohende Revolution zu demonstrieren. Dieser «Vindonissa-Tag» brachte Delegationen aus der ganzen Schweiz nach Windisch. Auf Vorschlag von Bircher und seinen Kreisen entstanden im ganzen Kanton Bürgerwehren, wobei Brugg das grösste Kontingent stellte. Der Bundesrat tolerierte die Aufstellung solcher Bürgerwehren, und im Sommer 1919 beschloss sogar die Aargauer Regierung, diese bei Bedarf zu bewaffnen. Man erwartete einen Bürgerkrieg nach russischem Muster. 1920/21 kam es in der Brugger Firma Müller AG zu einem vierteljährigen Streik, bei dem mitunter zwischen Streikbrechern und Arbeitswilligen auch die Fäuste flogen. Die Polizei musste eingreifen. Dazu kam die grosse Grippewelle von 1918/19, die die Lage weiter verschärfte. Die Aargauer Regierung erliess ein Versammlungsverbot, das bis 1920 in Kraft blieb und das öffentliche Leben stark einschränkte.
Erst in den frühen 1920er-Jahren kam es zu einer gewissen Normalisierung. Viele der Entwicklungen, die mit dem Krieg zum Stillstand gekommen waren, gingen nun weiter, aber in einem gemächlicheren Tempo. Windisch erlebte einen Bauboom, in dessen Verlauf die noch bestehenden Siedlungslücken zwischen dem alten Dorfkern und Oberburg ausgefüllt und die Gebiete von Klosterzelg und Rütenen weiter überbaut wurden. Auch im Dohlenzelgquartier und im vorderen Kirchenfeld entstanden erste Häuser. Dennoch blieb Windisch in vielerlei Hinsicht ländlich. Viele Arbeiter, die in Brugg in Fabriken ihren Lohn verdienten, hatten noch einen kleinen landwirtschaftlichen Nebenerwerb – sie hielten sich ein paar Kaninchen, vielleicht sogar ein Schwein in einem Schopf, im Garten wurden Gemüse und Früchte gezogen. Auf der Wiese, wo später die Fachhochschule zu stehen kam, weideten die Kühe des Bauernbetriebs der psychiatrischen Anstalt Königsfelden, und auch das Amphitheater wurde landwirtschaftlich genutzt.
Читать дальше