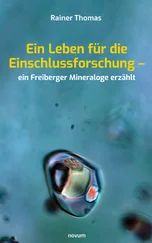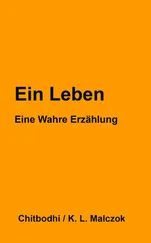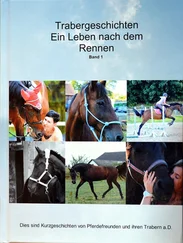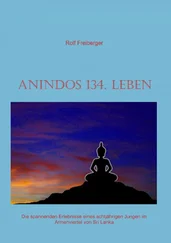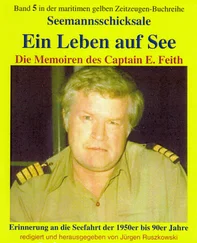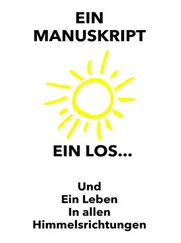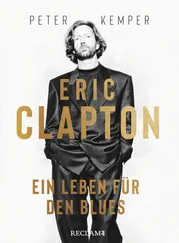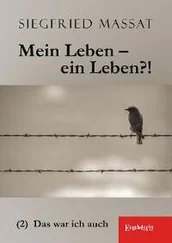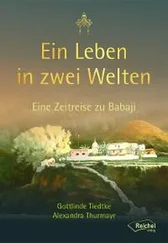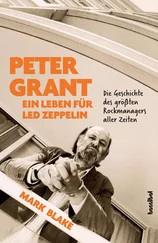1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 Auch in der Bezirksschule war Margrit eine strebsame Schülerin. Ihre Fleissnoten waren entweder gleich gut wie ihre Leistungsnote oder sogar besser. Die besten Noten erhielt sie von Anfang an im Singen, da schwankten die Bewertungen immer zwischen einer 1 und einer 2, wobei in jener Zeit die 1 die beste und die 5 die schwächste Note war. Auch im Religionsunterricht, den sie allerdings erst ab der dritten Klasse besuchte, glänzte sie mit der Bestnote. Bei den Sprachen findet sich oft eine 2 oder eine 2–3, bei den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern lagen die Noten unter diesen Werten. Insgesamt war Margrit keine brillante, aber auch keine schlechte Schülerin – sie lief im Gros der Klasse mit.
Ein Foto aus dieser Zeit zeigt Margrit in einem Zimmer des alten Hallwyler Schulhauses als ein aufgewecktes Mädchen mit freundlichem, wenn auch etwas scheuem Lächeln. Sie sitzt in einem der vordersten Bänke, die Hände liegen brav gefaltet auf dem Pult. Auf einem anderen, früheren Bild vom Jugendfest 1929 – dem ersten Rutenzug nach ihrem Übertritt an die Bezirksschule Brugg – guckt sie ernst in die Linse, mit hoch gezogenen Schultern und verkniffenem Mund – ganz im Gegensatz zu einigen ihrer Schulkameradinnen, die wesentlich gelassener, wenn nicht lässig für die Kamera posieren.
Immer im Februar fand in der Turnhalle Schützenmatt in Brugg der Ball des städtischen Orchestervereins statt, zu dem die Bezirksschüler eingeladen waren; eine erste Gelegenheit, sich für das andere Geschlecht zu interessieren, etwa beim ersten gemeinsamen Tanz. Natürlich geschah das alles unter strenger Aufsicht der Lehrer, und um 22 Uhr war Schluss. Margrit hielt sich zurück. Sie suchte keine Bubenbekanntschaften. Hingegen versuchte sie, bei einer Schulaufführung des Stücks «Die wilden Schwäne» mitzumachen. Dies stand eigentlich nur den Schülerinnen und Schülern ab der dritten Klasse offen, doch wurde die Zweitklässlerin Margrit Fuchs zugelassen – vielleicht, weil sie gut singen konnte. Die Aufführung des Stücks erwirtschaftete den stolzen Erlös von 1352 Franken und 5 Rappen, der in die Kasse für die jährlichen Schulreisen floss. Diese waren für damalige Verhältnisse recht aufwendig: So reiste die Klasse IIc, in der Margrit war, am 1. Juli 1930 von Brugg nach Schindellegi, wanderte über den Etzel, stieg nach Pfäffikon (SZ) hinunter und liess sich per Schiff auf die Insel Ufenau bringen. In der vierten Klasse waren sogar zweitägige Reisen die Regel. Für viele Schülerinnen und Schüler waren solche Schulreisen eigentlich unerschwinglich, und immer wieder gab es welche, die nicht mitkonnten, weil es trotz Zustupf aus der Klassenkasse nicht reichte. Wie erwähnt: Der Besuch der Bezirksschule war eine kostspielige Angelegenheit. Ob Margrit an diesen Schulreisen auch teilnehmen konnte, oder ob sie zu Hause bleiben musste, lässt sich nicht feststellen. Die Ferien verbrachte sie wenigstens zum Teil bei ihrer Tante mütterlicherseits, Maria Josefa, in Stein am Rhein, wo diese zusammen mit ihrem Mann ein Restaurant führte.
Zeitweise gab es vier Gertruden in der Mädchenklasse von Margrit. Der Klassengeist war gut. Gemeinsam beschwerte man sich einmal beim Rektor über die Deutsch- und Geschichtslehrerin, die einen eher rüden Umgangston pflegte – sie sprach zum Beispiel die Mädchen nur mit Nachnamen an –, einzelne Schülerinnen immer wieder hänselte und öffentlich demütigte und überhaupt als ziemlich parteiisch galt. Eine solche Aktion war in einer Zeit, in der in der Schule die Autorität der Lehrer noch sehr hochgehalten wurde, aussergewöhnlich und erforderte einigen Mut. Andere Lehrer dagegen waren Opfer von Streichen und bekamen – meist harmlose – Übernamen zugeteilt. Der Französischlehrer etwa wurde wegen seiner markanten Nase, die an einen Vogelschnabel erinnerte, als «Spatz» veräppelt. 1931 traf die Klasse eine Tragödie, als eine Kameradin starb.
Margrit schloss die Bezirksschule im Frühjahr 1933 ab. Es war eine schwierige Zeit: Die Weltwirtschaftskrise traf die Schweiz wie andere europäische Länder mit grosser Härte. Bei den regelmässigen Elternzusammenkünften der Bezirksschule war die Berufswahl ein wichtiges Thema. Im Frühling 1934 reiste Margrit dann für ein knappes Jahr nach Belgien und setzte ihre Ausbildung fort, und zwar am Ursulinenpensionat im belgischen Vilvoorde. Ob das Zwischenjahr von Anfang an so geplant war oder ob es die Konsequenz einer vergeblichen Stellensuche war, lässt sich nicht schlüssig rekonstruieren. Dass sie diese weitere Ausbildung in Angriff nahm, passt aber dazu, dass die Mutter grossen Wert auf eine gute Ausbildung ihrer Töchter legte. Sprachaufenthalte für Mädchen nach der Schulentlassung waren in städtischen Bevölkerungsschichten zwar keine Seltenheit, wenn auch dieser Sprachaufenthalt zur Erlernung und Verbesserung des Französischen vorwiegend in der Welschschweiz und nicht im Ausland absolviert wurde. Allerdings war Belgien damals ein beliebtes Ziel; in der Erinnerung meiner Mutter begaben sich in den 1930er-Jahren mehrere Mädchen aus Brugg und Umgebung dorthin. In ihrem ersten Brief aus Vilvoorde berichtet Margrit denn auch davon, dass sie ab Basel mit einer ganzen Gruppe von Schweizer Mädchen nach Brüssel gereist sei. Der Vorteil der Ursulinen lag darin, dass sie dem unentgeltlichen Mädchenunterricht verpflichtet waren. Trotzdem: Es wird wohl nicht so selbstverständlich gewesen sein, dass eine Bähnlertochter aus Windisch zur Ausbildung ins ferne Belgien reiste. Angesichts der engen Bindung an die Mutter und die Schwestern war zudem die Trennung wohl auch nicht einfach. Andererseits hatte Margrit hier zum ersten Mal Gelegenheit, den «Duft der grossen, weiten Welt» zu schnuppern. Das war nicht ohne Auswirkungen auf die spätere Ruanda-Auswanderin.
Das Ursulinenkloster im belgischen Vilvoorde nahe Brüssel war 1858 gegründet worden und unterhielt ein angesehenes, auch international anerkanntes Mädcheninternat. Als Margrit in Vilvoorde eintraf, standen Institut und Kloster unter dem energischen Regime der 77-jährigen Mère Eleonore, die seit 1905 als Oberin tatkräftig wirkte. Die Hausordnung des Instituts liest sich sehr streng. Die Mädchen waren gehalten, gehorsam, respektvoll und fleissig zu sein. Es war untersagt, sich nur zu zweit zu unterhalten oder miteinander etwas zu unternehmen. Man wollte verhindern, dass sich Freundinnenpaare bildeten, was als dem Gemeinschaftsgeist abträglich angesehen wurde. Über weite Strecken des Tages war Stillschweigen zu wahren, so etwa beim Gang zur Messe oder während des gemeinschaftlichen Essens. Die Korrespondenz wurde kontrolliert, und Ausgang gab es nur am Sonntag, im Sommer von 9 bis 18 Uhr, im Winter eine Stunde kürzer.
Margrit polierte in Vilvoorde ihr Französisch auf und vervollständigte ihre kaufmännische Ausbildung. Diese als «technische Ausbildung» bezeichnete Unterrichtsform war im Institut sehr populär; Vilvoorde nahm in diesem Bereich unter den Ursulineneinrichtungen in Belgien einen vorderen Platz ein.
Der Briefverkehr zwischen Margrit, ihren Geschwistern und ihrer Mutter, der zum Teil erhalten ist, ist aufschlussreich. Er zeigt etwa das innige Verhältnis, das die Geschwister untereinander hatten, aber auch, dass es am Kapellenweg oft recht lustig zu- und hergegangen sein muss. So endet ein Brief der Mutter vom 1. Januar 1935 mit Grüssen der Schwestern, die sich gegenseitig aufziehen: Anna schreibt, sie habe keine Neuigkeiten, und schliesst dann einen Gruss von «Idda» an, welche das Kuvert anschreibe, und von «Lisely», die bereits ins Bett gegangen sei. Worauf Ida interveniert und mit Bleistift darunter kritzelt: «nein auf der Schäselonge [Chaiselongue]», was Anna aber nicht auf sich sitzen lässt und, da der Platz auf dem Papier immer weniger wird, in zunehmend kleinerer Schrift hinzufügt: «nein auf der Ottomane!» Und eine weitere, nicht identifizierte Handschrift verlängert am Blattrand: «Wir sitzen so fröhlich beisammen wenn Du hier wärest, wären es fünf.» In den Briefen ist Margrits Schalk und Witz allgegenwärtig. Im ersten Brief schildert sie, dass sie im Zug nach Brüssel im Gepäcknetz geschlafen habe: «Das war ein bequemes Schlafen.» Und in einem späteren Brief an Ida bittet sie darin, dass die Mutter ihr Gedichte schicke: «Sage an Mutter ob sie nicht so gut sein wolle und mir die zwei Gedichte die ich auf dem Gubel (wohl anlässlich der ewigen Profess der Cousine Bertha Mettauer) aufgesagt einmal in einen Brief tun wolle.» Und sie fügt augenzwinkernd hinzu: «aber Achtung dass er nicht zu schwer ist». Der Schriftwechsel mit der Mutter ist so liebe- wie respektvoll.
Читать дальше