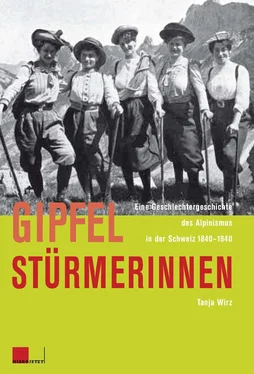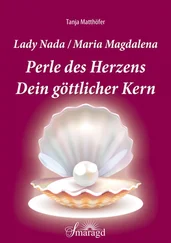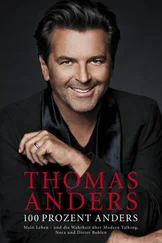Was Rambert beschrieb, ist im Grunde nichts anderes als das, was der französische Historiker Pierre Nora einen lieu de mémoire, einen Gedächtnisort, nennt: ein Denkmal oder Ort, der das Gedächtnis der Nation verkörpert und der aufgesucht wird, um die Nation zu erfahren und zu verinnerlichen. 23Wie viele glaubte Rambert, der Überblick schaffende «imperiale Blick» vom Gipfel herab erzeuge patriotische Gefühle. Allerdings war ihm dieser Blick dann doch zu deutungsoffen. Er meinte, noch besser geeignet, um diese Erfahrung des Überblicks zu vermitteln, seien Landkarten; darauf sei besser sichtbar, dass die Schweiz ein «ensemble» sei. 24Er forderte deshalb, zur staatsbürgerlichen Erziehung seien sämtliche Schulen mit einer Landkarte der Schweiz auszustatten, und zwar mit einer, welche die Schweiz auf einem einzigen Blatt und nicht etwa auf mehreren Blättern zeige. 25Seine Anregung zeigt deutlich, dass Landkarten weit mehr sind als Hilfsmittel zur Orientierung im Gelände: Es handelt sich auch um Bildungsinstrumente, um «Texte» mit staatsbürgerlicher Moral, die da lautet: Empfinde Patriotismus beim Anblick des unter dir liegenden Bildes der Landschaft.
DIE BERGWANDERUNG ALS ZEITREISE UND GESCHICHTSLEKTION
Pierre Nora hat sich unter Gedächtnisorten etwas vorgestellt, was extra zum Zweck nationaler Identitätsbildung eingerichtet wurde, und weniger etwas, was wie die Berge erst im Nachhinein mit Bedeutung aufgeladen wurde. 26Andere halten dieses Konzept für zu eingeschränkt. Der Ägyptologe Jan Assmann stellt unter dem Begriff «Mnemotop» oder Erinnerungslandschaft ein weiter gefasstes Konzept vor, das die Möglichkeit umfasst, auch die vorhandene materielle Umwelt so zu verwenden: «Sogar und gerade ganze Landschaften können als Medium des kulturellen Gedächtnisses dienen. Sie werden dann weniger durch Zeichen (‹Denkmäler›) akzentuiert, als vielmehr als Ganze in den Rang eines Zeichens erhoben, d. h. semiotisiert.» 27Als bekanntestes Beispiel verweist er auf die totemic landscapes der australischen Aborigines. In meiner Arbeit verwende ich im Folgenden diesen breiteren Begriff, da sich die zum nationalen Symbol erklärten Alpen sehr gut als Erinnerungslandschaft analysieren lassen. Gemeinsam ist den Modellen von Nora und Assmann die Betonung des Handelns: Die Identifikation mit der gemeinsamen Kultur findet via Aufsuchen und Erleben dieser Orte statt.
Extra erbaute Gedächtnisorte im Sinn Noras stiessen in der Schweiz übrigens auf wenig Interesse. Vielmehr war es typisch, die Landschaft als Erinnerungsort zu nutzen und dabei Natur und Geschichte zur Legitimation der modernen Nation in eins zu setzen. 28Aufklärerisch motivierte Autoren im Gefolge Rousseaus priesen Bergreisen unter dem Motto «Zurück zur Natur!» an und vermeinten, so gleichsam eine Zeitreise in die eigene Geschichte unternehmen zu können. 29Je weiter nach oben man steige, so die gängige Ansicht, desto tiefer in die Vergangenheit dringe man. 1864 schrieb ein Schweizer Alpinist im Jahrbuch des SAC:
«So betritt unser Fuss in Wirklichkeit bei unseren Alpenwanderungen den Schauplatz früherer Generationen, die in den Ebenen längst unter dem Gerölle der Gegenwart, das auch uns aufnehmen wird, begraben liegen; ja, man darf sagen, dass wir in um so tiefere Schichten der Vergangenheit dringen, je höher wir uns nach den Zinnen dieser Zufluchtsstätte schwindelnder Höhe erheben. Rührt wohl daher das wonnige Gefühl, als ob wir in eine alte Heimat träten […]? Man möchte es glauben.» 30
Eine Bergtour sei nichts anderes als der feierliche, rituelle Besuch eines Denkmals der Heimat. Die Alpen wurden also als quasi natürlich gewachsenes Nationalmonument betrachtet und bevorzugt. Dennoch mangelte es nicht an Vorschlägen für eigentliche Denkmäler der Nation: In den 1890er-Jahren entwarf der Bildhauer Auguste de Niederhäusern-Rodo (1863–1913) das Modell eines riesigen «Nationaltempels», ein Projekt, das er «Poème Alpèstere» nannte. Es handelte sich dabei um eine in die Felswand des Jungfraumassives gehauene Halle, die für das Abhalten von nationalen Feiern gedacht gewesen wäre und über 100 000 Personen Platz geboten hätte. Der Bildhauer sah sein Werk als ein Denkmal «vaterländischen Geistes» und wollte damit die «Erhabenheit der schweizerischen Freiheit» feiern. Neben zwei gigantischen Statuen von 40 Metern Höhe am Eingang der Halle sollten vier allegorische Figuren gezeigt werden, die die Naturgewalten der Berge verkörperten: Föhn, Steinschlag, Wildbach und Lawine. Den Wildbach und die Lawine führte Niederhäusern schliesslich in menschlicher Grösse aus, und die beiden Figuren wurden 1896 an der schweizerischen Landesausstellung in Genf gezeigt, wo sie viel Aufsehen erregten. Die Lawine sei eine «wildbewegte, nackte Bergfurie» gewesen, die mit dem Fuss eine Schneekugel talwärts stösst. Die Festhalle selbst wurde jedoch nie ausgeführt. 31Und auch andernorts scheiterten vergleichbare Projekte, zum Beispiel auf dem Rütli, wo der legendäre Treueschwur der ersten drei Eidgenossen stattgefunden haben soll. Im 19. Jahrhundert gab es immer wieder Vorschläge, dort ein Denkmal zu errichten. Die Projekte wurden jedoch abgelehnt mit dem Hinweis, die Berge seien die besseren Monumente der Freiheit als ein von Menschen gebautes Denkmal. Das Rütli sollte möglichst «ursprünglich» bleiben. 32
Nur an den Landesausstellungen wurden mit schöner Regelmässigkeit Pappberge aufgebaut, so etwa 1896 in Genf: Das Village Suisse – ein zentraler Teil der Ausstellung – präsentierte sich mit einem Kartonberg mit künstlichem Wasserfall und diente als Durchführungsort für patriotische Anlässe. 33Dass gleich daneben ein «authentischer afrikanischer Stamm» in Lehm- und Strohhütten ausgestellt war, belegt, wie sehr es dabei um Identitätskonstruktion ging: Die Schweizer inszenierten sich in ihrem alpinen Idealdorf in Absetzung von den Afrikanern gleichsam als «alpine Rasse» – ein Mythos, den die Konservativen und Rechten in der Schweiz damals gerne pflegten, und ein Versuch, die schweizerische Nation doch noch via die damals sehr populäre Vorstellung einer gemeinsamen «Rasse» zu legitimieren. 34
EIN VOLK DER HIRTEN UND BERGSTEIGER?
In Darwins Evolutionstheorie, auf der die Rassentheorie unter anderem aufbaute, spielte die natürliche Umwelt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Arten: Nur wer in eine gegebene Umwelt passte, konnte im Überlebenskampf bestehen – survival of the fittest. 35Gemäss dieser Theorie brachte jede Umwelt die zu ihr passenden Arten hervor; sozialdarwinistisch gewendet, entstand in jedem Land aufgrund der natürlichen geografischen und klimatischen Gegebenheiten angeblich das passende Volk. 36Um 1900 gab es in der Schweiz zahlreiche Versuche, eine «Alpenrasse» zu definieren, und schliesslich sogar die Forderung, eine solche zu züchten. 37Das wäre zwar eigentlich nur konsequent gewesen, denn schliesslich gibt es im ganzen Tierreich ohne Züchtung keine Rassen, doch glücklicherweise ging in der Schweiz niemand ganz so weit. Immerhin führten diese Ideen dazu, dass das Rassenhygienische Institut der Universität Zürich in den 1940er-Jahren durch die Vermessung von Rekruten versuchte, den «Rassentyp» des homo alpinus helveticus dingfest zu machen – allerdings erfolglos. 38Hallers arkadische Utopie einer aus karger Landschaft «gewachsenen» Idealgesellschaft erhielt mit diesen Theorien eine «naturwissenschaftliche» Begründung.
Im 19. Jahrhundert erklärte somit eine intellektuelle Elite die Schweiz zum Alpenland, die Schweizer zu einem Volk der Hirten und Bergsteiger. Diese Vorstellung war so erfolgreich, dass Schweizer begannen, Berge als notwendige Voraussetzung zu sehen, um sich an einem Ort heimisch zu fühlen, auch wenn sie selbst aus dem Mittelland und der Stadt stammten. Dies zeigt etwa der Reisebericht, den der Zürcher Handelsschullehrer Carl Täuber 1926 verfasste. Täuber war SAC-Mitglied und bereiste zwischen 1923 und 1925 in halboffiziellem Auftrag Südamerika, um dort die wirtschaftlichen Möglichkeiten für schweizerische Auswanderer abzuklären. 39In Argentinien, Paraguay, Uruguay, Chile, Peru und Brasilien besuchte er zahlreiche ausgewanderte Schweizer und kam zum Schluss, diesen gehe es zum Teil sehr schlecht; das Heimatland solle sie besser unterstützen, etwa durch Stellenvermittlung und vermehrte vorgängige Aufklärung über das Auswanderungsland. Selbst wusste er jedoch über die fremde Kultur ausser Anekdoten über dreckige Hotelzimmer herzlich wenig zu berichten, und in der Kolonisation sah er eine Chance zum Fortschritt für die betreffenden, seiner Ansicht nach rückständigen Länder. In Buenos Aires besuchte Täuber auch wohlhabende Schweizer, deren Landgüter er bewunderte. Allerdings beklagten sie sich, Buenos Aires biete ihnen nichts. Täuber schrieb, sie sehnten sich «b». 40
Читать дальше