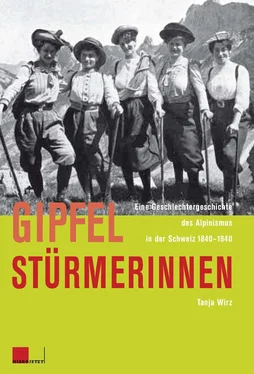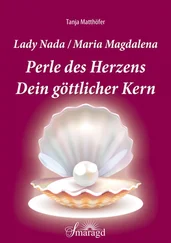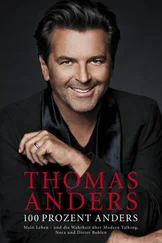Nicht alle unmittelbar notierten Erlebnisse taugten zur Veröffentlichung, dies zeigte bereits Angevilles Beispiel. Sie selbst bevorzugte jene Geschichten, die sie als autonome Heldin erscheinen liessen, und liess jene weg, die sie als widersprüchlichere, stärker in soziale Netze eingebundene Person zeigten. Das bedeutet aber keineswegs, dass diese für «offizielle» Bergtourenberichte als unpassend erachteten Passagen für die Schreibenden unwichtig gewesen wären. Dazu nochmals ein Beispiel aus Eugen Wenzels Fahrtenbuch, in dem sich auch sehr private Erinnerungen finden: Am 6. April 1923 klagte Wenzel über seine Melancholie: «Spaziergänge. Ich kann nicht sagen, was mir fehlt. Die Energie ist mir fast abhanden gekommen. Man hat gar keinen Mut mehr, etwas Grösseres anzupacken. Noch habe ich keinen ganztägigen Ausflug gemacht. Es langt immer nur zu halbtägigen Spaziergängen in der Umgebung der Stadt.» 273Doch schon bald darauf ging es wieder aufwärts mit ihm, denn auf einer Tour auf den Gletscherducan bei Monstein lernte er seine zukünftige Frau kennen: «Ich beschliesse, auf den Gipfel zu steigen u. auf meine Frage, wer mitmacht, meldet sich ein gewisses Frl. Rösli Hofer, die ich zum 1ten Male sehe. Wir seilen uns an und gehen hinauf. Frl. Rösli geht sehr gut und macht einen feinen Eindruck auf mich.» 274Es blieb nicht dabei, sondern: «Am Samstagmorgen fasse ich urplötzlich den Entschluss, eine Winterbesteigung des Tinzenhorns zu versuchen. Leider fehlt es mir an einem Kameraden und so gehe ich am Mittag auf die Suche. Beim Guggenloch treffe ich Frl. Rösli wie durch ein Wunder u. sie will mitmachen.» 275Schon eine Woche später war aus dem «Fräulein Rösli» das «Rösli» geworden, und eine weitere Woche später konstatierte Wenzel zufrieden: «Ich habe eine Bergfreundin, eine Berglerin gefunden. Rösli. Sie geht sehr gut u. ist ein flotter Kamerad. […] Mit Rösli am Berg zu wandern ist herrlich! Sie ist mir in kurzer Zeit ein ganz unentbehrlicher Freund geworden, sodass ich meine bisherigen fast etwas vernachlässige oder wenigstens in zweite Linie stelle.» 276Hätte er solche Passagen in der SAC-Zeitschrift veröffentlicht, wäre Wenzel das Unverständnis seiner Alpinistenkollegen gewiss gewesen.
***
Alle vier in diesem Kapitel vorgestellten Reisestile – die Pilgerfahrt, das ästhetische Landschaftserlebnis, die wissenschaftliche Expedition und die Suche nach der Idealgesellschaft in den Bergen – blieben bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wichtige Bestandteile der alpinistischen Praxis und des alpinistischen Diskurses. Durch die Verwendung dieser Stile sowohl bei der Gestaltung ihrer Bergfahrten wie auch in ihren Tourenberichten distinguierten sich Bergsteiger von Nichtbergsteigern und Einheimischen. Ein «richtiger Alpinist» war nur, wer die relevanten Stile kannte und Elemente aus dieser Palette verwendete. Seit spätestens 1800 war die Fähigkeit, die symbolische Praxis Bergsteigen «richtig» in Szene zu setzen, Teil des von der meist (bildungs)bürgerlichen Elite kontrollierten kulturellen Kapitals, das dazu genutzt werden konnte, die eigene Zugehörigkeit zu dieser herrschenden Gruppe zu bestätigen oder sie zu erlangen. Zu den vier hier vorgestellten Reisestilen kamen ab Mitte des 19. Jahrhunderts drei weitere hinzu, die in der Folge für das Bergsteigen mindestens ebenso wichtig wurden: das Bergsteigen als (symbolische) Eroberung von Territorium, als Schule der Männlichkeit und schliesslich zur Ertüchtigung von individuellem Körper und «Volkskörper». Diese Reisestile werde ich in den Kapiteln zwei bis vier ausführlicher behandeln.
WANDERN IM NATIONALMONUMENT

7 «Eine Alpenspitze.» Illustration von 1861.
Die Alpen und vor allem das Hochgebirge wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gerne dazu genutzt, um zentrale Vorstellungen der damaligen Gesellschaft als «natürlich» erscheinen zu lassen: zum einen die Nation, zum andern die Idee, einer jeweils besonders überlebenstüchtigen nationalen «Volksgemeinschaft» anzugehören, die ihre Tugenden dem Überlebenskampf in der «freien Wildbahn» verdankte. Schweizer Autoren machten damals aus den Alpen ein nationales Monument; dies zeige ich im ersten Teil dieses Kapitels. Zur selben Zeit besuchten immer mehr ausländische Touristen das Gebirge. Nach einem kurzen Überblick über die Entwicklung der touristischen Infrastruktur in den Alpen untersuche ich im zweiten Teil dieses Kapitels das Beispiel zweier englischer Alpinisten, die das Bergsteigen gewissermassen als imperialistische Tätigkeit betrieben. Und schliesslich zeige ich im dritten Teil, wie der SAC versuchte, sich die nationale Erinnerungslandschaft Alpen anzueignen und zu kontrollieren, und lege am Beispiel der Jugendgruppen der Alpenclubs dar, wie Bergsteigen Anfang des 20. Jahrhunderts als Technik zur Erzeugung nationalistischer Gefühle in Mode kam.
DIE ALPEN ALS ERINNERUNGSLANDSCHAFT DER SCHWEIZ
Die Dichter und Philosophen der Aufklärung hatten die Alpen als Bühnenbild genutzt, auf das sie ihre gesellschaftspolitischen Utopien imaginieren konnten. Für diese in ganz Europa verbreiteten Fantasien waren die Alpen bloss ein weiterer exotischer Ort neben dem Orient, der Südsee und Amerika, eine Gegend, die man nicht so genau kannte und wo man deshalb alles Gute und Ideale vermuten konnte. Diese alpine Bilderwelt der Aufklärer nutzten die Schweizer bei der Gründung des Bundesstaates 1848 zur Legitimierung des neuen Nationalstaates. 1Durchaus erfolgreich: In den Jahren 1870 bis 1940 wurde es zum Allgemeinplatz, dass die Schweiz mit all ihren Merkmalen geradezu zwangsläufig aus der alpinen Landschaft hervorgegangen sei; Demokratie, Freiheit, Unabhängigkeit und was der schweizerischen Ideale mehr sind, waren demnach in den engen Bergtälern gleichsam gewachsen. 2Der Soziologe Oliver Zimmer bezeichnet diese Vorstellung, eine Nation sei wie eine Pflanzengattung oder Tierart gewissermassen evolutionär von ihrer natürlichen Umwelt geprägt, als «Naturalisierung der Nation», im Anschluss an Mary Douglas’ These, dass im Entstehen begriffene und daher noch fragile Institutionen – wie etwa eine neue Nation – durch die Analogie zur natürlichen Welt zusätzliche Legitimation erhalten und für selbstverständlich erklärt werden: Die Technik der Naturalisierung verdeckt, dass die betreffende Institution menschengemacht ist und schützt sie vor Veränderungswünschen und Kritik. 3
Die enge Verknüpfung des schweizerischen Staates mit den Alpen ist bis heute weit verbreitet. Noch im Standardwerk «Geschichte der Schweiz und der Schweizer» ist sie zu finden, 4und auch im öffentlichen Bewusstsein werden zahlreiche Geschichten tradiert, in denen die Berge als «natürliche» Geburtsstätte aller als schweizerisch gesehenen Eigenschaften und Dinge fungieren: So heisst es etwa, an manchen Frühlingsabenden sei auf der Jungfrau-Nordwand ein von Sonnenstrahlen und Schatten erzeugtes Kreuz zu sehen, und dies sei der Grund, weshalb die Schweizer Flagge von einem Kreuz geziert wird. 5Das Schweizerkreuz wird durch die Verbindung mit einer physikalischen Lichterscheinung überhöht und legitimiert, und es geht vergessen, dass Schweizerinnen und Schweizer möglicherweise besonders gerne überall Kreuze sehen und diese für bedeutungsvoll halten.
Dieser Geodeterminismus, der die Alpen zum Ursprung jeglicher schweizerischen Identität macht, hatte zur Zeit seiner Entstehung um 1848 neben der romantischen Verpackung zusätzlich einige handfeste Vorteile: Auf politischer Ebene ermöglichte diese Theorie, die im Sonderbundskrieg von 1847 unterlegenen Innerschweizer (Berg-)Kantone in die neue Nation einzubinden, indem man ihnen den Ehrenplatz der «Geburtsstätte» der Schweiz zugestand. 6Und auch aus wirtschaftlicher Sicht war es angesichts des zunehmenden Fremdenverkehrs durchaus sinnvoll, das eigene Land den touristischen Erwartungen gemäss zum Bergparadies zu stilisieren. Und schliesslich liess sich der neue Nationalstaat mittels Alpen besonders gut popularisieren, waren die Berge doch nicht bloss ein sicht bares, sondern auch ein erleb bares Symbol der Nation.
Читать дальше