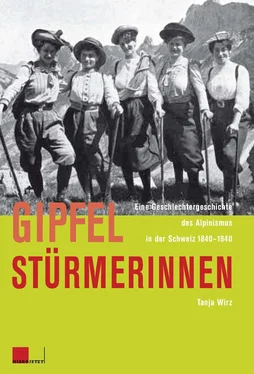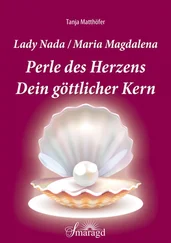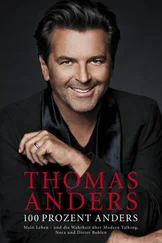FAHRTENBÜCHER: «ES MUSS MATERIAL FÜR GLORREICHE ERINNERUNGEN GESAMMELT WERDEN!»
Ein publizierter Tourenbericht war Bedingung, um als Erstbesteigerin oder Erstbesteiger anerkannt zu werden. Über die eigenen Unternehmungen zu schreiben, war für die meisten Bergsteiger aber auch bei weniger spektakulären Touren wichtig, und so machten viele von ihnen umfangreiche private Aufzeichnungen in Form von Reisetagebüchern beziehungsweise «Fahrtenbüchern», wie es in Bergsteigerkreisen hiess. Ein aufschlussreiches Beispiel einer solchen Dokumentation befindet sich im Besitz des Schweizerischen Alpinen Museums. Es handelt sich dabei um die 17 handschriftlichen Fahrtenbücher des Berner SAC-Mitglieds Paul Montadon (1858–1948) aus den Jahren 1874 bis 1940. 263Montadon war einer der schweizerischen Pioniere des führerlosen Bergsteigens, und das Klettern war ihm wichtiger als sein Beruf als Bankier – zumindest tönt es im von ihm selbst für die SAC-Zeitschrift verfassten Nachruf so. 264Der umtriebige Alpinist dokumentierte seine Touren in nahezu manischer Genauigkeit auf über 5700 eng beschriebenen Seiten. Zusätzlich führte er verschiedene Listen über «Biwaks, freiwillige» und «Biwaks, unfreiwillig», über Touren zusammen mit seiner Frau und über «Solo-Besteigungen», also Alleingänge. 265Seine Berichte sind in launigem, anekdotenreichem Stil gehalten, als schriebe er für die Zeitschrift einer Studentenverbindung, und so finden sich neben der Dokumentation der eigenen Leistungen auch Berichte darüber, wie er und seine Gefährten dem Bier zusprachen und mit Reisebekanntschaften anbandelten, etwa 1889:
«[…] die anziehenden Touristinnen, mit denen wir uns hernach im Gotthardzug zusammenfanden, verdüsterten unsere Stimmung keineswegs. Funer’s übermenschliche Anstrengungen, sich unwiderstehlich oder doch wenigstens interessant zu machen, indem er Kravatte und Kragen entfernte und eine alte Pfeife zwischen die Zähne steckte, hatten höchstens einen Lacherfolg, und in Brunnen verliessen uns unsere Vis-à-vis, ohne dass es uns schien, als ob ihnen die Trennung sonderlichen Schmerz verursacht hätte. Bergsteiger haben mit mannigfachen Schwierigkeiten zu kämpfen, und auch wir überwanden die Versuchung, die Windgälle aufzugeben und den die Französinnen begleitenden älteren Herrn um Erlaubnis anzugehen, uns ihrer Partie anzuschliessen.» 266
Durch die Beschreibung der gemeinsamen Erlebnisse bestätigte Montadon seine Zugehörigkeit zur lustigen Männerclique auf grosser Fahrt und festigte seine Identität als Alpinist, der zwar einem Spass nicht abgeneigt war, aber das höhere Ziel stets im Auge behielt. Er schrieb dabei weniger über allgemeine Ziele des Alpinismus, sondern nutzte die vom alpinistischen Diskurs vorgegebenen Vorstellungen zur privaten Selbstdarstellung. Tagebücher sind ein Mittel zum Erschreiben einer eigenen Identität, denn diese beruht neben der Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen zu einem Gutteil auf autobiografischen Erinnerungen. Das war auch vielen Bergsteigern bewusst: Henriette d’Angeville beispielsweise schrieb in ihrem Tagebuch, die geplante Tour auf den Montblanc sei «un immense souvenir à se créer dans la vie», und die deutsche Bergsteigerin Hermine Tauscher-Geduly meinte 1881 im Bericht über eine Tour auf den Piz Bernina: «Vorwärts denn! Es muss ja Material für neue glorreiche Erinnerungen gesammelt werden.» 267Es handelte sich bei diesen Unternehmungen also nachgerade um die gezielte Produktion wünschenswerter Erinnerungen und damit um eine bewusste Technik der Selbstinszenierung: ein Beleg dafür, wie wichtig Ferien und Freizeit – also das Ausbrechen aus dem Alltag – für die Identitätsbildung moderner Menschen war und ist: Ausserhalb der Zwänge des täglichen Lebens und Überlebens kann ausgewählt werden, an was man sich später erinnern kann, welche Identität man sich selbst er-leben will.
Auch im Fahrtenbuch eines weiteren Alpinisten findet sich die Erklärung, dass die Aufzeichnungen der späteren Erinnerung dienen sollten: Der Schneider und Buchhalter Eugen Wenzel (†1989), ebenfalls SAC-Mitglied, führte von 1920 bis 1984 Fahrtenbücher. Im ersten Heft erklärte er einleitend: «Dem Zwecke späterer Erinnerung zeichne ich hier in diesem Buche alle meine Wanderungen auf. Ich fange zwar etwas spät damit an, denn ich habe bis heute schon unzählige Touren unternommen, sei es mit der Schule, der Familie oder allein.» 268Es folgt eine nahezu endlose Aufzählung aller Spaziergänge, Ausflüge und Wanderungen, an die Wenzel sich noch erinnern konnte, und diese Liste nutzte er sogleich zur kritischen Reflexion seiner Leistungen. «Ich weiss schon, dass ich im Verhältnis sehr wenige Berge bestiegen habe, wenn man die Mannigfaltigkeit der Bündner Berge kennt», vermerkte er bescheiden: «Ich glaube aber, dazu noch genug Zeit zu haben in der Zukunft.» 269Wenzel folgte damit, zusammen mit vielen anderen Alpinisten, der protestantischen Tradition der Tagebuchführung: Durch die Aufzeichnung sämtlicher Leistungen und Verfehlungen sollte systematisch der eigene Gnadenstand kontrolliert werden, zum Zweck der Selbsterkenntnis und stetigen Verbesserung. 270
Die Fahrtenbücher stehen daneben allerdings auch in der Tradition der wissenschaftlichen Forschungsreise, auf der noch vor Ort möglichst präzise alle wichtigen Beobachtungen und Vorkommnisse notiert werden sollten. Anders als Montadon hielt Wenzel sich eher knapp und imitierte in seinen Texten den Stil eines Logbuches oder Forschungsjournals. So lautet sein Eintrag zu einer Tour im Juli 1920:
«Schwarzhorn. Auf meine Anregung hin machen wir uns zu 4. am Samstag um 9 Uhr auf die Beine und sind um 12.15 am Flüela Hospiz. Teilnehmer sind Westermann, Lecrupte, Hugi und ich. Extra zu nennen ist ‹Nick›, der Hund Westermanns. Obschon wir nach Abmachung zum Sonnenaufgang hinauf wollten, bleiben wir auf dem Stroh über Nacht. Lustige Szenen mit Nick. 6 Uhr Aufstieg. Über Schnee bis zum Gipfel woselb. wir um 9 Uhr waren. Herrl. Fernsicht und überaus klares Wetter. Abgekocht. 1 Uhr Abstieg. Hugi und ich nach Grischna, die anderen nach Flüela. 6 ½ Uhr zu Hause. Besonders zu bemerken ist, dass ich nie wieder ohne Schneebrille eine Tour mache. Im übrig. hat mich das Gewaltige des Piz Kesch gereizt und der Beschluss zu dessen Besteigung ist in mir ganz gereift. Glück auf!» 271
Wenzel bediente sich einer stark typisierten Sprache und deutete Erlebnisse nur an, ohne sie wirklich zu erzählen. Offenbar ging er davon aus, dass er sich bei einer allfälligen späteren Lektüre dann schon noch würde erinnern können, wie die «lustige Szene» mit dem Hund verlaufen war oder was ihm die «herrl. Fernsicht» offenbart hatte. Andernorts hielt er über eine Tour auf den Piz Kesch im Jahr 1920 fest: «Um 3 Uhr aufstehend und typisches Hüttenleben geniessend wird die Spannung immer grösser. Um 4 Abmarsch. Der Gletscher ist fein. Endlich also seh ich ihn, den Kesch, von allernächster Nähe. Ehrfurcht und Freude am Gewaltigen Machwerk der Natur füllen mich aus. Also hinaus! Ich hätte es mir nicht so leicht vorgestellt. Herrl. Aussicht aber leider keine allzu grosse Fernsicht. Jungfrau ist nur noch verschwommen.» 272Auch hier setzte er selbstverständlich voraus, dass bekannt ist, was unter «typischem Hüttenleben» zu verstehen war. Ich meine, dass die Verwendung solcher Formeln darauf hindeutet, wie stark sich Wenzel am bereits bestehenden alpinistischen Diskurs orientierte, um seine Erlebnisse darzustellen und zu deuten. Wie schon am Beispiel Angevilles gezeigt wurde, war relativ streng vorgegeben, wie eine typische Bergtour verlief und vor allem, wie sie dargestellt werden konnte. Beides bestätigt die Ritualhaftigkeit der Aktivität Bergsteigen: Es handelt sich dabei um einen mehr oder weniger vorgegebenen Erlebnisparcours, den es zu durchlaufen galt und gemäss dem unterwegs Erfahrungen gesucht wurden: Die akribische Planung der Tour entgegen allen Warnungen, der mühselige Aufstieg allen Hindernissen zum Trotz, die Euphorie auf dem Gipfel, die siegreiche Heimkehr.
Читать дальше