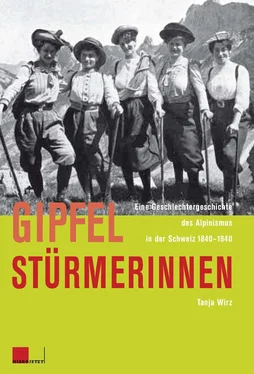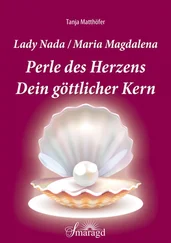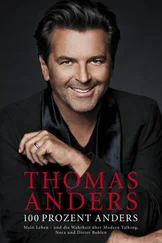Heute sind die Schriften von Dora d’Istria mehrheitlich vergessen, bloss ihr Reisebericht aus der Schweiz wird im alpinistischen Diskurs ab und zu als kuriose Anekdote über das belanglose Geplänkel einer gelangweilten Gräfin erwähnt. 234Ganz anders zu ihren Lebzeiten: Die Rumänin und ihre Bücher wurden damals in Europa stark beachtet. Als sie während der Niederschrift ihres Berichts neun Monate lang in einem Hotel in Lugano residierte, erschienen Textauszüge aus dem Buch in Tessiner und italienischen Zeitungen. Ihre dezidierte Stellung in religiös-politischen Fragen führte dazu, dass die katholischen Tessiner Ultramontanen gegen sie gerichtete Flugblätter verteilten, was wiederum die protestantisch-liberalen Kreise verärgerte und zu einer heftigen Kontroverse in der schweizerischen Presse führte. 235Ihr Reisebericht wurde schliesslich von zahlreichen europäischen Zeitschriften lobend besprochen: Man rühmte ihre umfassenden Kenntnisse und die gewissenhafte Erforschung des Landes. Die in Genf erscheinende «Bibliothèque universelle» schrieb, das Buch sei «das erste Werk, welches eine Übersicht von dem jetzigen Zustand der Eidgenossenschaft gibt». 236Dass Dora d’Istria ihre Reise als aufklärerische Suche nach einer politischen Utopie in den Alpen inszenierte, bemerkten auch ihre damaligen Rezensenten. So hiess es etwa in der «Revue des Deux Mondes»:
«Wenn die Frau Gräfin Dora d’Istria die deutsche Schweiz bereist, so ist es weniger, um herrliche Aussichten, grossartige Landschaften, erhabene und prächtige Anschauungen zu suchen, als um die Luft jener Berge und Seen einzuatmen, in welchen die religiöse und politische Unabhängigkeit entstand, um über die heldenmütigen Kämpfe zu sinnen, deren Erinnerung diese Täler und diese Schluchten belebt. Nicht die Schweiz sieht sie in der Schweiz, sondern ihr eigenes Vaterland, und wenn ihre Stimme die schweizerische Freiheit preist, so ruft ihr Herz nach der Freiheit der Rumänen.» 237
Die Gräfin war zu ihrer Zeit also eine renommierte Publizistin gewesen, und so erstaunt es doch etwas, dass sie im alpinistischen Diskurs später lediglich als extravagante Hochstaplerin präsentiert wurde. Wie konnte es dazu kommen? Den unter schweizerischen Alpinisten geltenden Wissensstand fasst der Historiker Quirinus Reichen zusammen, indem er schreibt, ihre Bergführer hätten die Gräfin, entgegen ihrem Wunsch und ohne dass sie es realisierte, auf einen unbedeutenden Nebengipfel des Mönchs geführt, um die hartnäckige Dame loszuwerden. 238
Dora d’Istrias eigener Bericht ist nach allen Regeln der Kunst verfasst und erinnert in vielem an Angevilles Text. Allerdings ist zu Beginn völlig unklar, um welchen Berg es eigentlich geht. Erst wer weiterliest, erfährt, dass die Gräfin eigentlich eine Tour auf die Jungfrau plante. 239Ähnlich wie Angeville berichtete Dora d’Istria, ihre Bekannten seien entsetzt gewesen und man habe ihr Vorhaben für gefährlich und für eine blosse «Laune» gehalten. 240Sogar die Natur schien sich gegen sie verschworen zu haben: Am Abend vor der Tour habe es sintflutartig zu regnen begonnen. Ein Fingerzeig des Himmels? Jedenfalls schrieb Dora d’Istria: «Ich erhob meine Seele zu Gott. In diesem Augenblick brach das Gewitter in seiner ganzen Macht aus; die Lawinen wiederhallten in den Bergen, und das Echo wiederholte tausendfach das Brausen des Falles. Die Sterne erbleichten am Himmel, als ich mein Fenster öffnete.» 241Die Schreckensgeschichten, mit denen man sie abzuhalten versuchte, weckten jedoch ihre Neugierde – und die der Leser – erwartungsgemäss erst recht. Ihre Bergführer seien zuerst wenig begeistert gewesen über den Auftrag, hätten wegen des schlechten Wetters von der Tour abgeraten und zweifelten an der Motivation ihrer Kundin: «Sie suchten in meinen Augen zu lesen, ob meine Festigkeit auch wahr sei. Endlich sagte Johannes Jaun […]: ‹Ich glaube, dass bei dem Mut dieser Dame die Reise unternommen werden kann. Ich habe viele Männer bei solchen Gelegenheiten viel stärker zittern sehen als sie.›» 242Und schliesslich hätten sich die vier nicht weniger mutig zeigen wollen als die fremde Dame. 243
Wie Angeville thematisierte auch Dora d’Istria die Kleider, die sie für die Bergtour wählte: schwarzweiss gestreifte Tuchhosen, eine bis zu den Knien reichende Jacke, ein runder Filzhut nach Art der Bergbewohner, ein Paar weite, grobe Stiefel, eine gefärbte Brille zum Schutz vor der Sonne, anders als ihre Bergführer aber kein Schleier. 244Sie beschrieb ihre Garderobe als Männerkleidung, die sie aber nicht unschicklich, sondern bloss ungewohnt kratzig fand. Am Abend vor der Tour übte sie das Gehen darin, denn: «[…] ich fürchtete, es möchten die Führer an mir verzweifeln, wenn sie mich bei jedem Schritt stolpern sähen. Ich war ziemlich gedemütigt. Nur triftige Gründe konnten mich verhindern, meine Frauenkleider wieder anzuziehen. Doch fiel mir ein Ausfluchtsmittel ein. Ich packte meinen Rock und meine Stiefelchen ein und gab sie einem Träger, um mich ihrer zu bedienen für den Fall, dass ich von diesen verdammten Kleidern, die ich so unbequem fand, in meinen Bewegungen allzu sehr gehindert würde.» 245
SIGHTSEEING IM REICH DES TODES
Am Sonntag, dem 10. Juni 1855, ging es los, mit vier Bergführern und vier Trägern, die Proviant, Leitern, Stricke und Haken transportierten. Dass es ausgerechnet an einem Sonntag sein musste, noch dazu bei nicht idealem Wetter, mag ebenfalls mit der politischen Haltung der Gräfin zusammenhängen: die Bergtour als weiterer Beweis dafür, dass die katholische Kirche den Fortschritt zur Aufklärung hin nicht aufhalten konnte. Den ersten Teil des Weges legte Dora d’Istria im Tragsessel zurück, weniger aus Bequemlichkeit denn als Zeichen ihres Standes und weil sie sich in der von ihr getragenen Männerkleidung unpräsentabel fühlte. 246Ihre weitere Tourenbeschreibung liest sich wie das Absolvieren eines vorgegebenen Rituals, das Abhaken einer Liste obligatorischer Sehenswürdigkeiten: Ein Gletscher wird bestaunt, «Volkslieder» werden gesungen, beim Anblick eines Jägers wird Schiller zitiert, eine Fahne der Walachei soll auf dem Gipfel gehisst werden, und im Biwak lässt sich die Gräfin von ihren Führern umsorgen, die Idealbilder edler Wilder sind. 247
Die Tour ist jedoch auch eine Prüfung: «Man hatte mich meiner eigenen Kraft überlassen, vermutlich um meine Gewandtheit beurteilen zu können. Ich hatte mich an meine Kleider gewöhnt und ging auf dem Schnee sicheren Schrittes vorwärts, indem ich über die Spalten setzte, welche die verschiedenen Eislager trennen.» 248Die Führer freuen sich über ihre Trittfestigkeit und meinen gar, «dass sie mir wegen meines Selbstvertrauens die Leitung des Unternehmens überlassen könnten», so ihre Worte. 249Doch die Gruppe entfernt sich immer weiter aus dem gewohnten menschlichen Alltag, die Schwierigkeiten nehmen zu. Die Gräfin berichtete, sie habe sich in eine «andere Welt» versetzt geglaubt, «in der nichts dem ähnlich war, was ich bis dahin gesehen hatte. […] Wir befanden uns mitten in einer unermesslichen Wüste, im Angesicht des Himmels und der Naturwunder. […] Der Weg wurde immer mühsamer. Wir kletterten auf allen Vieren, wie Katzen rutschend, oder wie Eichhörnchen von einem Felsen zum andern springend.» 250Zudem machten sich erste Anzeichen von Höhenkrankheit bemerkbar, und die Gruppe musste mit Leitern Abgründe überqueren. Dies nutzte die Gräfin allerdings sofort, um den von ihr gesammelten Sehenswürdigkeiten das Erlebnis des erhabenen Gruselns anzufügen: Mit «unbeschreiblichem Entzücken» habe sie «die gähnenden Schluchten» betrachtet, erzählte sie. 251Am zweiten Tag gelangten sie im dichten Nebel um zehn Uhr vormittags auf eine Fläche am Fuss des Mönchs. Dort musste Dora d’Istria eine längere Pause einlegen. Ihre Erzählung folgt mithin dem klassischen dramaturgischen Schema: Kurz vor dem erfolgreichen Schluss kommt die Krise.
Читать дальше