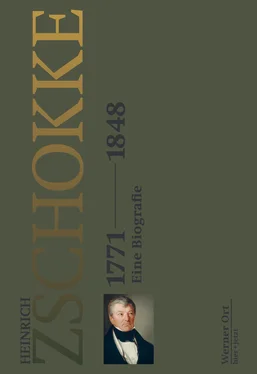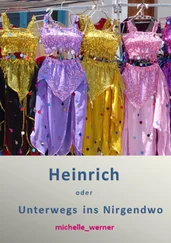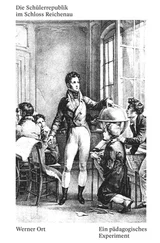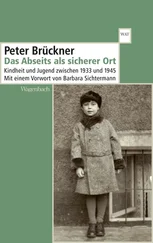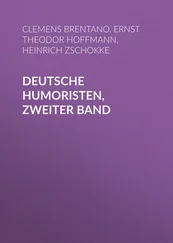Die Frau Gevatterin wurde roth, und warf ihm einen halb verschämt, halb drohend sein sollenden Blick zu.
‹Hm!› sagte eine lange hagre Dame und warf den Kopf etwas zurück: ‹Wochenblatt hin, Wochenblatt her! wir haben ia Lesegesellschaften und Lesebibliotheken, wozu noch ein Wochenblatt? – Man giebt ia doch Geld genug fürs leidige Lesen aus, und unter zehn Blättern taugt öfters kaum ein Blatt etwas; da wird entweder moralisirt, oder satyrisirt, oder poesirt, und dann bekömmt man endlich einmahl so eine kleine Liebesintrigue zur Entschädigung für die Langeweile.›
‹Da haben Sie nicht unrecht,› flüsterte ihr der dürre Postmeister zu: ‹für das Geld ein paar Spiel l’Hombrekarten.› ‹Oder einen neuen Floraufsaz!› lispelte des Postmeisters Tochter. ‹Und überdies,› hub der Pastor loci an und strich die buschichten Augenbraun seitwärts: ‹das Avertissement verspricht so viel, als gar nichts. – Für Weltbürger! ia, ia, die Weltbürger kenn’ ich schon; Indifferentisten, Religionsspötter sollts heißen; das muß ich wissen!›» 231
Das anwesende Fräulein von M.* schlägt schliesslich vor zuzuwarten, was die Zeitschrift bringen möge, wohl «nichts mehr und nichts weniger, als von iedem Wochenblatt, das für Herz und Kopf geschrieben sein soll». Die Anwesenden «horchten und waren galant genug, die Zähne zusammen zu pressen, und mit einem schmeichlerischen Lächeln ein tiefes Kompliment zu machen». 232
Mit dieser Jean-Paulschen Szenerie traf Zschokke das Milieu, von dem seine Ephemeriden wohl gelesen wurden und für das er sie schrieb: der gehobenere Mittelstand kleiner und mittlerer Städte, der sich auf der Jagd nach Gesprächsstoff für seine Zusammenkünfte befand. Zschokke bildete in der Vorrede, wenn auch satirisch verfremdet, die Salons ab, die er selbst frequentierte, und die «Frankfurter Ephemeriden» waren sein Beitrag zu ihrer Unterhaltung, mit ihrem Erscheinen am Samstag gerade rechtzeitig für die sonntäglichen Treffen. Von diesen Kreisen kannte Zschokke die Interessen und stimmte den Inhalt darauf ab.
Friedrich Wilhelm Genthe machte als erster nach Zschokkes Tod auf diese Zeitschrift aufmerksam, von der nur 24 Ausgaben im Umfang von einem Bogen oder 16 Seiten in Oktavo erschienen, schrieb den Titel aber falsch. 233Auf seine Angaben stützten sich nolens volens Alfred Rosenbaum in Goedekes «Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung in Quellen» 234und Carl Günther, der die Zeitschrift nie zu Gesicht bekam, da sie jahrzehntelang verschollen blieb. 235Um 1963 tauchte sie wieder auf, als Geschenk an das Stadtarchiv, und Klaus Barthel, dem langjährigen Leiter der Kleist-Forschungsstätte in Frankfurt (Oder), gebührt der Verdienst, in einer Publikation 1983 wieder darauf hingewiesen zu haben. 236Auch wenn von Mitarbeitern dieser sehr aktiven Kleist-Forschungsstätte seither gelegentlich mit den «Frankfurter Ephemeriden» gearbeitet wird, 237steht eine gründliche Auswertung dieser nicht nur für die Zschokke-Forschung, sondern auch kulturhistorisch interessanten Zeitschrift noch aus.
Der bemerkenswerteste Beitrag in den «Frankfurter Ephemeriden» sind die sich über mehrere Folgen erstreckenden «Wanderungen einer philosophischen Maus», 238in denen es eine «Kirchenmaus» überdrüssig ist, in einer Kirche von kargen Brosamen zu leben, eine Reise durch die Stadt unternimmt und dabei in ein menschliches Narrenhaus gerät. Die schon im «Schriftstellerteufel» angelegte Satire über das Menschlich-Allzumenschliche wird hier um Eitelkeit, Heuchelei, Neid, Missgunst, üble Nachrede, Egoismen und andere Unzulänglichkeiten erweitert. Reumütig kehrt die Maus in ihr altes Heim zurück, nachdem sie festgestellt hat, «daß unter allen Thieren, die der Herr erschaffen hat unterm Monde ihr Futter zu suchen, kein Thier sich selber und unter einander mehr betrügt als der Mensch». 239Es ist eine moralische Erzählung, wie sie für die moralischen Wochenblätter des 18. Jahrhunderts bezeichnend war, 240geprägt von Zschokkes pessimistischem Menschenbild, das sich im Übrigen auch in seiner politischen Einstellung zeigte.
In einem der ersten Stücke der «Frankfurter Ephemeriden» gab er sein Debüt mit Ansichten zur Zeitgeschichte: «Über gewisse in der Revolutionsgeschichte von Frankreich merkwürdig gewordene Gegenstände». 241Mit einiger Verzögerung hatte Zschokke nun doch beschlossen, den Entwicklungen in Frankreich Rechnung zu tragen, gegen das sich Preussen seit dem Vorjahr im Krieg befand. Das Publikum interessierte sich für nichts stärker als für Neuigkeiten aus Frankreich, und Zschokke wollte diesem Umstand Rechnung tragen. Mit der Hinrichtung von Ludwig XVI. am 21. Januar 1793 hatte die Französische Revolution in den Augen der meisten Deutschen ihre brutale Kehrseite gezeigt und allen Glanz verloren. Die Guillotine, dieses klinisch saubere, unerbittliche und unpersönliche Tötungsinstrument, dem vom kleinen Verbrecher über den windigen Volkstribun bis zur Königin alle zum Opfer fielen, erregte in der Öffentlichkeit Gruseln und Schrecken und wurde in den «Frankfurter Ephemeriden» gleich zweimal vorgestellt. 242
Ob er dringend Geld brauchte oder Ausgleich und Erholung von seinen gelehrten Studien: Zschokke schrieb den Roman «Die sieben Teufelsproben», der im Frühling 1794 anonym bei Kaffke in Stettin erschien. 243Er behandelt die Legende des heiligen Martin (316–400), wobei Zschokke sehr freizügig mit der überlieferten Vita umging. Er beschränkte sich auf die erotischen Versuchungen, zunächst durch seine Jugendgespielin, später, als Eremit auf einer Insel, durch die niedliche Arine, die er schlafend neben seiner Hütte findet, wo sie ihm in aller Unschuld die Reize ihres mädchenhaften Körpers preisgibt. Das Titelbild zeigt ihn in frivoler Stellung, wie er unter ihrem Busentuch nach ihrem Herzschlag tastet. 244
«Die sieben Teufelsproben» sind eine erotische Erzählung, angereichert durch eine Geistergeschichte, und diesem Umstand ist es wohl geschuldet, dass Zschokkes Urheberschaft so lange geleugnet wurde, von Friedrich Wilhelm Genthe und Carl Günther ebenso wie von Alfred Rosenbaum. 245Hayn/Gotendorf jedoch haben den Roman Zschokke bereits 1914 zugeschrieben und als «wohl die seltenste der pikanten Jugendarbeiten des Verfassers» bezeichnet. 246Es ist ein Studentenulk, ein Ausloten des Büchermarkts, wie ihn sich auch der junge Ludwig Tieck erlaubte, der in Berlin unter Anleitung seines Lehrers Friedrich Eberhard Rambach mithalf, Schundromane zu fabrizieren. Die Stammbücher der Studenten und der Austausch der alten Herren geben hinreichend Proben solcher Scherze aus ihrer wilden Jugendzeit. 247Wenn man Zschokke unter streng moralischem Gesichtspunkt vorwerfen mag, ein Roman mit solchen Schlüpfrigkeiten und Grobheiten entspreche ganz und gar nicht den Forderungen, die er in seinen «Ideen zur psychologischen Ästhetik» an den «edlen Künstler» erhebe, nur das Schöne und Anständige darzustellen, dann hat das einige Berechtigung. Aber womöglich verspottete Zschokke sein ästhetisches Programm auf diese Weise selber. 248Er spielte zu jener Zeit mit Möglichkeiten und Zukunftsentwürfen und wusste selber nicht recht, auf welche Seite sich die Waage neigte: zum Laster oder zur Tugend, zur Askese oder Sinnlichkeit. 249
Zschokke bewegte sich zu jener Zeit mit verschiedenen Masken. Im Familienzirkel der Apitz, Schulz und Hausen gab er sich als Schöngeist und witziger Conferencier, zwischendurch suchte er die Einsamkeit und pflegte seine Hypochondrie. An der Viadrina und in der Sozietät der Wissenschaften galt er als ernsthafter Gelehrter, der Vorlesungen hielt und zielstrebig auf eine Professur hinarbeitete, in der Freizeit schrieb er Romane und gründete Unterhaltungszeitschriften. Unter Studenten galt er bald als scharfsinniger Denker, feuriger Redner, bald als Verfasser von Gedichten, elegischer Schwärmer und Träumer; handkehrum nahm er an Studentenstreichen teil und zeigte sich verwegen, zu Pferd oder mit dem Rapier, mit scharfer Klinge.
Читать дальше