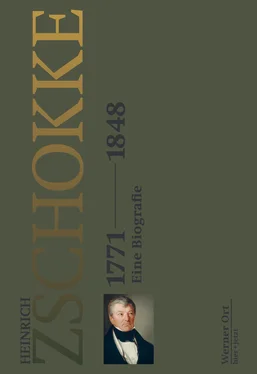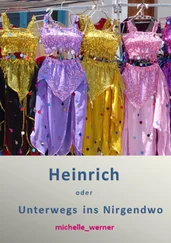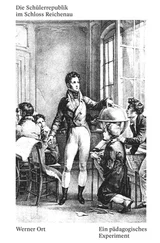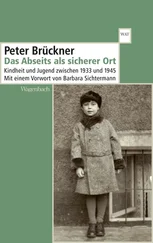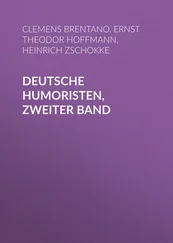Im Herbst oder Winter 1793 schrieb Zschokke die Erzählung «Abällino, der grosse Bandit», die im Venedig des beginnenden 16. Jahrhunderts spielt. 250Venezianische Nobili planen den Sturz des Dogen und heuern Meuchelmörder an, um seine Entourage auszuschalten. Zu den Mördern gehört ein Abällino, der sich durch Tollkühnheit, Intelligenz und aussergewöhnliche Kraft auszeichnet und mit Respektlosigkeit, heiserer Stimme und abstossendem Äussern allen Angst, ja sogar Grauen einflösst. Sein Gegenspieler ist der gut aussehende und liebenswürdige Flodoardo aus Florenz mit vollendeten Manieren, der sich an die Spitze der Sbirren setzt, ins Schlupfloch der Mörder eindringt und sie bis auf Abällino alle ausschaltet. Jetzt ist Abällino unangefochtener Chef der Banditen. Einen nach dem anderen führt er die Auftragsmorde der politischen Verschwörer durch und verhöhnt die Polizei auf Zetteln, die er an Hausfassaden klebt. Beide, Abällino und Flodoardo, lieben Rosamunde, die Nichte des Dogen. Der Doge will sie Flodoardo zur Frau geben, falls er Abällino, den grössten Schrecken Venedigs, zur Strecke bringt. Abällino seinerseits erhält von den Verschwörern den Auftrag, Flodoardo zu töten.
Im Saal des Dogenpalasts soll das Finale stattfinden, denn Flodoardo hat versprochen, Abällino zu einem bestimmten Zeitpunkt herbeizuschaffen, tot oder lebendig. Viele Schaulustige finden sich ein, die vereinbarte Zeit verstreicht, und es geht schon das Gerücht um, Flodoardo habe den Kampf mit seinem Erzrivalen verloren. In derangiertem Zustand taucht er plötzlich auf und behauptet, Abällino befinde sich im Palast. Der Doge will ihn sehen. Flodoardo geht zur Tür, wirft den Mantel ab, dreht sich um und ist in Abällino verwandelt, mit Augenbinde, einem entstellenden Pflaster und widerlichem Grinsen. In der Gestalt des Abällino überführt er die überrumpelten Verschwörer und verlangt vom Dogen grob die Hand von Rosamunde, da er sein Versprechen erfüllt habe. Für den Dogen, dessen beste Freunde Abällino umgebracht hat, kommt das nicht in Frage. Abällino geht noch einmal zur Tür, reisst sie auf und draussen stehen die vermeintlich toten Venezianer. Rosamunde wirft sich Abällino schluchzend an die Brust, mit dem Aufschrei: «Dieser – dieser ist kein Mörder .»
«Abällino, der grosse Bandit», der fünf Jahre vor «Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann» von Goethes Schwager Christian August Vulpius erschien, 251wird zuweilen als erster deutscher Räuberroman bezeichnet, 252als ein «Mantel- und Degenstück». 253Das sind zweifelhafte Zuschreibungen, zumal es sich, auch nach Zschokkes Begriffen, um eine Erzählung und nicht um einen Roman handelt, da ihr der Anfang und das Ende fehlt. «Abällino» steht mit der Thematisierung von Verschwörungen und Staatsintrigen eher in der Nachfolge von Schillers «Verschwörung des Fiesko zu Genua» und ist eine psychologische Studie um das Wesen des Menschen und die ihn beeinflussenden Lebensumstände. 254Den beiden Dramenfassungen von 1795 und 1796 setzte Zschokke das Motto «Verhältnisse bestimmen den Menschen» voran. Auf dem Theater gibt sich «Abällino, der grosse Bandit» als ein Spiel mit Masken und Maskeraden, des sich Verhüllens und Entlarvens, passend zur Vorstellung, die man mit Venedigs Karneval verbindet. All diese Aspekte zusammen trugen dazu bei, dem Werk seine Beliebtheit zu verleihen, im deutschen Kulturraum als Drama, im englischen als Erzählung, in einer fast wörtlichen Übersetzung von Matthew Gregory Lewis (1775–1818), dem sie unter dem Titel «The Bravo of Venice» lange Zeit zugeschrieben wurde. 255Es ist das Verdienst von Josef Morlo, die Erzählung in der Reihe «Kleines Archiv des 18. Jahrhunderts» wieder zugänglich gemacht, 256und das von Holger Dainat, sie literaturgeschichtlich eingeordnet zu haben. 257
«Abällino» sei «das Produkt einer angenehmen, flüchtigen Laune» gewesen, schrieb Zschokke in der Vorrede zur ersten Dramenfassung. «Das Gemälde war ohne Sorgfalt hingeworfen, nur skizzirt, selten hie und da ausgearbeitet, und eigentlich wohl nur angelegt, als Stoff zu einem Drama.» 258In der «Selbstschau» schrieb er, er habe im Studentenkreis eine alte venezianische Anekdote vorgetragen, die er «mit poetischer Freiheit fantastisch genug ausschmückte». 259In dem Fall war ihm mit leichter Hand ein grosser Wurf geglückt, ein Werk, das seine Faszination aus dem schillernden Charakter einer Doppelpersönlichkeit bezog, in welcher Zschokke Eigenschaften ins Spiel brachte, die er in sich selber spürte: Ungestümheit, Rücksichtslosigkeit, Brutalität und Gier. 260
Für die Bühnenfassung straffte Zschokke die Dialoge und akzentuierte die Charaktere. Er vermied es, für Abällino Mitleid zu erwecken, liess ihn nicht erst bittere Erfahrungen als Bettler machen, sondern gleich als Mörder ins Geschäft steigen. Er brauchte jetzt nicht mehr in Hamlets Manier zu zaudern und mit seinem Schicksal zu hadern. Auf der Bühne ist Abällino ein Tatmensch, der das Geschehen vorantreibt und kontrolliert, unzimperlich, direkt, fordernd. Nichts und niemand kann sich ihm entziehen. Das Finale wird sorgsam vorbereitet: Er darf seinen Coup landen, die Verschwörer entlarven, sich von aller Schuld reinwaschen und Rosamunde aus der Hand des Dogen empfangen. Sein Brigantentum ist von Anfang an auf Verstellung angelegt, kühl kalkuliert, um den politischen Bösewichten ihr Handwerk zu legen und des Dogen schöne Nichte zu gewinnen. Rosamunde bezieht im Drama deutlicher Stellung als in der Erzählung: Sie verabscheut Abällino, während sie Flodoardo liebt.
Dies zerstört zwar die Komplexität der Erzählung, verstärkt aber den Theatereffekt in der Stunde der Enthüllung. Im Publikum hinterliessen die Aufführungen das wohlig-gruselige Gefühl, brutalen Banditen bei der Arbeit zuzusehen und am Schluss die Genugtuung zu haben, dass Venedig durch die mutige Tat des Helden vor der Anarchie gerettet wird. Der Bezug zur politischen Lage Deutschlands war mit den Händen zu greifen: Die allgegenwärtige, auch propagandistisch geschürte Angst vor Revolutionen und vor Versuchen, deutsche Fürsten zu stürzen, wird in Zschokkes Stück geschickt benutzt, dramaturgisch verstärkt und im befreienden Schluss aufgelöst.
Der Januar 1794 begann für Zschokke mit einer neuen Zeitschrift, die wiederum bei Apitz erschien. Sie war ganz auf Zschokkes Bedürfnisse zugeschnitten und trug den Namen «Litterarisches Pantheon», weil er sich inhaltlich nicht festlegen wollte: Wie der griechische Tempel sollte sie allen Göttern oder Musen dienen, mit denen er sich gerade herumschlug: Sie enthielt Essays, Gedichte, Dramen, Märchen, Versepen und anderes. Es war eine Fortsetzung der «Schwärmerey und Traum in Fragmenten, Romanen und Dialogen», in monatlicher Stückelung zu 96 Seiten in Oktav (sechs Bogen), und die einzige Zeitschrift Zschokkes, in der er sich an kein klar definiertes Publikum mit einem fest umrissenen Programm wandte. Er liess es darauf ankommen, ob die Zeitschrift Anklang fand. Der Plan, sei «so gut als gar keiner», rügte die «Allgemeine Literatur-Zeitung». 261Gerade das gibt dem Zschokke-Biografen eine gute Ausgangslage, um Einblick in die schriftstellerische Werkstatt und gedanklichen Schwerpunkte Zschokkes zu erhalten. Leider fehlen in den Beständen im Stadtarchiv Frankfurt (Oder) die beiden mittleren Quartalsbände. 262Carl Günther hatte noch Zugriff auf alle vier Bände, als letzter und vielleicht einziger Benutzer, der sie auswertete. 263
Das «Litterarische Pantheon» war die Publikation eines jungen Gelehrten und Dichters mit einem Hang zum Philosophischen, kam in wesentlichen Teilen monologisch daher und dürfte knapp die Aufmerksamkeitsschwelle einer gebildeten Öffentlichkeit überschritten haben. Zschokke verfasste den grössten Teil der Beiträge selbst, aber er schrieb seine Zeitschrift nicht ganz allein. 264
Alle Aufsätzen im «Litterarischen Pantheon», wie auch das meiste, was Zschokke später schrieb, haben einen unmittelbaren Bezug zur Gegenwart oder zu einer aktuellen Auseinandersetzung, als Vorgeschichte, Materiallieferant, Spiegel, Vor- oder Gegenbild. Geschichte, auch Philosophiegeschichte, besass für Zschokke die Aufgabe, den Zeitgenossen lehrreich zu sein. Es gab für ihn keinen Elfenbeinturm des Gelehrtenwissens; stets versuchte er, ihn zu verlassen, um anschaulich zu werden, pädagogisch zu wirken, nützlich zu sein.
Читать дальше