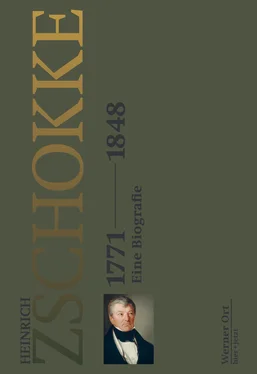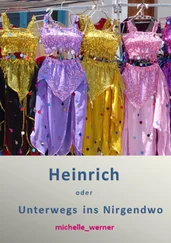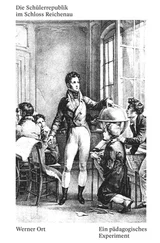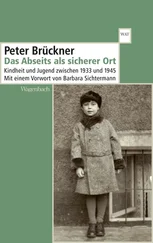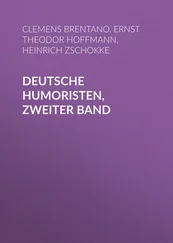Wer sich der Mühe unterzieht, Zschokkes belletristisches, lyrisches und essayistisches Werk aufmerksam zu lesen, findet immer wieder Stellen, an denen er innere Spannungen, philosophische, weltanschauliche und politische Fragen aufarbeitete, die ihn damals stark beschäftigten. Was dem Germanisten oft als ein rotes Tuch erscheint, ist für den Biografen absolut notwendig: das dichterische Werk biografisch auszuwerten.
Wenn im Folgenden mit der «Selbstschau» eher kritisch umgegangen wird, dann nicht, um ihren literarischen Wert zu schmälern, sondern weil Zschokkes Faktentreue fragwürdig war. Der Biograf des 21. Jahrhunderts kann sich nicht mehr auf sie stützen; er muss alle erreichbaren Informationen einbeziehen und stösst dabei auf bedenkliche Ungenauigkeiten und Irrtümer. Hätte Zschokke ein Tagebuch hinterlassen, das er nach eigenen Angaben seit dem zwölften Lebensjahr regelmässig führte, 15so wäre es vielleicht nicht nötig, ständig auf seine Autobiografie zu rekurrieren. Man könnte sie als dichterisches Werk bestehen lassen, als farbige Schilderung von Erlebnissen, Befindlichkeiten, Lebensumständen und Betrachtungen, und müsste sie nur ergänzend für biografische Angaben heranziehen. Ohne ergiebige andere Dokumente ist sie jedoch die Hauptquelle für Zschokkes Leben, besonders für die Kindheit und Wanderjahre, die Studenten- und Dozentenzeit in Frankfurt (Oder). Erst mit der Reise in die Schweiz, im Mai 1795, sind wir nicht mehr oder nur noch teilweise auf sie angewiesen.
«Eine Selbstschau» mag ein glänzend geschriebenes Psychogramm sein, eine in sich stimmige Entwicklungsgeschichte, ein Memoiren- und Geschichtswerk von hohem Rang, sie ist aber auch ein Zurechtrücken der Vergangenheit mit pädagogischen und philosophischen Absichten. Die naive Sicht auf «Eine Selbstschau» als wirklichkeitsnahe Lebensbeschreibung änderte sich erst, als Hans Bodmer 1910 in Berlin «Zschokkes Werke in zwölf Teilen» erscheinen liess 16und «Eine Selbstschau» nach der vierten, noch von Zschokke autorisierten Auflage von 1849 wiedergab. Erstmals stellte jemand die falschen Zeitangaben und Eigennamen richtig. Bodmer holte Erkundigungen im Stadtarchiv Magdeburg und im Archiv der St. Katharinenkirche ein, erschloss weitere Quellen und griff auch auf den Bestand des Familienarchivs in Aarau, das sogenannte Zschokke-Stübchen, zurück. 17Selbst Briefe und Aktenstücke seien von Zschokke «keineswegs in authentischer Form, sondern stets mit kleineren und größeren, ganz willkürlichen Veränderungen» zitiert worden, stellte Bodmer ernüchtert fest. 18«Eine Selbstschau» war nicht mehr sakrosankt. Damit war die Zeit gekommen, Zschokkes Lebensgeschichte zu überarbeiten oder gar neu zu deuten.
Einen weiteren bedeutenden Schritt machte etwa zur gleichen Zeit Alfred Rosenbaum, der für die 2. Auflage von Karl Goedekes «Grundriß der Geschichte der deutschen Dichtung» alles zusammentrug und auf 56 eng beschriebenen Seiten aufführte, was von und über Zschokke in Buchform, Broschüren oder Zeitschriften erschienen war, 19darunter auch, was Zschokke als seine «Jugendsünden» bezeichnete und woran er nicht mehr erinnert werden wollte: sein dichterisches Werk vor seinem 25. Lebensjahr. 20Zwar hatte schon 1850 sein Neffe Genthe, notabene gegen Zschokkes Willen, eine solche Zusammenstellung versucht, 21aber nur sehr lückenhaft. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass Rosenbaum die bereitwillige Unterstützung der Familie Zschokke in Aarau in Anspruch nehmen konnte, die das ganze Schrifttum von und über ihren Ahnvater sammelte.
Aber selbst Goedekes Grundriss war nicht vollständig: Es fehlen die meisten kleineren Arbeiten Zschokkes, seine Aufsätze in Zeitungen und Zeitschriften, seine Reden, handschriftlichen Gutachten und Berichte als Beamter der Helvetik, im Forst- und Bergwesen, als Tagsatzungsgesandter, Grossratsmitglied und Mitglied zahlreicher Kommissionen und privater Gesellschaften, die meisten seiner Gedichte, die Kompositionen und, was die Sekundärliteratur betrifft, die Zeitungsartikel, soweit es sich nicht um Rezensionen handelte. Weiterhin ist die Arbeit Rosenbaums und seiner Nachfolger für die Zschokke-Forschung unentbehrlich, aber seither wurden einige neue, grössere Werke Zschokkes entdeckt, so durch Carl Günther und neuerdings den Heidelberger Bücherforscher Adrian Braunbehrens zwei Erstlingsromane. 22Es wäre also an der Zeit, das Literaturverzeichnis auf den neusten Stand zu bringen, sich vielleicht auch um eine textkritische Neuausgabe seiner Werke zu bemühen.
In der Nachfolge Bodmers und Rosenbaums begannen auch Mitglieder der Familie Zschokke, die über die bedeutendste Materialsammlung zu Zschokke verfügte, einen Beitrag an die Revision seiner Lebensgeschichte zu leisten. Eine eigentliche Pionierarbeit erbrachte Carl Günther (1890–1956), als er während des Ersten Weltkriegs für seine Dissertation über «Heinrich Zschokkes Jugend- und Bildungsjahre» unabhängig von der «Selbstschau» Nachforschungen betrieb und allen noch zugänglichen Spuren nachging. 23Bald stellte auch er fest, dass die «Selbstschau» viele falsche und irreführende Aussagen enthielt, und kommentierte dies so: «Zschokke vermochte sich nicht mehr genau aller Daten zu erinnern, seine Phantasie hatte, was ihm noch gegenwärtig war, umgearbeitet, die Forderung einer streng historischen Darstellung war ihm fremd: so rekonstruierte er sein Leben, unbekümmert darum, ob die Rekonstruktion auch überall der geschichtlichen Wirklichkeit entspreche. Dass aber irgendwo bewusste Fälschung vorliege, ist nicht wahrscheinlich.» 24
Günther benutzte alle ihm zugänglichen Archive, wo er Dokumente vermutete, las, wie schon Hans Bodmer vor ihm, was Zschokke geschrieben hatte oder was über ihn erschienen war. Er benutzte dazu auch die reichhaltige Sammlung seines Onkels Ernst Zschokke (1864–1937) in Aarau, der sich in der Nachfolge von Emil Zschokke, seinem Grossvater, als Sachwalter von Heinrich Zschokkes schriftlichem Nachlass sah. Günther war zudem vertraut mit dem in Aarau liegenden Briefwechsel Zschokkes und stand in Korrespondenz und im Austausch mit privaten Sammlern von Zschokkiana, Nachfahren von Freunden oder Verwandten Zschokkes und mit Lokalhistorikern. 25
Auch Günther hatte ein Zeitfenster der Zschokkeforschung zur Verfügung und ging wohl davon aus, dass andere seine Schilderung über das Jahr 1798 hinaus weiterführen würden. Wie jeder Forscher hoffte er, mit seiner Arbeit einen Stein ins Rollen gebracht zu haben und zu weiteren Studien anzuregen. Tatsächlich übernahm Helmut Zschokke (1908–1978), Nachkomme aus einem anderen Zweig der zahlreichen Familie, die Aufgabe, das fast unüberschaubare Material der Helvetik in öffentlichen und privaten Archiven zu sichten und die Jahre 1798 bis 1801 zu beschreiben. 26Die Herausgabe seiner umfangreichen und fast fertig gestellten Dissertation wurde vereitelt, als er wegen seines Engagements im spanischen Bürgerkrieg 1938 in der Schweiz zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt und von der Universität Zürich relegiert wurde.
Carl Günthers Zeitfenster ging gegen das Ende des Zweiten Weltkriegs zu. Verschiedene Privatnachlässe aus Deutschland sind seither verschollen, Kirchen-, Stadt- und Staatsarchive teilweise vernichtet und Bücher, Zeitungen und Zeitschriften nicht mehr auffindbar. Besonders schmerzlich ist die Lücke im Stadtarchiv Magdeburg, wo die «Alten Akten» mit den Anfangsbuchstaben A bis O fehlen, oder in der Königlichen Staatsbibliothek Breslau (heute Wrocław), mit deren Vernichtung auch die Dokumente der Universität Frankfurt (Oder) untergingen.
Zum Glück rollte der Magdeburger Genealoge Willi Bluhme in der Zwischenkriegszeit die Familiengeschichte Zschokkes anhand von Bürgermatrikeln und Kirchenbucheintragungen auf, 27so dass wir in Ermangelung der Originalakten einen kleinen eisernen Bestand gesicherter Daten über Zschokkes Vorfahren und Magdeburger Verwandte besitzen. Der Zschokke-Biograf nutzt sie ebenso dankbar wie alles, was Carl Günther vor 95 Jahren fand und in seiner Dissertation auswertete.
Читать дальше