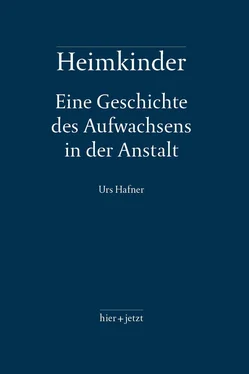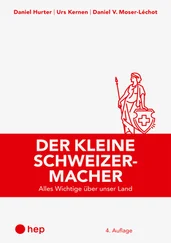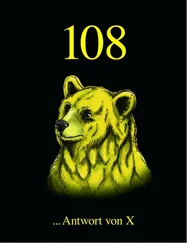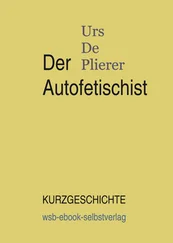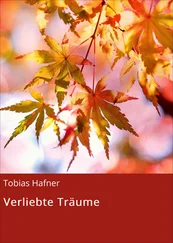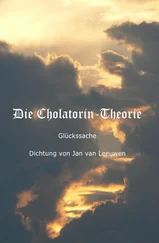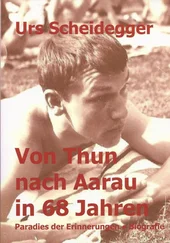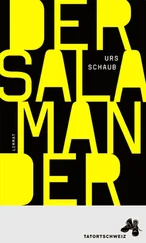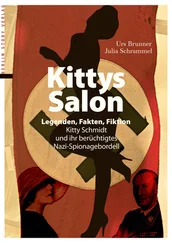Der Tagesablauf dürfte sich an der klösterlichen Ordnung orientiert haben. Gebete und Gottesdienste gehörten zum Spitalalltag. Die einfachen Mahlzeiten wurden an den nicht seltenen Fest- und Feiertagen durch fromme Gaben und Wohltaten von Stiftern aufgebessert. 27Da Armut in der mittelalterlichen Gesellschaft nicht negativ konnotiert war, dürfte sich der Aufenthalt im Spital kaum stigmatisierend auf die Insassinnen und Insassen ausgewirkt haben. Wer im Spital lebte, profitierte von der christlichen Barmherzigkeit und Gnade. Er musste sich – zumindest gemäss der religiösen Theorie – seinen Aufenthalt nicht eigens verdienen.
Die Reformation und ihre Moral
Das mittelalterliche Bild des Spitals, das verarmte und kranke verlassene Kinder sowie Erwachsene aus christlicher Barmherzigkeit in einem Gnadenakt bedingungslos aufnimmt – oft allerdings dürften in erster Linie Bürgerskinder von diesem karitativen Dienst profitiert haben –, evoziert eine in dieser Form nicht mehr bekannte Grosszügigkeit. Sie ist weder in den Arbeitshäusern des 18. Jahrhunderts anzutreffen, noch wird sie vom modernen Sozialmanagement vertreten. Im Mittelalter wurden Arme, Verlassene, Bettelnde nicht per se stigmatisiert. Ein Waisenkind, welches das Jugendalter erreicht hatte, verliess das Haus und machte sich, angehalten zu einem christlich guten Leben, als Bettler auf den Lebensweg. Eine Strafe hatte es dafür nicht zu gewärtigen. Freilich sollten die Verhältnisse im mittelalterlichen Spital nicht romantisiert werden: Der Umgang der Leitung mit den Insassen dürfte angesichts der verbreiteten Gewalttätigkeit in der spätmittelalterlichen Gesellschaft ruppig gewesen sein; in dem mit randständigen, alten und jungen Menschen gefüllten Haus kam es wohl zu gewalttätigen Übergriffen auf die Schwächeren nicht nur seitens der Spitalführung. Sehr wahrscheinlich war die Verpflegung – ebenfalls vor dem Hintergrund der damaligen krisenhaften Situation – eher karg.
Die Realisierungschancen der zumindest in der Botschaft des christlichen Evangeliums verheissenen Grossherzigkeit wurden im 15. Jahrhundert vermindert. In dieser Krisenzeit zeichnete sich eine grundlegende Änderung der gesellschaftlichen Einstellung gegenüber der Armut und dem Bettel ab. Das soziale Klima verhärtete sich. In vielen Städten kam es zu einer Wende sowohl in der Armenfürsorge als auch im Anstaltswesen. Eine ganz Westeuropa erfassende christliche Reformbewegung führte zu zwei normativen Neuerungen: Arme wurden im theologischen Diskurs in würdige und unwürdige geschieden sowie in eigene und fremde. 28Davon waren natürlich auch die ohne elterliche Obhut aufwachsenden Kinder betroffen.
Der im Prinzip alte Topos der gesunden und arbeitsfähigen «starken Bettler» (mendicantes validi), die den barmherzigen Mitmenschen ein Gebrechen oder eine Behinderung vortäuschten, wurde im Spätmittelalter aktualisiert. Ein Grund war ein wirtschaftlicher: Weil viele Menschen vom Land in die wachsenden Städte zogen, kam es dort zu einem Überschuss an Arbeitskräften. Da man viele Zugezogene aufgrund ihrer fehlenden Fähigkeiten nicht in den Gewerben einsetzen konnte, nahm die Zahl der Verarmten und im Prinzip arbeitsfähigen Bettler stark zu. Viele europäische Städte wurden ein erstes Mal vom Phänomen des Pauperismus getroffen. 29Der um 1800 in England als Reaktion auf eine neue Massenarmut entstandene Begriff bezeichnet den Umstand, dass der Arme, der «Pauper», sich durch Arbeit kein ausreichendes Einkommen mehr verschaffen konnte. Heute spricht man in Bezug auf dieses keineswegs verschwundene Phänomen von «working poor».
Sporadisch ausbrechende Unruhen verstärken im ausgehenden Mittelalter die Furcht vor Armen. In den städtischen Gesellschaften herrschte eine zunehmende Prekarität und Instabilität der Lebens- und Einkommensverhältnisse; Ursache der Armut waren neben ökonomischen Zyklen auch Seuchen und Krankheiten, betroffen waren besonders ältere und alleinstehende Menschen, schwangere Frauen und natürlich Kinder. 30In der Folge dieser wirtschaftlichen und sozialen Erschütterungen kam es zu heftigen Abwehrreaktionen gegen Randgruppen; Juden, Aussätzige, Prostituierte und Bettler mussten sich mit ihrer Kleidung als solche erkenntlich machen, Kriminelle wurden durch Verstümmelungen stigmatisiert. Kurzum: Abweichendes Verhalten wurde kriminalisiert. In dieser Zeit konzentrierten die städtischen Obrigkeiten Minderheiten auf bestimmte Orte; Leprosorien, Bordelle und die sogenannten Judengassen entstanden. Der Arme wurde von der Gesellschaft nicht länger als solcher akzeptiert, ja respektiert, weil er dem Reichen eine Möglichkeit zur Erlangung von Gnade bot. Die städtischen Obrigkeiten unterrichteten sich gegenseitig über die Machenschaften der betrügerischen Bettler. Es kursierten Verzeichnisse mit über 20 stereotypen Kennzeichen, anhand deren diese zu identifizieren waren. 31Fremde Bettler wurden konsequent vertrieben. Die Beichtväter sorgten dafür, dass die Verweigerung der Hilfe an die «starken Bettler» das gute Gewissen nicht beunruhigte. Sie vermittelten den Laien die Unterscheidung zwischen echten und arbeitsscheuen Bettlern und machten ihnen deren Beachtung gar zur Pflicht. 32
Diese Verhärtung des sozialen Klimas wurde von der Reformation, die sich in den meisten grösseren Städten der heutigen Schweiz durchsetzen konnte, noch verstärkt. Die Armenfürsorge wurde erneuert und zentralisiert: Sie ging von der Kirche auf die Räte über. Unter dem Einfluss der reformatorischen Lehre rationalisierte, bürokratisierte und pädagogisierte die städtische Obrigkeit das Fürsorge- und Armenwesen. Unter dem Einfluss des neuen theologischen Diskurses über Arbeit und Armut wendeten die Räte die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Armen, zwischen berechtigten und unberechtigten Armen konsequent an und schränkten ihre karitativen Leistungen auf Ortsansässige ein. Die Obrigkeiten behafteten die Unterstützungsempfänger auf ihre Arbeitspflicht und kritisierten mehr denn je Müssiggang, Völlerei, Trunk und Spiel. 33
1523 verordnete die Stadt Zürich, 1527 die Stadt Bern die Kennzeichnung der eigenen Armen und Bettler durch Schilder, um sie sichtbar von fremden Vaganten abzugrenzen. Die Fürsorgeeinrichtungen nahmen nur solche Leute auf, die entweder einen finanziellen Beitrag leisten konnten oder wirklich gänzlich unfähig waren, sich irgendwie selber durchzubringen. 341525 trat in Zürich die Almosenordnung in Kraft. Ihre wichtigsten Bestimmungen waren das Bettelverbot und die Scheidung der Armen in würdige und unwürdige. 35Sie unterschied nicht zwischen Erwachsenen und Kindern; für Letztere galt kein Ausnahmerecht. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mussten arme Kinder abends durch die Bettelvögte ins Spital geführt, fremde bettelnde Kinder aber sollten weggewiesen werden. Kinder, die beim Betteln erwischt wurden, sollten in den Turm gelegt, also inhaftiert werden; falls sie nochmals beim Betteln gesichtet wurden, waren sie erneut zu inhaftieren und auszupeitschen. 36
Die Zentralisierung und Rationalisierung der Armenfürsorge und der Spitäler wirkten sich besonders deutlich in Genf aus. Vor der Reformation widmeten sich dort insgesamt sieben Spitäler der Fürsorge für Arme und Kranke. 1535 wurden diese Institutionen im Hôpital général straff zentralisiert, das auch Waisen, Findelkinder, uneheliche Kinder und solche aufnahm, bei denen die Obrigkeit der Ansicht war, sie würden bei den Eltern nicht gut versorgt, weil diese durch einen unziemlichen Lebenswandel auffielen. Die Zentralisierung lässt sich nicht nur in den reformierten Städten beobachten, sondern mit einigen Jahrzehnten Verzögerung im Rahmen der durch die Reformation ausgelösten Konfessionalisierung auch in katholischen Orten. 37So wurden in der Stadt Luzern in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Bettelmandate erlassen. Die Obrigkeit behauptete, Kinder würden durch den Bettel zu «armen ungerathenen Lüthen». Wenn sie sich nach sechs Uhr abends auf der Strasse herumtrieben, wurden sie inhaftiert und ihre Eltern bestraft. Verlassene Kinder wurden ins Spital verbracht und von dort aus verdingt. 38
Читать дальше